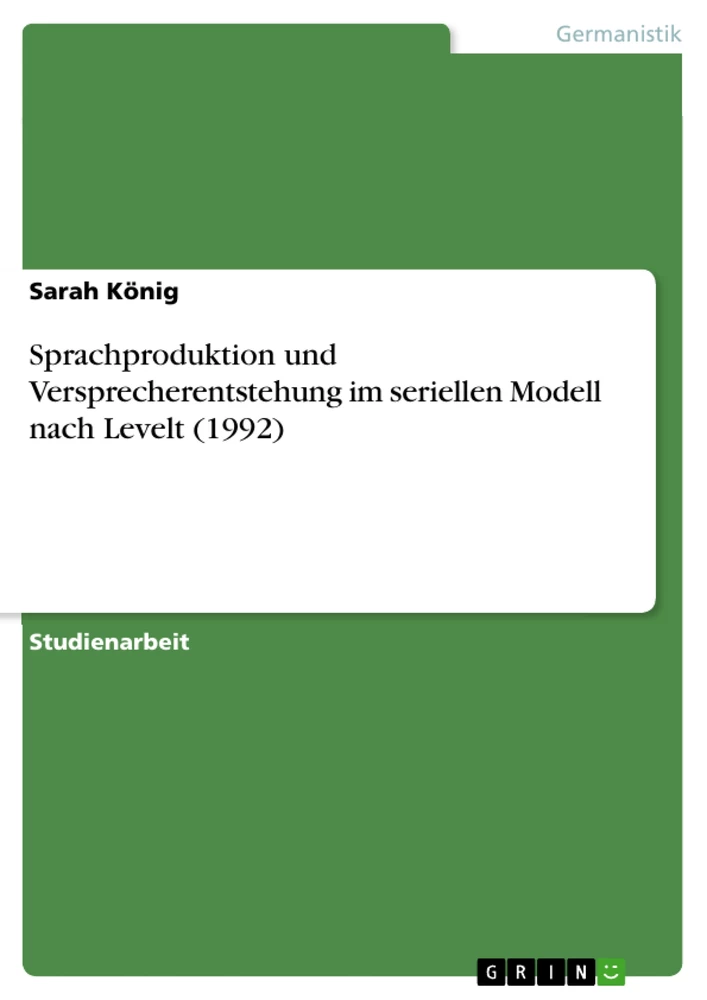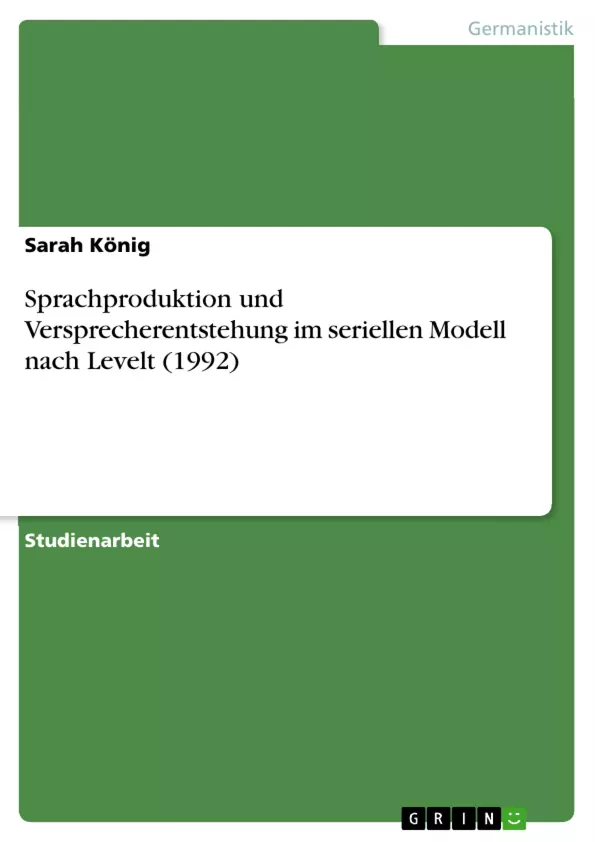In dieser Hausarbeit wird Levelts Modell der Sprachproduktion zusammengefasst um daraufhin im Rahmen des Modells Möglichkeiten der Entstehung zweier Versprechertypen auf der Phonemebene (Phonemreiteration und Phonemvertauschung) anhand von konkreten deutschsprachigen Beispielen zu diskutieren. Diese Arbeit bezieht sich auf Levelts Modell von 1992, wo dieses Lücken aufweist wird auf Levelt et al. (1999) Bezug genommen.
Worüber machen wir uns Gedanken wenn wir über Sprachproduktion nachdenken? Über die Mechanismen einer unserer zentralen kognitiven Fähigkeiten. Diese Mechanismen sollen erklären, wie eine kommunikative Intension in eine sprachliche Äußerung überführt wird.
Die Forschung zur Sprachproduktion ist wesentlich weniger umfangreich als die zum Sprachverständnis, was vor allem daran liegt, dass die Sprachproduktion schwerer zu untersuchen ist (Harley 2010: 397). Wie kann der Aufbau des Sprachproduktionssystems untersucht werden? Introspektion taugt dazu nicht, da wir keinen bewussten Zugriff auf die zu untersuchenden Prozesse haben (Levelt 1992: 2).
Doch es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit deren Hilfe Erkenntnisse über das Sprachproduktionssystem gewonnen werden können. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden deshalb Abweichungen von flüssiger Sprache untersucht. Dazu gehören Verzögerungen und Versprecher, welche im spontanen Sprachfluss auftreten oder experimentell ausgelöst werden können. Außerdem nehmen Reaktionszeitparadigmen eine wichtige Stellung ein, sowie die Integration von neueren Erkenntnissen aus der Neuropathologie (Levelt 1992: 2f.).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Sprachproduktion im seriellen Modell nach Levelt (1992)
- 2.1. Lexikalische Selektion
- 2.2. Phonologische Enkodierung
- 2.3. Monitoring
- 3. Versprecherentstehung
- 3.1. Phonemreiteration
- 3.2. Phonemvertauschung
- 4. Zusammenfassung/Ausblick/Konklusion/Kritik am Modell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachproduktion und die Entstehung von Versprechern im seriellen Modell nach Levelt (1992). Ziel ist es, Levelts Modell zu erläutern und anhand von Versprechern seine Annahmen zu überprüfen.
- Serielles Modell der Sprachproduktion nach Levelt
- Lexikalische Selektion und phonologische Enkodierung
- Entstehung von Phonemreiteration und Phonemvertauschung
- Analyse von Fehlern als Einblick in den Sprachproduktionsprozess
- Bewertung und Kritik des Modells
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen der Sprachproduktionsforschung und die Notwendigkeit, indirekte Methoden wie die Analyse von Sprachfehlern (Versprechern) zu verwenden, um Einblicke in die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse zu gewinnen. Sie führt in die Thematik ein und begründet die Wahl des Modells von Levelt (1992) als theoretisches Fundament der Arbeit. Die Schwierigkeit der Introspektion bei der Erforschung der Sprachproduktion wird hervorgehoben, und es wird der Fokus auf die Untersuchung von Abweichungen von flüssiger Sprache wie Verzögerungen und Versprecher gelegt, um Erkenntnisse über das Sprachproduktionssystem zu gewinnen.
2. Sprachproduktion im seriellen Modell nach Levelt (1992): Dieses Kapitel beschreibt Levelts serielles Modell der Sprachproduktion, das diskrete Verarbeitungsstufen annimmt, die nacheinander ablaufen ohne Interaktion. Der Fokus liegt auf dem "Formulator", der eine vorsprachliche Botschaft in einen phonetischen Plan umwandelt. Das Kapitel erläutert die beiden Hauptstufen: die lexikalische Selektion (Auswahl geeigneter lexikalischer Einheiten aus dem mentalen Lexikon) und die phonologische Enkodierung (Erstellung der phonetischen Form). Zusätzliche Aspekte wie die "Message" und der Artikulationsprozess werden kurz erwähnt, wobei der Schwerpunkt auf den beiden detailliert beschriebenen Stufen liegt. Die Bedeutung von Reaktionszeitparadigmen als Grundlage des Modells wird hervorgehoben.
2.1. Lexikalische Selektion: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit der lexikalischen Selektion als Kernbestandteil der grammatischen Enkodierung. Es wird erklärt, wie ausgehend von einem Konzept die geeignete lexikalische Einheit (Lemma) aus dem mentalen Lexikon ausgewählt wird, unter Berücksichtigung der semantischen und syntaktischen Eigenschaften der Lemmata. Der Unterschied zwischen offenen Wortklassen (semantisch getrieben) und Funktionswörtern (syntaktisch getrieben) wird thematisiert. Die Aktivierung eines Lemmas und die damit verbundene Aktivierung der syntaktischen Information werden als zentrale Prozesse beschrieben.
Schlüsselwörter
Sprachproduktion, Levelt-Modell, serielles Modell, Versprecher, Phonemreiteration, Phonemvertauschung, lexikalische Selektion, phonologische Enkodierung, mentales Lexikon, Sprachfehler, kognitive Prozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprachproduktion und Versprecher im seriellen Modell nach Levelt (1992)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sprachproduktion und die Entstehung von Versprechern anhand des seriellen Modells der Sprachproduktion nach Levelt (1992). Sie erläutert das Modell und überprüft dessen Annahmen mit Hilfe von Versprecheranalysen.
Welches Modell der Sprachproduktion wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das serielle Modell der Sprachproduktion von Levelt (1992). Dieses Modell geht von diskreten, nacheinander ablaufenden Verarbeitungsstufen ohne Interaktion aus.
Welche Stufen der Sprachproduktion werden im Detail behandelt?
Im Fokus stehen die lexikalische Selektion (Auswahl von Wörtern aus dem mentalen Lexikon) und die phonologische Enkodierung (Erstellung der phonetischen Form). Weitere Stufen wie die "Message"-Formulierung und die Artikulation werden kurz erwähnt.
Was sind Versprecher und wie werden sie in der Arbeit verwendet?
Versprecher sind Sprachfehler, die als indirekte Methode zur Untersuchung der kognitiven Prozesse der Sprachproduktion dienen. Die Analyse von Phonemreiteration (Wiederholung von Phonemen) und Phonemvertauschung (Vertauschung von Phonemen) hilft, das Levelt-Modell zu überprüfen.
Wie funktioniert die lexikalische Selektion nach Levelt?
Die lexikalische Selektion beschreibt die Auswahl der passenden Wörter aus dem mentalen Lexikon. Dabei werden semantische (Bedeutungs-) und syntaktische (grammatische) Eigenschaften der Wörter berücksichtigt. Der Unterschied zwischen offenen Wortklassen und Funktionswörtern wird thematisiert.
Was ist die phonologische Enkodierung?
Die phonologische Enkodierung ist der Prozess, bei dem die ausgewählten Wörter in ihre phonetische Form umgewandelt werden, also in die Laute, aus denen sie bestehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zum seriellen Modell nach Levelt (mit Unterkapiteln zur lexikalischen Selektion und phonologischen Enkodierung), ein Kapitel zur Entstehung von Versprechern (mit Unterkapiteln zu Phonemreiteration und Phonemvertauschung) und eine Zusammenfassung/Konklusion/Kritik des Modells.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachproduktion, Levelt-Modell, serielles Modell, Versprecher, Phonemreiteration, Phonemvertauschung, lexikalische Selektion, phonologische Enkodierung, mentales Lexikon, Sprachfehler, kognitive Prozesse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Levelts serielles Modell der Sprachproduktion zu erläutern und anhand der Analyse von Versprechern dessen Annahmen zu überprüfen. Es soll ein Einblick in die kognitiven Prozesse der Sprachproduktion gewonnen werden.
Warum werden indirekte Methoden wie die Analyse von Sprachfehlern verwendet?
Die direkte Beobachtung der kognitiven Prozesse der Sprachproduktion ist schwierig. Indirekte Methoden wie die Analyse von Versprechern ermöglichen Einblicke in die zugrundeliegenden Prozesse, da diese Fehler Aufschluss über die Abläufe im Sprachproduktionssystem geben.
- Quote paper
- Sarah König (Author), 2015, Sprachproduktion und Versprecherentstehung im seriellen Modell nach Levelt (1992), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314110