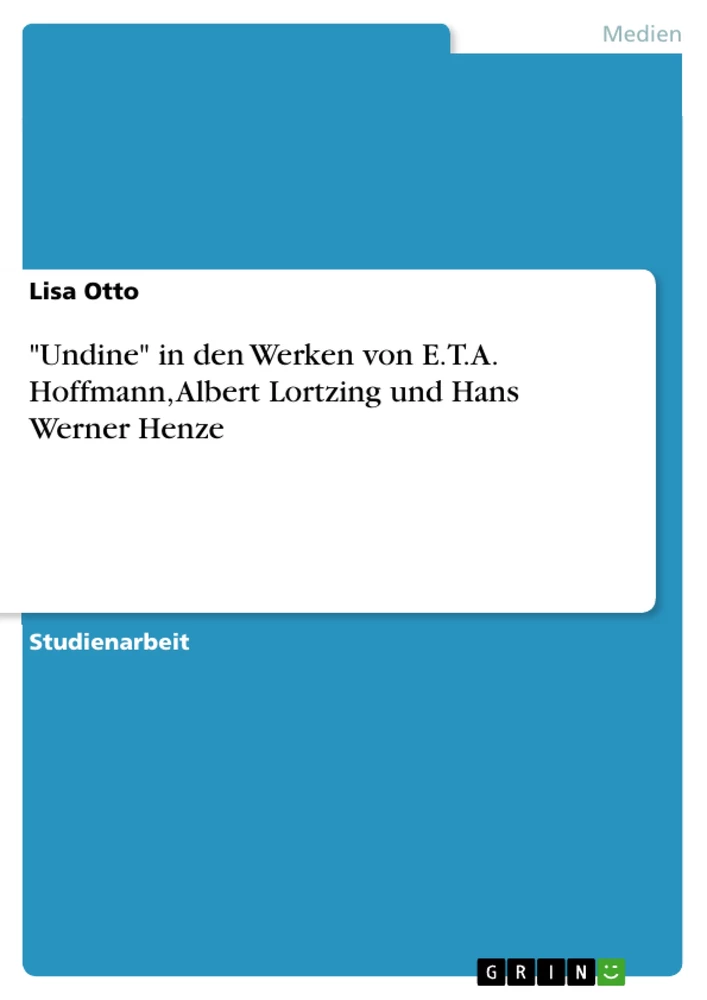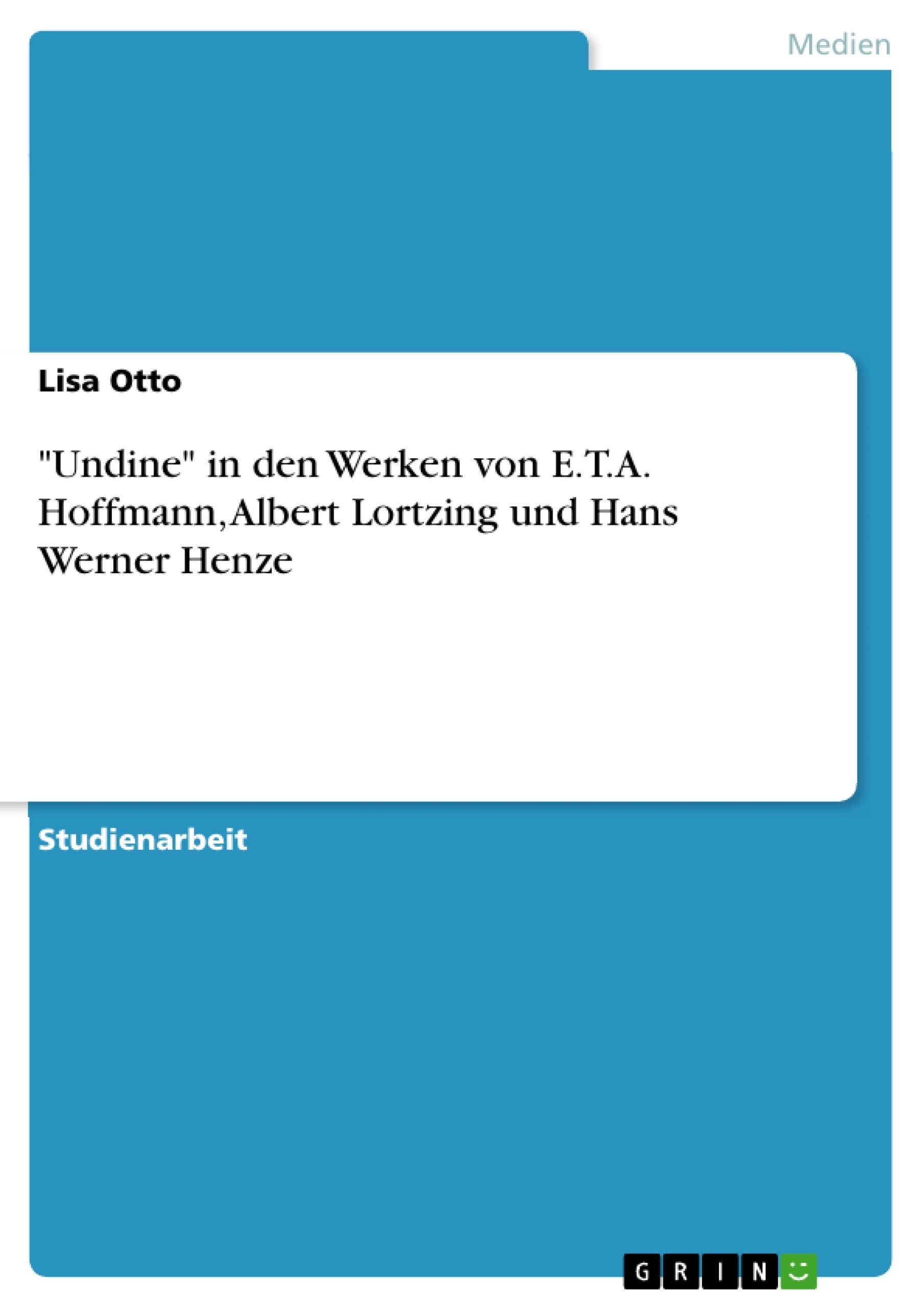Die Hausarbeit wurde im Rahmen eines Dramaturgie-Seminars erstellt. Die Geschichte und Bedeutung der "Undine"-Erzählung wird betrachtet, ehe der Fokus auf Libretti und musikalische Mittel der drei Komponisten gerichtet wird.
Die „Undine“-Opern E. T. A. Hoffmanns und Albert Lortzings, beide beruhend auf der gleichnamigen Erzählung von Friedrich de la Motte-Fouqué, zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Interpretationen ihrer Vorlage aus. Hoffmanns „Undine“, im Jahr der Uraufführung ein lokaler Erfolg, wurde seitdem nur weniger Male (Ulrich Schreiber gibt 4 Wiederaufführungen der Undine im 20. Jahrhundert an, die letzte davon 1970) inszeniert. Lortzings Oper war bis in die Fünfziger des 20. Jahrhunderts beim Opernpublikum äußerst beliebt, wurde seitdem aber ebenfalls selten zur Aufführung gebracht. Dennoch wird den Werken in der Musikgeschichte eine Rolle zugewiesen, und häufig werden sie dabei zueinander in Beziehung gesetzt: „Eine symbolische Klammer verbindet zwischen Wiener Kongress und Vormärz die Undine von E. T. A. Hoffmann (1816) und Lortzing (1845)“.
In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich Hoffmanns, Lortzings und Henzes „Undine“-Werke näher
betrachten. Dazu werde ich zunächst auf Fouqués Erzählung eingehen und deren Entstehung und Rezeption
kommentieren sowie zu erfassen versuchen, wieso der Stoff als Grundlage musikalischer sowie auch als
Grundlage von Werken jeglicher anderer künstlerischer Gattungen – in der bildenden Kunst gibt es „Undine“-
Gemälde von Johann Heinrich Füssli, John William Waterhouse oder Paul Gaugin, auch Hans Christian
Andersens „Kleine Meerjungfrau“(1837), Jean Giraudoux´ „Undine“ (1939)oder Ingeborg Bachmanns „Undine
geht“(1961) – letzteres ist in Beziehung zu Henzes Ballett zu setzen, da ihn und Bachmann eine enge
Künstlerfreundschaft verband - beruhen auf Fouqués Erzählung – bedeutsam ist. Daraufhin werde ich mich den
Musikwerken in chronologischer Reihenfolge widmen. Durch die Betrachtungen der Opern und des Balletts
werden einerseits das Schaffen und ästhetische Vorstellungen der Komponisten beleuchtet, zugleich zeigt sich
hier Unterschiedlichkeit und Konstantes in der Interpretation des „Undine“-Stoffs. Diese Gemeinsamkeiten und
Unterschiede sollen in einem abschließenden Vergleich zueinander in Beziehung gesetzt werden
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1.1 Fouqués „Undine“ - Einflüsse und Rezeption
- 1.2 „Undine“ als romantische Erzählung und als Opernstoff
- 2.1 E. T. A. Hoffmanns „Undine“
- 2.1.1 Libretto
- 2.1.2 Musik
- 2.2 Albert Lortzings „Undine“
- 2.2.1 Libretto
- 2.2.2 Musik
- 2.3 Hans Werner Henzes „Undine“
- 3 Zusammenfassung, Vergleich und abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den „Undine“-Werken von E. T. A. Hoffmann, Albert Lortzing und Hans Werner Henze, die auf der gleichnamigen Erzählung von Friedrich de la Motte-Fouqué basieren. Ziel ist es, die verschiedenen Interpretationen der Vorlage durch die Komponisten zu analysieren und ihre ästhetischen Vorstellungen zu beleuchten. Die Arbeit untersucht auch die Entwicklung des „Undine“-Stoffes in verschiedenen künstlerischen Gattungen.
- Die Entstehung und Rezeption von Fouqués „Undine“
- Die „Undine“ als romantische Erzählung und ihr Potenzial als Opernstoff
- Der Einfluss von Paracelsus und Böhme auf die Entwicklung des Wassergeist-Motivs
- Die Interpretation des „Undine“-Stoffes durch die verschiedenen Komponisten
- Die Bedeutung des Mythischen in der „Undine“-Erzählung und ihren Vertonungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die drei „Undine“-Werke von Hoffmann, Lortzing und Henze vor und erläutert ihren unterschiedlichen Stellenwert in der Musikgeschichte. Sie hebt die Bedeutung der Vorlage von Fouqué und die Rezeption des „Undine“-Stoffes in anderen Kunstformen hervor.
Kapitel 1.1 analysiert Fouqués „Undine“ hinsichtlich seiner Entstehung und Rezeption. Es beleuchtet den Einfluss von Novalis, Paracelsus und Böhme auf die Erzählung und diskutiert die Bedeutung des pantheistischen Gedankenguts. Kapitel 1.2 beschäftigt sich mit dem romantischen Gehalt von „Undine“ und untersucht die Rolle des Wassergeist-Motivs im 19. Jahrhundert.
Kapitel 2.1 widmet sich E. T. A. Hoffmanns „Undine“ und analysiert sowohl das Libretto als auch die Musik der Oper. Kapitel 2.2 setzt sich mit Albert Lortzings „Undine“ auseinander, wobei der Fokus auf dem Libretto und der Musik liegt. Kapitel 2.3 behandelt Hans Werner Henzes „Undine“ und beleuchtet die Besonderheiten des Balletts.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter und Themengebiete der Arbeit sind: „Undine“, Friedrich de la Motte-Fouqué, E. T. A. Hoffmann, Albert Lortzing, Hans Werner Henze, romantische Erzählung, Wassergeist, Oper, Ballett, pantheistisches Gedankengut, Paracelsus, Böhme, Mythos, Kunst und Natur, Rezeption.
- Quote paper
- Lisa Otto (Author), 2012, "Undine" in den Werken von E.T.A. Hoffmann, Albert Lortzing und Hans Werner Henze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314102