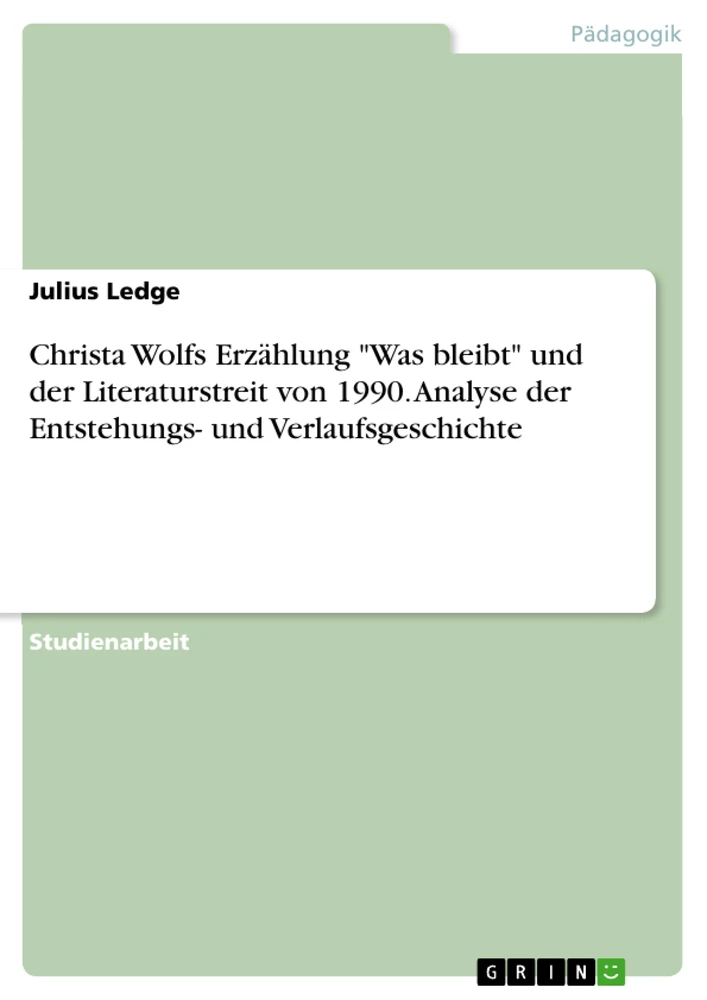Wie eine kleine Erzählung wie Christa Wolfs "Was bleibt" einen medienwirksamen Literaturstreit auslösen konnte, der über die Grenzen des Buches hinweg auch die Autorin Christa Wolf verurteilte und sich so weit ausdehnte, dass es am Ende nicht mehr um Werk und Autor, sondern um das Urteil einer ganzen politischen und literarischen Nation ging, soll in der vorliegenden Semesterarbeit geklärt werden.
Im speziellen geht die Arbeit hierbei auf die Ursachen, die Auslöser und den Werdegang der Debatte ein. In diesem Zuge wird auch der Begriff der Gesinnungsästhetik genauer beleuchtet werden, bevor sich mit der Frage beschäftigt wird, ob sich Christa Wolf mit ihrer Erzählung nachträglich zum Opfer stilisieren wollte.
„Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd.“ Die Aussage dieser Sätze, die Christa Wolfs 1976 erschienenen Roman „Kindheitsmuster“ einleiten, spielen in dem Schaffen und Leben der Autorin eine übergeordnete Rolle. So gehört auch die 1929 geborene Autorin zu jener Generation welche im Nachkriegsdeutschland die Begriffe „Erinnern“ und „Vergessen“ zu Leitworten machte, um die jüngste Vergangenheit aufzuarbeiten. Genau die Leitworte sollten es allerdings auch sein, mit denen Christa Wolf konfrontiert werden sollte und die in Beziehung zu Begriffen, wie „Heuchelei“, „Lebenslüge“ und „DDR-Staatsdichterin“ gesetzt werden sollten.
Auslöser dafür war das Erscheinen von Wolfs Erzählung „Was bleibt“ kurz vor der deutschen Wiedervereinigung. Unschwer lassen sich in dem Werk autobiografische Züge erkennen. Erzählt wird von einem Tag im März 1979. Eine Ostberliner Schriftstellerin schildert in ihrer Wohnung in inneren Monologen ihren Tagesablauf, ihre Gedanken und ihre Ängste. Sie weiß, dass sie von der Staatssicherheit der DDR observiert wird. Den Höhepunkt der Erzählung bildet eine unter Polizeischutz stehende Lesung bei der ebenfalls Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes anwesend sind.
Ziemlich genau zeichnet die Erzählung ein Abbild davon, wie ein Schriftsteller in der DDR gelebt und observiert wurde. „Was bleibt“ lässt damit Rückschlüsse auf das Leben Christa Wolfs zu. Auch sie wurde von 1965 an von der Stasi überwacht und kann so ein ziemlich genaues Bild eines privilegierten aber dennoch eingeschränkten Schriftstellers auf ihr Werk projizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Literaturstreit
- Phase 1: Initiation des Streits
- Vorgeschichte - die Rezensionen Nolls und Reich-Ranickis
- Kritik an DDR-Autoren
- Phase 2: Abrechnung mit der DDR-Literatur
- Eskalation des Streits
- Degradierung der DDR-Literatur
- Phase 3: Gesinnungsästhetik und Akteneinsicht
- Phase 1: Initiation des Streits
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Literaturstreit, der im Jahr 1990 nach dem Erscheinen von Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ entbrannte. Sie analysiert die Ursachen, Auslöser und Entwicklungen der Debatte. Dabei wird insbesondere der Begriff der „Gesinnungsästhetik“ beleuchtet und die Frage untersucht, ob Christa Wolf mit ihrer Erzählung nachträglich zum Opfer stilisieren wollte.
- Die Entstehung des Literaturstreits um Christa Wolfs „Was bleibt“
- Die Rolle von Rezensionen und Medien in der Eskalation des Streits
- Der Begriff der „Gesinnungsästhetik“ im Kontext der DDR-Literatur
- Die Frage nach Christa Wolfs Rolle im DDR-System
- Die Debatte um die Rolle des Schriftstellers in einer Diktatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, welche die Ursachen, Auslöser und den Werdegang des Literaturstreits um Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ untersucht. Der Text beleuchtet den Kontext der Debatte sowie die Bedeutung der Begriffe „Erinnern und Vergessen“ im Schaffen der Autorin.
Der Literaturstreit
Phase 1: Initiation des Streits
Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorläufern des Literaturstreits, die in Form von Rezensionen von Chaim Noll und Marcel Reich-Ranicki auf Christa Wolfs Werk „Die Dimensionen des Autors“ zu sehen sind. Noll und Reich-Ranicki kritisieren Christa Wolfs Haltung gegenüber dem DDR-System als heuchlerisch und werfen ihr vor, sich diesem systemkonform zu bedienen, obwohl sie dessen Missstände erkannt habe.
Phase 2: Abrechnung mit der DDR-Literatur
In dieser Phase eskalierte der Streit. Die Kritik an Christa Wolf intensivierte sich und umfasste nicht nur ihre literarische Leistung, sondern auch ihre Persönlichkeit. Sie wurde als „DDR-Staatsdichterin“ bezeichnet und ihre Loyalität gegenüber dem System in Frage gestellt.
Schlüsselwörter
Christa Wolf, Literaturstreit, „Was bleibt“, Gesinnungsästhetik, DDR-Literatur, Staatssicherheit, Heuchelei, Lebenslüge, politische und literarische Nation, Rezensionen, Feuilletons, Sekundärliteratur, Thomas Anz, Chaim Noll, Marcel Reich-Ranicki.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser des Literaturstreits von 1990?
Auslöser war das Erscheinen der Erzählung „Was bleibt“ von Christa Wolf, in der sie ihre Überwachung durch die Stasi im Jahr 1979 thematisiert.
Worum geht es in Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“?
Das Werk beschreibt einen Tag im Leben einer Ostberliner Schriftstellerin, die von der Staatssicherheit beobachtet wird. Es trägt stark autobiografische Züge der Autorin.
Was bedeutet der Begriff „Gesinnungsästhetik“ in diesem Kontext?
Der Begriff wurde in der Debatte genutzt, um eine Literaturkritik zu beschreiben, die weniger das Werk an sich als vielmehr die moralische und politische Haltung (Gesinnung) des Autors bewertet.
Warum wurde Christa Wolf im Zuge der Debatte so scharf kritisiert?
Kritiker wie Ulrich Greiner und Frank Schirrmacher warfen ihr vor, eine „Staatsdichterin“ der DDR gewesen zu sein und sich mit „Was bleibt“ nachträglich zur Opferstilisierung zu bekennen.
Welche Rolle spielten Marcel Reich-Ranicki und Chaim Noll?
Ihre Rezensionen zu Wolfs „Die Dimensionen des Autors“ leiteten die erste Phase des Streits ein, indem sie Wolfs systemkonformes Verhalten trotz ihrer Privilegien in der DDR kritisierten.
- Arbeit zitieren
- Julius Ledge (Autor:in), 2015, Christa Wolfs Erzählung "Was bleibt" und der Literaturstreit von 1990. Analyse der Entstehungs- und Verlaufsgeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313925