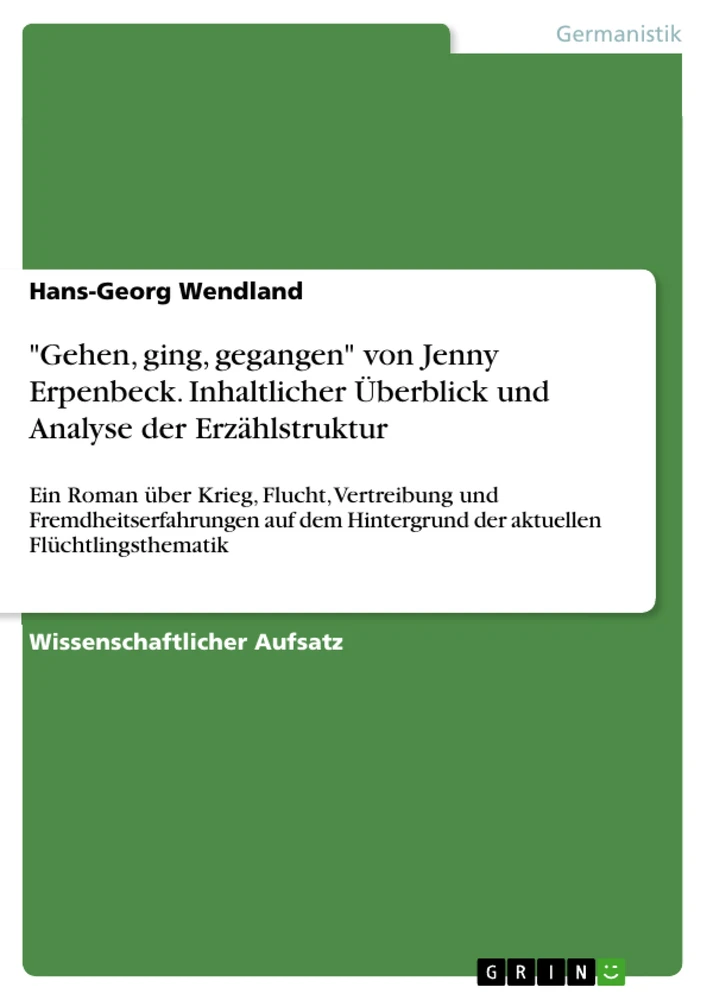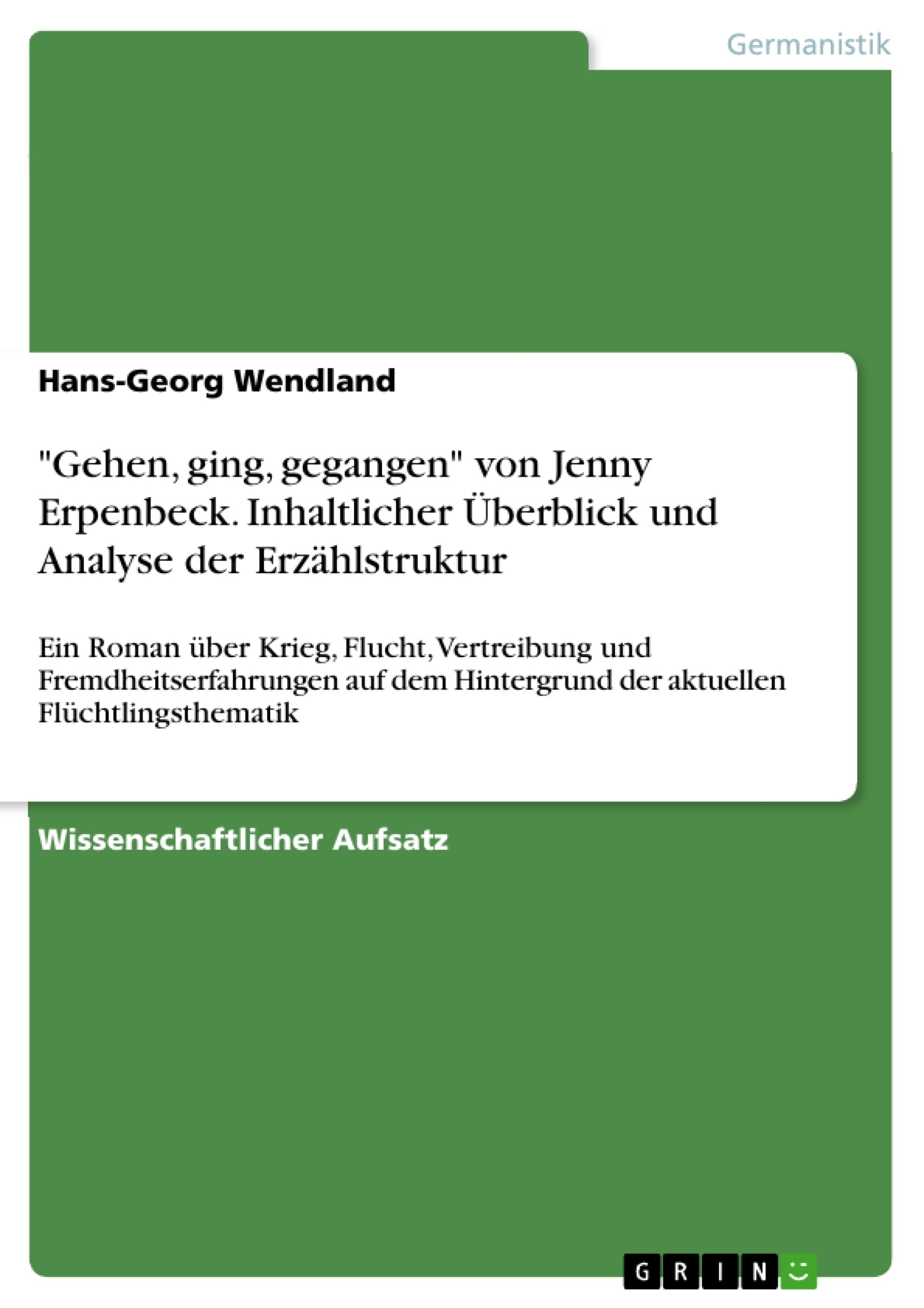Erpenbecks Roman reiht sich in eine jahrhundertelange Tradition der literarischen Darstellung von Kriegs- und Fluchterlebnissen ein. Als pensionierter Altphilologe hat Richard, die zentrale Figur, ein besonderes Interesse daran, in Vergangenem und Gegenwärtigem Gemeinsamkeiten zu entdecken. Außerdem sucht er neue Betätigungsfelder. Die Suche führt ihn schließlich zu den afrikanischen Flüchtlingen, die sich auf dem Alexanderplatz in Berlin versammelt haben, um anonym gegen ihre Abschiebung zu protestieren. In Homers "Odyssee" glaubt er einen Schlüssel für das Verhalten dieser Männer gefunden zu haben.
Man kann Richard als literarische Doppelfigur auffassen: halb sinnsuchendes Individuum, halb Symbolfigur, die versucht, zwischen verschiedenen Welten eine Brücke zu schlagen. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Flüchtlingen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Richard nimmt Kontakt zu ihnen auf und befragt sie nach ihren Erlebnissen. Stellvertretend für viele andere werden in diesem Teil "Apoll" aus Niger, "Tristan" aus Ghana und der "Blitzeschleuderer" aus Nigeria vorgestellt. Richard unterstützt seine Schützlinge tatkräftig, kann aber nicht verhindern, dass eine ganze Reihe von ihnen abgeschoben werden.
Der Text enthält sich gegenseitig durchdringende auktoriale und personale Erzählanteile. Durchgehend wird das Präsens (Präsens historicum) verwendet. Viele Passagen werden aus der Sicht Richards erzählt. Sie stehen zumTeil in der erlebten Rede und erinnern an die Erzähltechnik eines "Bewusstseinsromans". Der Roman bietet keine geschlossene, kontinuierliche Gesamthandlung, sondern besteht aus miteinander verflochtenen Einzelhandlungen oder Handlungssträngen, die in Richard gespiegelt und durch collage- oder montageartig eingeschobene Zwischenteile angereichert werden. Die jungen Afrikaner berichten als Ich-Erzähler ihre bisherigen Lebens- und Fluchtgeschichten, wobei Richard versucht, gedankliche Verbindungslinien zwischen ihrer einstigen und der neuen Umgebung bzw. ihrer und seiner eigenen Gegenwart und Vergangenheit zu ziehen. Im Unterschied zum rein fiktionalen Erzählen wird das Faktische und Dokumentarische besonders hervorgehoben. Außerdem enthält der Text eine große Bandbreite von Gebrauchstexten wie Namenlisten, Einkaufslisten, Preisangaben, Notizen, Internettexte, Lexikoneintragungen usw., die den dokumentarischen Charakter unterstreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Krieg, Flucht, Vertreibung und Fremdheit als menschliche Grunderfahrungen
- Das Interesse am Vergangenen im Verhältnis zum Gegenwärtigen
- Inhaltlicher Überblick
- "Apoll" aus Niger.
- "Tristan" (Awad) aus Ghana...
- Der "Blitzeschleuderer" (Raschid) aus Nigeria...
- Aufbau und Erzählstruktur
- Die Erzählsituation: auktoriale und personale Erzählweise
- Beispiel einer auktorialen Erzählsituation: Protestaktion vor dem Roten Rathaus..
- Personale Erzählsituation: die zentrale Romanfigur wird in erlebter Rede vorgestellt
- Schlüsselbegriffe "Zeit", "Denken" und "Warten"
- Hinwendung zum zielgerichteten Denken und Handeln..
- Statt geschlossener Gesamthandlung Geflecht von Einzelhandlungen.
- Binnentexte: die afrikanischen Flüchtlinge als Ich-Erzähler
- Verknüpfung von Mythologie und erlebter Gegenwart .....
- Faktuales und fiktionales Erzählen...........
- Reportagestil und literarisches Erzählen
- Akribische Auflistungen.
- Die Überwindung von Vorurteilen
- Unterschiedliche Textsorten: Beispiel Gebrauchstexte
- Zitate und intertextuelle Bezüge.
- Sprache als Zeichensystem
- Denken in dialektischen Gegensatzpaaren..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Roman "Gehen, ging, gegangen" von Jenny Erpenbeck beleuchtet das Thema Krieg, Flucht, Vertreibung und Fremdheit im Kontext der aktuellen Flüchtlingsthematik. Die Autorin setzt sich mit den Erfahrungen von Flüchtlingen auseinander und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Flucht- und Vertreibungserfahrungen in der Vergangenheit und Gegenwart auf. Darüber hinaus erforscht sie die Rolle der Sprache und des Denkens in der Begegnung mit Fremdheit und die Möglichkeit, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen.
- Die vielfältigen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung
- Die Bedeutung von Sprache und Denken im Umgang mit Fremdheit
- Die Herausforderungen der Integration und die Überwindung von Vorurteilen
- Die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart
- Die Darstellung von Fluchtgeschichten und deren literarische Verarbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Romans und die Intentionen der Autorin. Erpenbeck betont, dass sie sich bereits lange mit der Thematik Flucht auseinandersetzt und diese auch in ihrer eigenen Familiengeschichte eine wichtige Rolle spielt. Im Mittelpunkt des Romans steht die Figur Richards, ein pensionierter Altphilologe, der nach dem Mauerfall in Berlin eine neue Form der Fremdheit erfährt. Diese Erfahrung verbindet ihn mit den Flüchtlingen, die er auf dem Alexanderplatz kennenlernt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Richards Interesse am Vergangenen und seiner Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Er sieht in Homers "Odyssee" einen Schlüssel für das Verständnis des Verhaltens der Flüchtlinge. Der Roman nimmt Bezug auf die jahrhundertelange Tradition der literarischen Darstellung von Kriegs- und Fluchterlebnissen.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die zentralen Figuren des Romans, darunter "Apoll" aus Niger, "Tristan" aus Ghana und der "Blitzeschleuderer" aus Nigeria. Richard unterstützt diese Flüchtlinge, kann aber nicht verhindern, dass einige von ihnen abgeschoben werden. Der Roman präsentiert eine vielfältige Gruppe von Flüchtlingen, die aus verschiedenen Ländern stammen und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben.
Das vierte Kapitel behandelt die Erzählstruktur des Romans, die sich aus auktorialen und personalen Erzählanteilen zusammensetzt. Richard steht im Mittelpunkt des Geschehens, aber die Geschichte wird auch aus der Perspektive der Flüchtlinge erzählt. Die Verwendung des Präsens (Präsens historicum) und der Collage-artige Aufbau des Textes tragen zum dokumentarischen Charakter des Romans bei.
Schlüsselwörter
Der Roman "Gehen, ging, gegangen" von Jenny Erpenbeck beschäftigt sich mit den Themen Flucht, Vertreibung, Fremdheit, Integration, Sprache, Denken, Geschichte, Gegenwart, Literatur, Mythologie und interkulturelle Begegnung. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Krieg, Flucht, Vertreibung, Fremdheit, Integration, Sprache, Denken, Geschichte, Gegenwart und Mythologie. Die Autorin betrachtet diese Themen aus verschiedenen Perspektiven und zeigt die komplexen Herausforderungen, die mit dem Umgang mit Flucht und Fremdheit verbunden sind. Der Roman bietet einen vielschichtigen Einblick in die verschiedenen Facetten dieser Themen und hinterfragt die Möglichkeiten der menschlichen Verständigung.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2016, "Gehen, ging, gegangen" von Jenny Erpenbeck. Inhaltlicher Überblick und Analyse der Erzählstruktur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313889