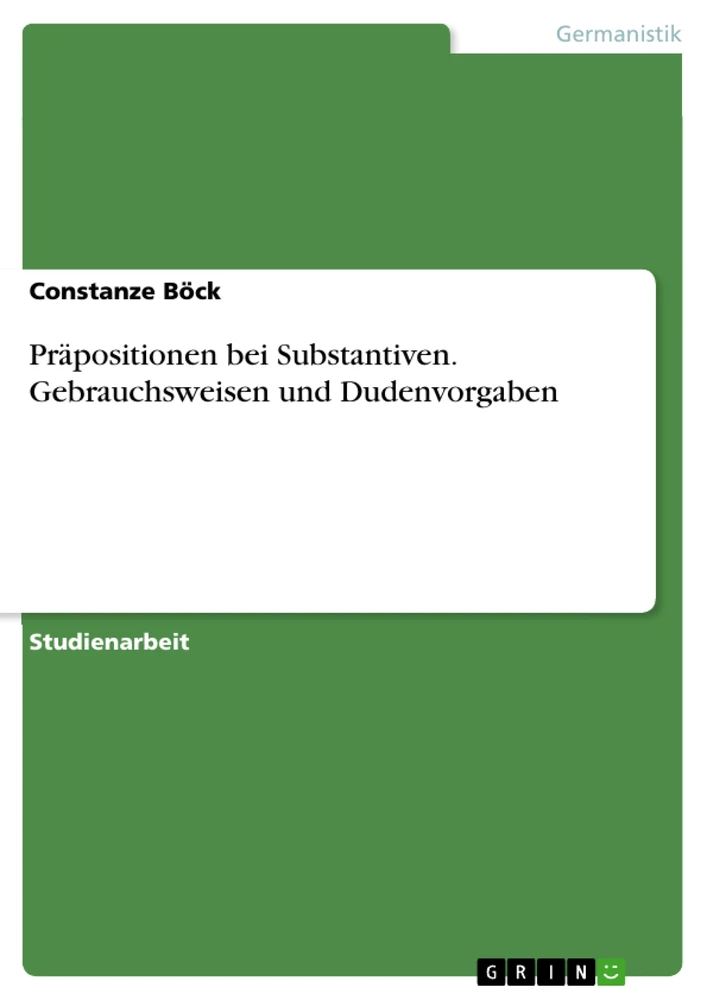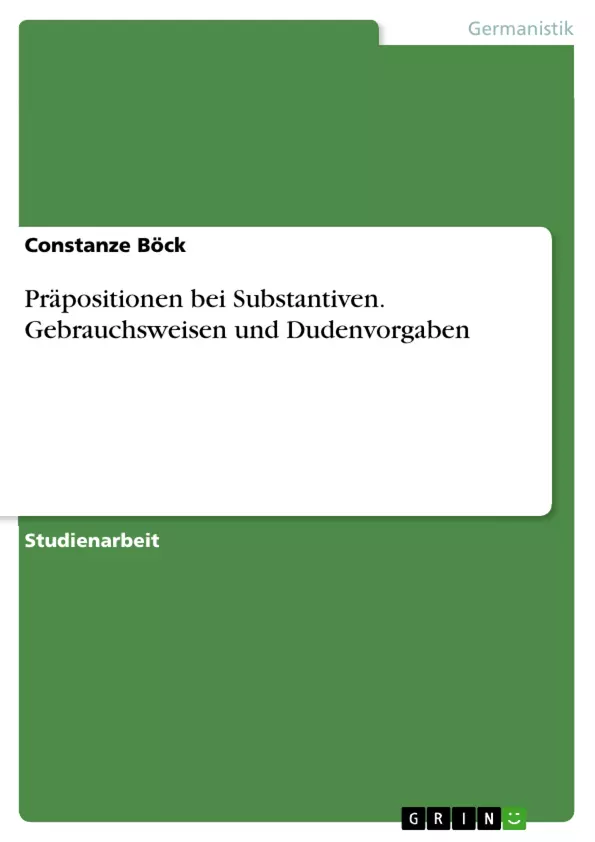Diese Arbeit behandelt die Frage, welche Präpositionen man im welchen Zusammenhang benutzt in Abhängigkeit von der ursprünglichen, dialektalen Herkunft.
Der Ausdruck „Präposition“ bedeutet, gemäß seines lateinischen Ursprungs, das „Vorangestellte“ und steht im Zusammenhang mit der Wortstellung. In den meisten Fällen stehen Präpositionen vor ihrem Bezugswort, jedoch gibt es einige Ausnahmen in Form von Postpositionen (nachgestellt) und Zirkumpositionen (rahmen das Wort ein). Die deutsche Bezeichnung der Präposition ist Verhältniswort, da mithilfe dieser das Verhältnis zwischen zwei Größen aufgezeigt werden kann.
Da Präpositionen in fast jedem Satz vorkommen, kann man sie in vier große semantische Gruppen einteilen, sodass das Verhältnis temporal, kausal, modal oder neutral sein kann. Präpositionen können als unflektierbare Ausdrücke bezeichnet werden, die Gegenstände in eine spezifische inhaltliche Beziehung zueinander setzen. Beispielsweise in lokaler (die Katze ist „auf“ dem heißen Blechdach), kausaler (zitternd „vor“ Angst) oder temporaler (Tod „um“ Mitternacht) Weise. Dennoch hat deren Bedeutung einen starken Kontextbezug. Nach Engel sind „Präpositionen Partikel, die jederzeit eine Nominalphrase in spezifischem Kasus regieren können.“
Anhand ihrer unterschiedlichen Komplexität lassen sich Präposition in einfache (primäre), komplexe (sekundäre) Präpositionen sowie präpositionsartige Wortverbindungen (tertiäre Präpositionen) unterscheiden. Einfache Präpositionen sind beispielsweise: in, auf, mit, nach, um, vor, hinter, statt. Komplexe Präpositionen sind: mithilfe, zufolge, anhand, anstelle, anstatt, aufgrund. Präpositionsartige Wortverbindungen wie im Verlauf(e) (von), in Bezug auf, in Anbetracht, im Gefolge oder an Stelle, beinhalten bereits eine Präposition.
Präpositionen zeigen zudem unterschiedliche Verhältnisse auf, sodass man je nach Verhältnis verschiedene Präpositionen auch mehrfach gebrauchen kann. Hier sind besonders die lokalen Präpositionen von Bedeutung, da sie genaue räumliche Dimensionen wie Lage, Richtung, Nähe, Parallelität, Gegenseite oder den Bezug auf einen Punkt aufzeigen. Ihre Benutzung kann Antworten auf die Fragen Wo, Wohin und Woher geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theoretische Heranführung an das Thema
- 2. Methode
- 3. Ergebnisanalyse
- 3.1 Institutionen
- 3.2 Supermärkte
- 3.3 Ausgewählte Bezugsworte
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung von Präpositionen bei Substantiven, insbesondere Lokalpräpositionen. Die Arbeit analysiert die Variationen im Sprachgebrauch und versucht, regionale und individuelle Unterschiede aufzuzeigen. Die Ergebnisse basieren auf einer empirischen Befragung.
- Untersuchung der Verwendung von Lokalpräpositionen bei Substantiven
- Analyse regionaler und individueller Unterschiede im Sprachgebrauch
- Vergleich der Befragungsergebnisse mit den Vorgaben des Dudens
- Auswertung der Präpositionswahl bei Institutionen, Supermärkten und ausgewählten Bezugswörtern
- Identifizierung von Tendenzen in der Präpositionsverwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theoretische Heranführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Präpositionen ein. Es erklärt den Begriff „Präposition“, seine semantischen Gruppen und die unterschiedlichen Arten von Präpositionen (einfach, komplex, präpositionsartig). Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Präpositionen im Kontext und ihrer Fähigkeit, Beziehungen zwischen Wörtern herzustellen, insbesondere im Hinblick auf lokale Beziehungen (Lage, Richtung, Nähe etc.). Der Bezug auf verschiedene linguistische Quellen und deren Interpretationen wird hergestellt, um ein fundiertes Verständnis des Themas zu schaffen.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Untersuchung. Es wird erläutert, warum die Wahl der Präpositionen oft intuitiv und von regionalen und individuellen Faktoren beeinflusst ist. Die Methode der empirischen Befragung mittels Fragebogen wird detailliert dargestellt. Der Zweck dieser Befragung ist die Erhebung von Daten zur Präpositionsverwendung bei verschiedenen Substantiven, um regionale und individuelle Unterschiede im Sprachgebrauch aufzudecken und Tendenzen in der Verwendung von Lokalpräpositionen zu identifizieren.
3. Ergebnisanalyse: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der durchgeführten Befragung. Zunächst wird der Vergleich der Ergebnisse mit den Vorgaben des Dudens vorgenommen. Die Analyse gliedert sich in drei Unterabschnitte: Institutionen, Supermärkte und ausgewählte Bezugsworte. Für jeden Abschnitt werden die Ergebnisse der Befragung detailliert dargestellt und mit den Erwartungen, die sich aus den Vorgaben des Dudens ergeben, verglichen. Regionale Unterschiede in der Präpositionsverwendung werden aufgezeigt und mögliche Erklärungen hierfür diskutiert. Die Auswertung umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, um ein umfassendes Bild der Ergebnisse zu liefern.
Schlüsselwörter
Präpositionen, Lokalpräpositionen, Sprachgebrauch, regionale Unterschiede, individuelle Varianz, Duden-Grammatik, empirische Befragung, Institutionen, Supermärkte, Bezugsworte, Wortwahl, Varietäten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Präpositionsgebrauch bei Substantiven
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Gebrauch von Präpositionen, insbesondere Lokalpräpositionen, bei Substantiven. Der Fokus liegt auf der Analyse regionaler und individueller Unterschiede im Sprachgebrauch und dem Vergleich der Ergebnisse mit den Vorgaben des Dudens.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Befragung mittels Fragebogen. Diese Methode erlaubt die Erhebung von Daten zur Präpositionsverwendung bei verschiedenen Substantiven, um regionale und individuelle Unterschiede aufzudecken und Tendenzen zu identifizieren.
Welche Aspekte werden in der Ergebnisanalyse betrachtet?
Die Ergebnisanalyse gliedert sich in drei Teile: Institutionen, Supermärkte und ausgewählte Bezugsworte. Die Ergebnisse der Befragung werden detailliert dargestellt und mit den Vorgaben des Dudens verglichen. Regionale Unterschiede werden aufgezeigt und mögliche Erklärungen diskutiert. Die Auswertung umfasst quantitative und qualitative Aspekte.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Präpositionen ein, erklärt den Begriff, seine semantischen Gruppen und verschiedene Präpositionstypen. Es konzentriert sich auf die Bedeutung von Präpositionen im Kontext und deren Fähigkeit, Beziehungen zwischen Wörtern herzustellen, besonders im Hinblick auf lokale Beziehungen. Verschiedene linguistische Quellen werden herangezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Präpositionen, Lokalpräpositionen, Sprachgebrauch, regionale Unterschiede, individuelle Varianz, Duden-Grammatik, empirische Befragung, Institutionen, Supermärkte, Bezugsworte, Wortwahl, Varietäten.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Ergebnisanalyse und abschließend Schlüsselwörter. Die einzelnen Kapitel behandeln die theoretische Heranführung, die Methode, die Ergebnisanalyse und ein Fazit.
Welche konkreten Substantive wurden untersucht?
Die Analyse betrachtet die Präpositionsverwendung bei Substantiven in drei Kategorien: Institutionen, Supermärkte und ausgewählte Bezugsworte. Die spezifischen Bezugsworte werden im Haupttext der Arbeit detailliert erläutert.
Wie werden regionale Unterschiede im Sprachgebrauch berücksichtigt?
Die empirische Befragung ermöglicht die Identifizierung und Analyse regionaler Unterschiede in der Präpositionsverwendung. Diese Unterschiede werden in der Ergebnisanalyse detailliert dargestellt und diskutiert.
Wie wird der Duden in der Arbeit verwendet?
Die Ergebnisse der Befragung werden mit den Vorgaben des Dudens verglichen, um Abweichungen und Übereinstimmungen im Sprachgebrauch aufzuzeigen und zu interpretieren.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten und müsste aus dem vollständigen Dokument entnommen werden.)
- Quote paper
- Constanze Böck (Author), 2014, Präpositionen bei Substantiven. Gebrauchsweisen und Dudenvorgaben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313467