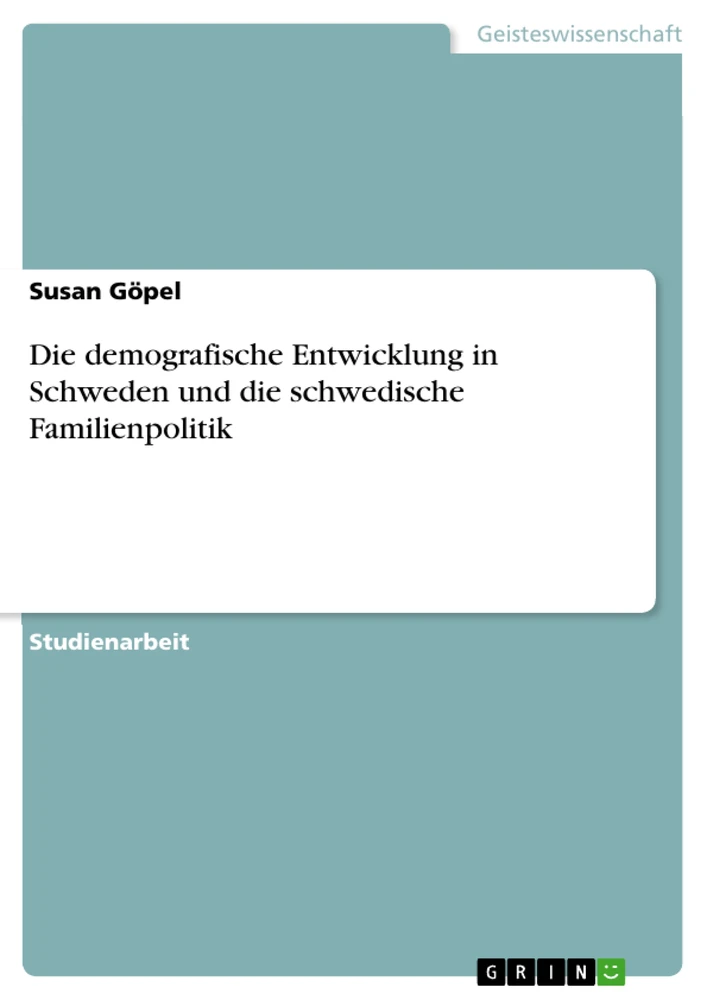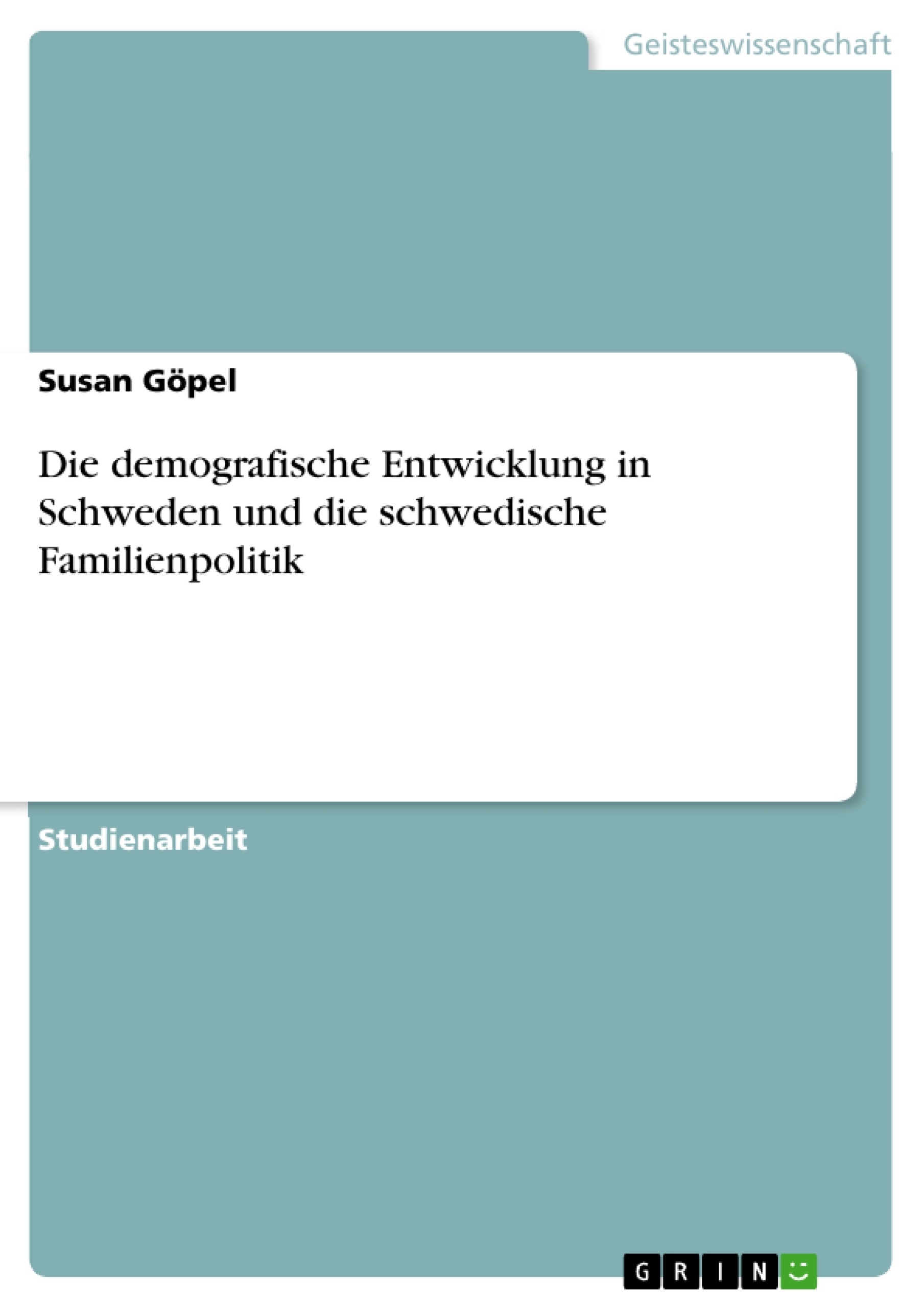Ziel der Arbeit ist es, die demografische Entwicklung im EU-Land Schweden und seine Gegenmaßnahmen darzustellen. Die Verfasserin beschreibt in ersten Teil der vorliegenden Arbeit die politische und gesellschaftliche Struktur Schwedens. Im weiteren Verlauf werden die derzeitige Situation der Bevölkerungsstruktur und die demografische Entwicklung seit den 30er Jahren dargelegt. Im zweiten Teil der Hausarbeit steht die zentrale Frage im Fokus, wie Schweden mit der Entwicklung umgeht. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die familienpolitischen Lösungen und das flexible Rentensystem. Im dritten Teil werden Parallelen zu Deutschland gezogen und die Pläne der Bundesregierung gegen die Trendentwicklung erläutert.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich die Bevölkerungsstruktur nicht nur in Deutschland stark verändern. Bevölkerungsrückgang, Alterung, Vereinzelung und Internationalisierung kennzeichnen die zukünftige demografische Entwicklung in Europa. Jeder dieser vier Trends stellt unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen, deren Dimensionen eng miteinander in Beziehung stehen. Der demografische Wandel ist kein Problem der Gegenwart, seit vielen Jahrzehnten sind seine Entwicklungen und Auswirkungen erkennbar. Er stellt eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und jeden Einzelnen unserer Gesellschaft dar. Umso wichtiger ist es, diese Herausforderung anzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schweden im Kurzporträt
- Land und Leute
- Politik und Wirtschaft
- Stärken und Schwächen des Wohlfahrtstaates
- Der demografische Wandel in Schweden
- Begriffserklärung
- Die schwedische Bevölkerung
- Die demografische Entwicklung seit 1930
- Wie geht Schweden mit den Veränderungen um?
- Familienpolitik - Schwedens Anreiz auf Familie
- Das Doppelverdiener-Modell – erhöhte Erwerbstätigkeit bei Frauen
- Kinderbetreuung in Schweden
- Flexibles Renteneintrittsalter
- Familienpolitik - Schwedens Anreiz auf Familie
- Exkurs: Situation in Deutschland
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die demografische Entwicklung in Schweden und die Maßnahmen des Landes, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen. Der Fokus liegt auf der Analyse der schwedischen Familienpolitik und des flexiblen Rentensystems als zentrale Strategien zur Bewältigung von Bevölkerungsrückgang und Alterung.
- Demografischer Wandel in Schweden
- Schwedische Familienpolitik
- Flexibles Rentensystem in Schweden
- Vergleich mit der Situation in Deutschland
- Stärken und Schwächen des schwedischen Wohlfahrtsstaates
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel in Europa und hebt die Bedeutung der Analyse der schwedischen Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen hervor. Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung der demografischen Entwicklung Schwedens, der politischen und gesellschaftlichen Strukturen sowie der Gegenmaßnahmen des Landes, insbesondere der Familienpolitik und des flexiblen Rentensystems. Ein Vergleich mit der Situation in Deutschland wird ebenfalls in Aussicht gestellt.
Schweden im Kurzporträt: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über Schweden, einschließlich seiner demografischen Zusammensetzung, politischen Systeme (parlamentarische Demokratie) und wirtschaftlichen Entwicklung (von einem der ärmsten zu einem der reichsten Länder Europas). Es beleuchtet auch die Stärken und Schwächen des schwedischen Wohlfahrtsstaates, der als Vorbild für viele EU-Länder gilt, aber auch eine hohe wirtschaftliche Belastung darstellt. Die Rolle des Wohlfahrtsstaates in der Veränderung der Stellung der Frau in der Gesellschaft und die positiven Auswirkungen auf Familien, besonders solche mit Migrationshintergrund, werden hervorgehoben.
Der demografische Wandel in Schweden: Dieses Kapitel beschreibt den demografischen Wandel in Schweden, im Gegensatz zum europäischen Trend. Es wird darauf eingegangen, dass die schwedische Bevölkerung im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern im Wachstum begriffen ist, besonders in den städtischen Zentren. Die positiven Auswirkungen der gut ausgebauten Sozialsysteme und Förderungsprogramme, inklusive Kinderbetreuung, auf die Geburtenrate und die Ansiedlung von jungen Menschen in den Städten werden erörtert.
Wie geht Schweden mit den Veränderungen um?: Dieses Kapitel analysiert die schwedischen Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels, insbesondere die Familienpolitik und das flexible Rentensystem. Die Familienpolitik, mit dem Fokus auf dem Doppelverdienermodell und der ausgebauten Kinderbetreuung, wird als ein entscheidender Faktor für die höhere Geburtenrate im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dargestellt. Das flexible Renteneintrittsalter wird als zusätzliche Maßnahme zur Anpassung an die alternde Bevölkerung genannt.
Exkurs: Situation in Deutschland: Dieses Kapitel zieht Parallelen zwischen der demografischen Entwicklung und den politischen Reaktionen in Schweden und Deutschland. Es dient als Vergleich der Strategien beider Länder im Umgang mit dem demografischen Wandel.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Schweden, Familienpolitik, flexibles Rentensystem, Wohlfahrtsstaat, Bevölkerungsentwicklung, Doppelverdienermodell, Kinderbetreuung, Deutschland, EU.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Demografischer Wandel in Schweden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die demografische Entwicklung in Schweden und untersucht die Strategien des Landes zur Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels. Der Fokus liegt dabei auf der schwedischen Familienpolitik und dem flexiblen Rentensystem.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den demografischen Wandel in Schweden, die schwedische Familienpolitik (inkl. Doppelverdienermodell und Kinderbetreuung), das flexible Rentensystem, einen Vergleich mit der Situation in Deutschland und die Stärken und Schwächen des schwedischen Wohlfahrtsstaates.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kurzporträt Schwedens, ein Kapitel zum demografischen Wandel in Schweden, ein Kapitel zu den schwedischen Strategien zur Bewältigung des Wandels (Familienpolitik und flexibles Rentensystem), einen Exkurs zur Situation in Deutschland und eine Zusammenfassung. Es enthält auch ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse zum demografischen Wandel in Schweden?
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern wächst die schwedische Bevölkerung, besonders in den Städten. Die gut ausgebauten Sozialsysteme und Förderungsprogramme, inklusive der Kinderbetreuung, haben positive Auswirkungen auf die Geburtenrate und die Ansiedlung junger Menschen.
Welche Rolle spielt die Familienpolitik in Schwedens Umgang mit dem demografischen Wandel?
Die schwedische Familienpolitik, insbesondere das Doppelverdienermodell und die ausgebaute Kinderbetreuung, wird als entscheidender Faktor für die höhere Geburtenrate im Vergleich zu anderen europäischen Ländern angesehen.
Welche Bedeutung hat das flexible Rentensystem?
Das flexible Renteneintrittsalter ist eine zusätzliche Maßnahme zur Anpassung an die alternde Bevölkerung.
Wie wird die Situation in Deutschland in die Analyse einbezogen?
Ein Exkurs vergleicht die demografische Entwicklung und die politischen Reaktionen in Schweden und Deutschland, um die Strategien beider Länder im Umgang mit dem demografischen Wandel zu kontrastieren.
Welche Stärken und Schwächen des schwedischen Wohlfahrtsstaates werden beleuchtet?
Die Arbeit hebt die positive Rolle des Wohlfahrtsstaates für die Stellung der Frau in der Gesellschaft und für Familien, besonders solche mit Migrationshintergrund, hervor. Gleichzeitig wird auch die hohe wirtschaftliche Belastung durch den Wohlfahrtsstaat angesprochen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Demografischer Wandel, Schweden, Familienpolitik, flexibles Rentensystem, Wohlfahrtsstaat, Bevölkerungsentwicklung, Doppelverdienermodell, Kinderbetreuung, Deutschland, EU.
- Quote paper
- Susan Göpel (Author), 2013, Die demografische Entwicklung in Schweden und die schwedische Familienpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313237