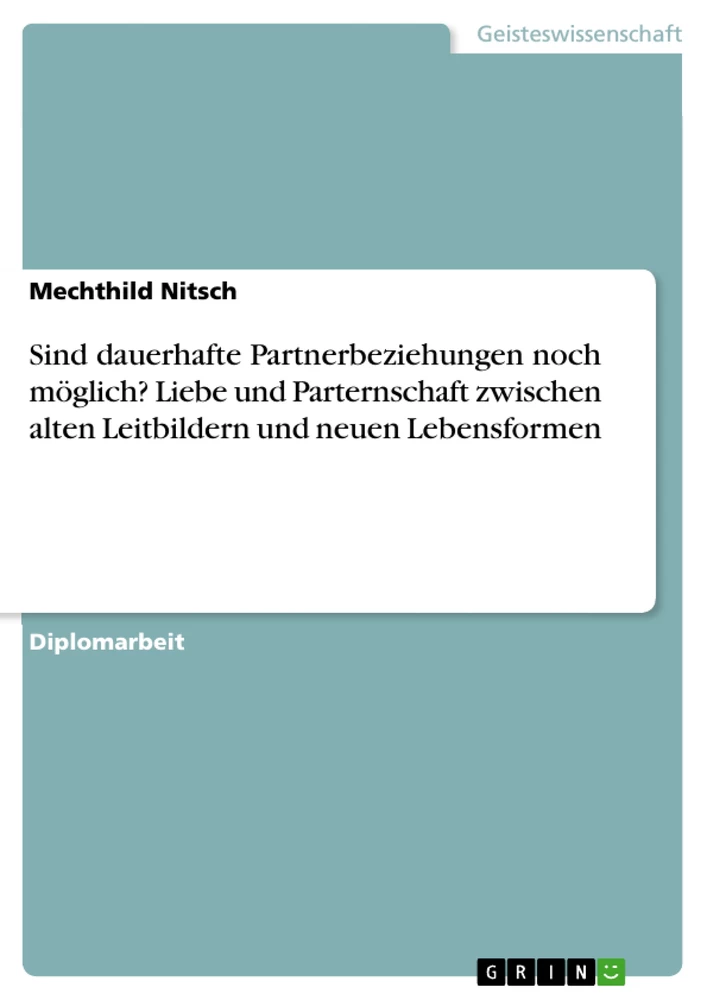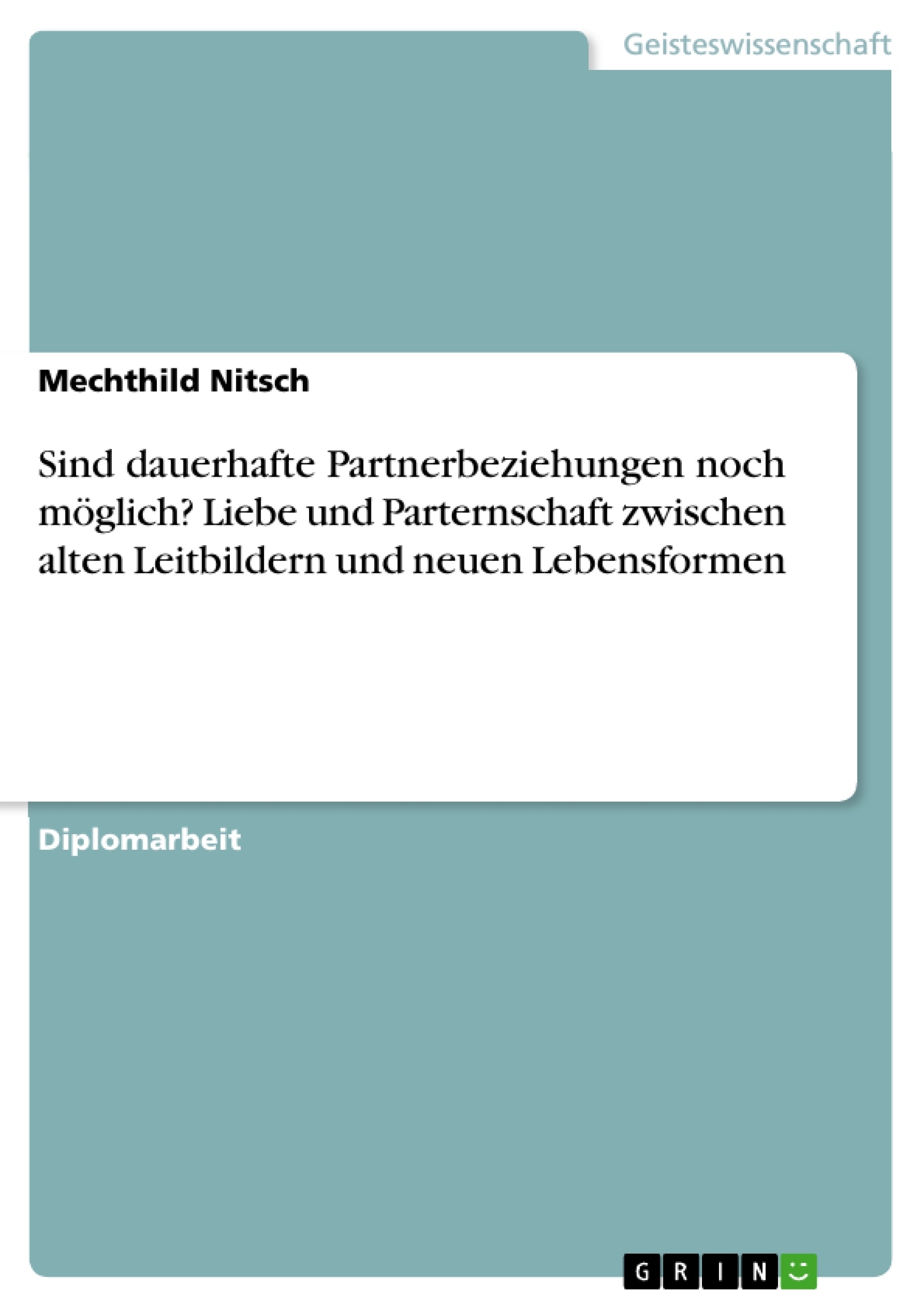In den ersten beiden Jahrzehnten der Nachkriegsjahre galt für die Beziehung von Mann und Frau ein Leitbild, welches von der gesamten westdeutschen Bevölkerung mitgetragen, bejaht und gelebt wurde. Ein Leitbild, welches jedem Mann und jeder Frau die eigene Lebensbiographie vorzeichnete, nämlich:
„…die legale, lebenslange, monogame Ehe zwischen Mann und Frau, die mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und in der der Mann der Haupternährer und Autoritätsperson und die Frau primär für den Haushalt und die Erziehung der Kinder zuständig ist.“
Entwickelt wurde dieses Leitbild bereits im 19. Jh. vom damaligen Bürgertum in Abgrenzung zu den Gepflogenheiten des Adels und in Abgrenzung zum „Pöbel“. Verknüpft wurde das Leitbild im Bürgertum mit dem Ideal der romantischen Liebe.
Infolge des zweiten Weltkrieges waren viele Familien durch Tod, Vertreibung und Gefangenschaft auseinander gerissen. Viele hatten Hunger, Not- und Angstsituationen erlebt. So lag nach dem Krieg auf der Familie die Hoffnung vieler, neue Sicherheiten zu erlangen, Lebenswertes neu zu erleben und in der Familie Geborgenheit erfahren zu dürfen (vgl. Nave-Herz 1988, S.65). Im Zuge des Wiederaufbaus waren die Familien dementsprechend auch die Basis für den Neubeginn, und die herrschende gesellschaftliche Struktur war (ist) angewiesen auf das „Humanvermögen“, welches die Familien produzier(t)en.
Mit zunehmendem Wohlstand war die Familie als „Bewahrerin der Traditionen“ gedacht, ein Schonraum des Privaten, in dem sowohl die Regeneration der Berufstätigen (Männer) stattfinden konnte, als auch die Erziehung und Sozialisation der Kinder. Nachdem die Schrecken der Kriegsjahre überwunden waren und Wohlstand und Sicherheit ins Bewusstsein des Volkes einzog, vollzog sich Mitte der 60er Jahre eine Art „Kulturelle Revolution“, die auch vor den alten Leitbildern von Ehe und Familie nicht Halt machte. So sind Ehe und Familie nicht mehr per se aneinander gekoppelt und für Partnerschaft braucht man nicht mehr zwingend die Ehe. Die Art der Aufgabenverteilung obliegt der Vereinbarung der Partner und die Scheidungszahlen zeigen, dass die Ehe nicht mehr eine Paarbeziehung von Dauer sein muss.
Peukert, Rüdiger: Familienformen im Wandel. 4.Aufl. Opladen, 2002, S.29.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problembeschreibung
- Zielsetzung und Definitionen
- Zur Schwierigkeit der begrifflichen Abgrenzung von Partnerschaft und Familie
- Orientierung an der Individualisierungsthese
- Wegbeschreibung und Begründungen
- Kulturgeschichtlicher Hintergrund
- Von der Stände- zur Klassengesellschaft
- Eheschließungsmotive vor der Industrialisierung
- Die Entwicklung eines neuen Familien- und Ehemodells am Beispiel des Bürgertums
- Die,,Erfindung\" der Liebe als Motiv für die Eheschließung
- Anspruch und Wirklichkeit von Liebe und Ehe im 19.Jh.
- Liebe, Ehe und Kirche
- Ehe und Liebe in den Nachkriegsjahren bis 1960
- Das Leitbild wird brüchig....
- Zusammenfassung:
- Merkmale und Kennzeichen des Wandels von Ehe/Partnerschaften
- Sinkende Heiratsneigung
- Zunahme der Ehescheidungen
- Zunahme Neuer Lebensformen
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- Die kinderlose Ehe
- Die kindorientierte Ehegründung
- Weitere Formen der Partnerschaft
- Individualisierung und Pluralisierung
- Ursachen des Wandels
- Der Wertewandel
- Entstehung des Wertewandels
- Kennzeichen der Wertewandels
- Wesen und Inhalt des Wertewandels
- Wertewandel und Bindungen
- Folgen des Wertewandels
- Geschlechterrollenwandel
- Frauen und ihre Rolle
- Männer und ihre Rolle
- Ein erstes Resümee
- Liebes- und Paarbilder zwischen alten Leitbildern und neuen Idealen
- Liebe zwischen Markt und Paarbeziehung
- Liebesbeziehungen- Paarbeziehungen
- Entwürfe neuer Lebensformen
- ,,Versachlichung der Welt\".
- Sinn- und Identitätssuche als (neuer) Wert von Ehe/Partnerschaft
- Das romantische Liebesideal im 21.Jahrhundert
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- Definition und Ausbreitung
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften – eine Konkurrenz zur Ehe?
- Charakteristika der nichtehelichen Lebensgemeinschaften
- Probleme der nichtehelichen Lebensgemeinschaften
- Fortsetzungsehen
- Faktoren für und gegen die Wiederverheiratung
- Chancen und Risiken
- Commuter-Ehe
- Begriff und Merkmale der Commuter-Ehe
- Probleme in Commuter-Ehen
- Chancen der Commuter-Ehe
- Commuter-Ehe - eine Lösung zur Anpassung an den Wandel?
- Ein zweites Resümee....
- Zur Frage der Instabilität bzw. der Stabilität von Ehe-Partnerschaften
- Bedingungen, die die Scheidungswahrscheinlichkeit erhöhen
- Die „Scheidungsspirale”
- Die Scheidungstransmission“
- Soziodemographische Bedingungen der Scheidungswahrscheinlichkeit
- Bedingungen für gelingende Partnerschaften
- Definition des Begriffs „Lebensthema”
- Wirkungen von Homogenität und Heterogenität der Lebensthemen in Paarbeziehungen
- Paare und gleiche Lebensthemen
- Sich ergänzende Lebensthemen
- Differierende Lebensthemen
- Kommunikation als Stabilitätsfaktor für Paarbeziehungen
- Grundlagen der Kommunikation
- Bedeutsamkeit von Kommunikation in Partnerschaften
- Konstruktive Kommunikation als Möglichkeit zur Lösung von Konflikten in Paarbeziehungen
- Wir können einander nicht verstehen“
- Wandel von Ehe und Partnerschaft
- Individualisierung und Pluralisierung
- Neue Lebensformen und ihre Auswirkungen auf Paarbeziehungen
- Liebes- und Paarbilder im 21. Jahrhundert
- Faktoren für die Stabilität und Instabilität von Partnerschaften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob dauerhafte Partnerbeziehungen in der heutigen Gesellschaft noch möglich sind. Die Arbeit analysiert den Wandel von Ehe und Partnerschaft im Kontext der Individualisierung und der Entstehung neuer Lebensformen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Gestaltung von Liebes- und Paarbeziehungen auswirken.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Problematik des Wandels von Ehe und Partnerschaft. Es wird die Bedeutung des Leitbilds von Ehe und Familie im 20. Jahrhundert sowie die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft in Bezug auf die Gestaltung von Paarbeziehungen dargestellt.
Das zweite Kapitel beleuchtet den kulturgeschichtlichen Hintergrund von Ehe und Partnerschaft und analysiert die Entwicklung des Familien- und Ehemodells vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit. Es werden verschiedene Eheschließungsmotive sowie die Bedeutung des romantischen Liebesideals in der Geschichte thematisiert.
Im dritten Kapitel werden die Merkmale und Kennzeichen des Wandels von Ehe und Partnerschaft dargestellt. Hierbei stehen sinkende Heiratsneigung, zunehmende Ehescheidungen und die Entstehung neuer Lebensformen im Fokus.
Kapitel vier befasst sich mit den Ursachen des Wandels von Ehe und Partnerschaft und untersucht den Wertewandel in der heutigen Gesellschaft.
Im fünften Kapitel werden die Folgen des Wertewandels für die Gestaltung von Paarbeziehungen und Geschlechterrollen beleuchtet.
Kapitel sechs beleuchtet die Liebes- und Paarbilder im 21. Jahrhundert im Kontext der Individualisierung und der Entstehung neuer Lebensformen. Es werden verschiedene Entwürfe neuer Lebensformen, wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, Fortsetzungsehen und Commuter-Ehen, analysiert.
Das siebte Kapitel widmet sich der Frage, ob dauerhafte Partnerschaften in der heutigen Gesellschaft noch möglich sind. Es werden verschiedene Faktoren, die die Stabilität von Paarbeziehungen beeinflussen, betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Ehe, Partnerschaft, Individualisierung, Wertewandel, neue Lebensformen, Liebes- und Paarbilder, Stabilität und Instabilität von Partnerschaften, sowie der Bedeutung der Kommunikation für gelingende Beziehungen.
- Quote paper
- Dipl. Sozialpädagogin Mechthild Nitsch (Author), 2003, Sind dauerhafte Partnerbeziehungen noch möglich? Liebe und Parternschaft zwischen alten Leitbildern und neuen Lebensformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31278