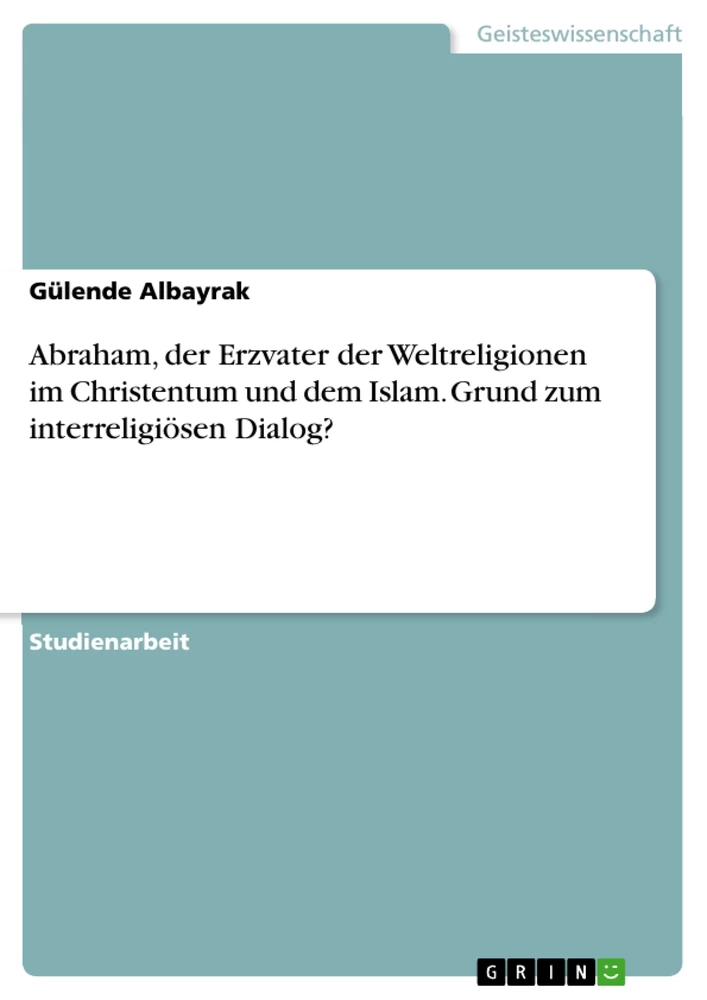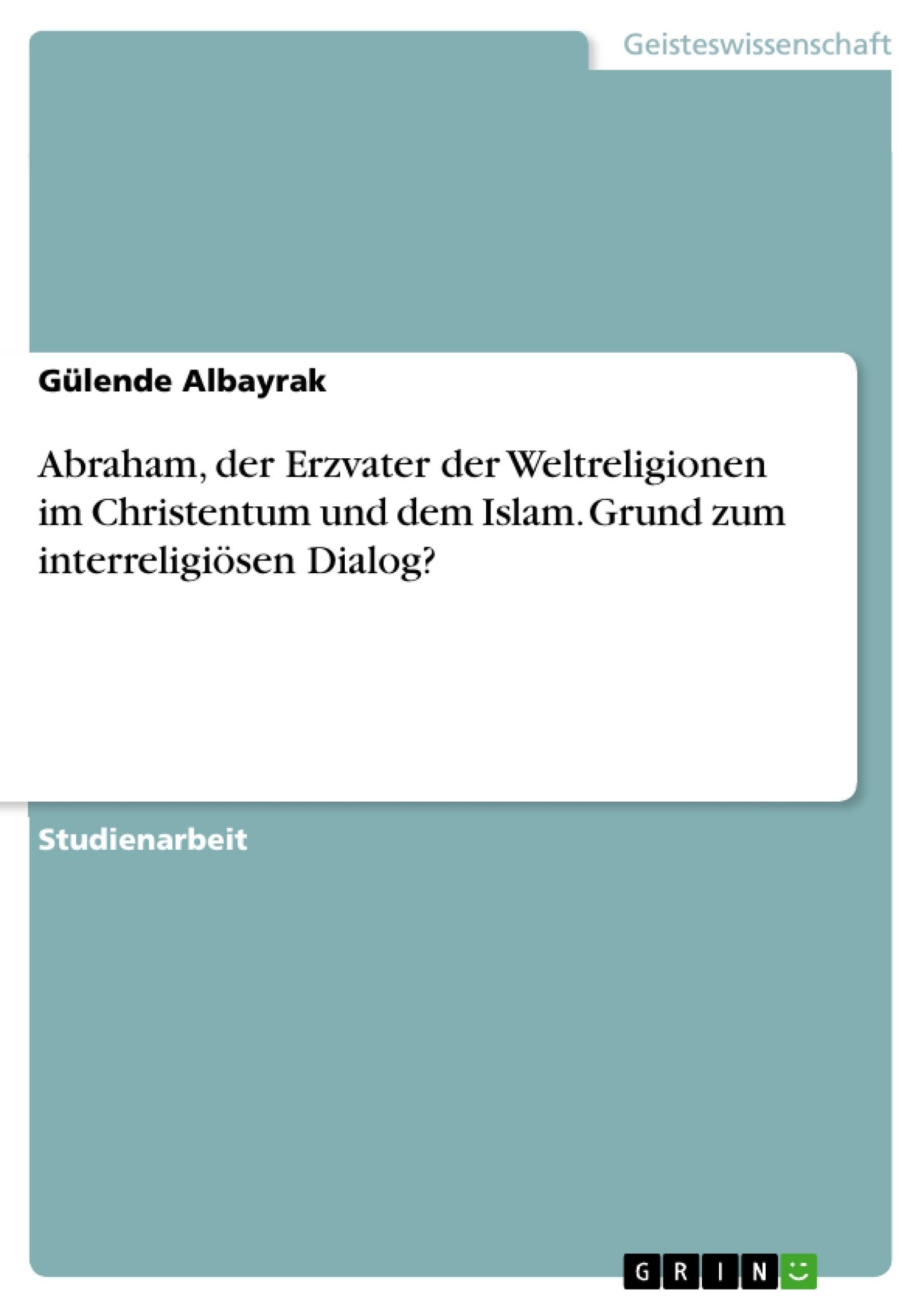Für den Frieden brauchen wir Dialog. Doch was ist überhaupt ein Dialog?
Dialog bezeichnet das Zusammenkommen von Menschen verschiedener Kulturen, Religionen, Herkunft und Geschlechter, um miteinander auf zivilisierte Weise zu kommunizieren.
Unsere Definition eines Dialogs ist die Förderung einer Kultur des Zusammenlebens auf der Basis der universellen menschlichen Werte auf einem bestimmten Weg. Der Dialog spielt eine prägende Rolle in der Gestaltung und Struktur einer friedlichen Welt. Er ist kein überflüssiger Versuch, sondern sollte eine Pflicht im interreligiösen Alltag sein.
Wir Menschen sollten weiterhin von Respekt und Vertrauen geprägte Beziehungen mit Angehörigen anderer Religionen aufbauen, um gegenseitiges Verständnis, Versöhnung und Zusammenarbeit für das Allgemeinwohl zu fördern. Deswegen sind wir dazu aufgerufen, mit anderen auf eine gemeinsame Vision und Praxis interreligiöse Beziehungen hinzuarbeiten.
Abraham gilt als Stammvater der drei großen Weltreligionen (Judentum, Christentum und Islam). Als abrahamitisch werden jene monotheistischen Religionen bezeichnet, die sich auf Abraham, den Stammvater der Juden, Christen und der Muslime berufen.
Abraham spielt eine Schlüsselrolle im interreligiösen Dialog, da er als Stammvater aller Offenbarungsreligionen betrachtet wird. Was Abraham auszeichnet und zu einem Vorbild des Glaubens für das Judentum, Christentum und Islam macht, sind sein bedingungsloses Gottvertrauen und seine Gehorsamkeit.
In dieser Arbeit werden zu Beginn zwei kurzen Inhaltsangaben diesbezüglich gemacht; erst der islamische Ibrahim und darauffolgend der Abraham im AT werden dargestellt. Darüber hinaus wird die Bedeutung Abrahams beleuchtet, in der jeweils zwei ausgewählte Stellen aus der Bibel und aus dem Koran verglichen werden: Diese sind einmal der Aufbruch bzw. die Berufung Abrahams und dann die Glaubensprüfung. Darauf basierend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert.
Die Arbeit wird mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Fazit abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der „islamische Ibrahim“
- 2.1 Kurze Inhaltsangabe
- 2.2 Markante Begebenheiten in der Erzählung vom „islamischen Ibrahim“ im Koran
- 2.2.1 Aufbruch Abraham
- 2.2.2 Abrahams Glaubensprüfung durch das Opfer des Sohnes
- 2.3 Die Bedeutung „des islamischen Ibrahim“ im Islam
- 3. Der „christliche Abraham“
- 3.1 Kurze Inhaltsangabe
- 3.2 Markante Begebenheiten in der Erzählung vom „christlichen Abraham“ in der Bibel
- 3.2.1 Aufbruch Abraham
- 3.2.2 Abrahams Glaubensprüfung durch das Opfer des Sohnes
- 3.3 Die Bedeutung des „christlichen Abraham“
- 4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des „islamischen Ibrahim“ und des „christlichen Abraham“
- 5. Fazit: Ansatzpunkte zum Dialog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung Abrahams im Islam und Christentum, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Erzählung und deren Bedeutung für den interreligiösen Dialog aufzuzeigen. Das Ziel ist es, durch den Vergleich der beiden Perspektiven einen Beitrag zum Verständnis und zur Förderung des interreligiösen Austauschs zu leisten.
- Darstellung Abrahams im Koran und in der Bibel
- Vergleich der Erzählungen von Abrahams Berufung und Glaubensprüfung
- Bedeutung Abrahams für den Islam und das Christentum
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Interpretation Abrahams
- Ansatzpunkte für den interreligiösen Dialog
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung des Dialogs für den Frieden und verweist auf koranische Verse, die die Unterschiedlichkeit der Menschen und die Notwendigkeit des gegenseitigen Kennenlernens hervorheben. Sie führt den Begriff des Dialogs ein und positioniert Abraham als zentrale Figur im interreligiösen Diskurs, dessen Glaube und Gehorsam als Vorbild dienen. Die Einleitung dient als Grundlage für die folgende vergleichende Analyse der Darstellung Abrahams im Islam und Christentum.
2. Der „islamische Ibrahim“: Dieses Kapitel bietet eine kurze Inhaltsangabe der islamischen Abraham-Erzählung, beleuchtet markante Begebenheiten wie Abrahams Aufbruch und die Glaubensprüfung durch das Opfer seines Sohnes, und analysiert die Bedeutung des „islamischen Ibrahim“ im Islam. Die Analyse konzentriert sich auf die koranischen Texte, um die spezifische Interpretation und Bedeutung der Ereignisse im islamischen Kontext darzustellen.
3. Der „christliche Abraham“: Analog zum vorherigen Kapitel, präsentiert dieses Kapitel eine kurze Inhaltsangabe der biblischen Erzählung von Abraham, untersucht markante Begebenheiten wie Abrahams Aufbruch und die Glaubensprüfung, und erörtert die Bedeutung des „christlichen Abraham“ im Christentum. Die Auslegung der biblischen Texte bildet den Schwerpunkt der Analyse und zeigt die spezifische christliche Perspektive.
4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des „islamischen Ibrahim“ und des „christlichen Abraham“: Dieses Kapitel dient der Gegenüberstellung der beiden vorangegangenen Kapitel. Es vergleicht die beiden Perspektiven auf Abraham und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Erzählung und deren theologischer Bedeutung. Hier wird die vergleichende Analyse der beiden Religionen besonders deutlich. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Interpretation des Glaubens und Gehorsams Abrahams werden systematisch gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Abraham, Ibrahim, Interreligiöser Dialog, Islam, Christentum, Koran, Bibel, Glaube, Gehorsam, Glaubensprüfung, Opfer, Berufung.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Abraham-Darstellung im Islam und Christentum
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit vergleicht die Darstellung Abrahams (Ibrahim) im Islam und Christentum. Sie analysiert die Erzählungen im Koran und in der Bibel, hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor und untersucht die Bedeutung Abrahams für beide Religionen. Der Fokus liegt auf der Förderung des interreligiösen Dialogs durch ein besseres Verständnis der jeweiligen Perspektiven.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung Abrahams in beiden Religionen, vergleicht seine Berufung und Glaubensprüfung (insbesondere das Opfer seines Sohnes), analysiert die Bedeutung Abrahams im Islam und Christentum, untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Interpretation seiner Geschichte und zeigt schließlich Ansatzpunkte für einen konstruktiven interreligiösen Dialog auf.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (mit Hervorhebung der Bedeutung des interreligiösen Dialogs); 2. Der „islamische Ibrahim“ (mit Inhaltsangabe, Analyse markanter Begebenheiten und Bedeutung im Islam); 3. Der „christliche Abraham“ (analog zum Kapitel 2, aber mit Fokus auf die christliche Perspektive); 4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des „islamischen Ibrahim“ und des „christlichen Abraham“ (vergleichende Analyse); und 5. Fazit: Ansatzpunkte zum Dialog (Zusammenfassung und Ausblick).
Wie werden die Erzählungen von Abrahams Glaubensprüfung verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Erzählungen von Abrahams Glaubensprüfung, insbesondere das Opfer seines Sohnes, im Koran und in der Bibel detailliert. Dabei werden sowohl die narrativen Unterschiede als auch die theologischen Implikationen für beide Religionen herausgestellt und systematisch gegenübergestellt.
Welche Bedeutung hat Abraham für den interreligiösen Dialog?
Die Arbeit betont die zentrale Bedeutung Abrahams als Figur im interreligiösen Diskurs. Sein Glaube und Gehorsam dienen als gemeinsames Vorbild und Ansatzpunkt für den Dialog zwischen Muslimen und Christen. Der Vergleich der unterschiedlichen Interpretationen soll zum Verständnis und zur Förderung des interreligiösen Austauschs beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Abraham, Ibrahim, Interreligiöser Dialog, Islam, Christentum, Koran, Bibel, Glaube, Gehorsam, Glaubensprüfung, Opfer, Berufung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für den interreligiösen Dialog, die Religionswissenschaften und die vergleichende Theologie interessiert. Sie eignet sich besonders für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Islam und Christentum auseinandersetzen.
- Quote paper
- Gülende Albayrak (Author), 2015, Abraham, der Erzvater der Weltreligionen im Christentum und dem Islam. Grund zum interreligiösen Dialog?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312698