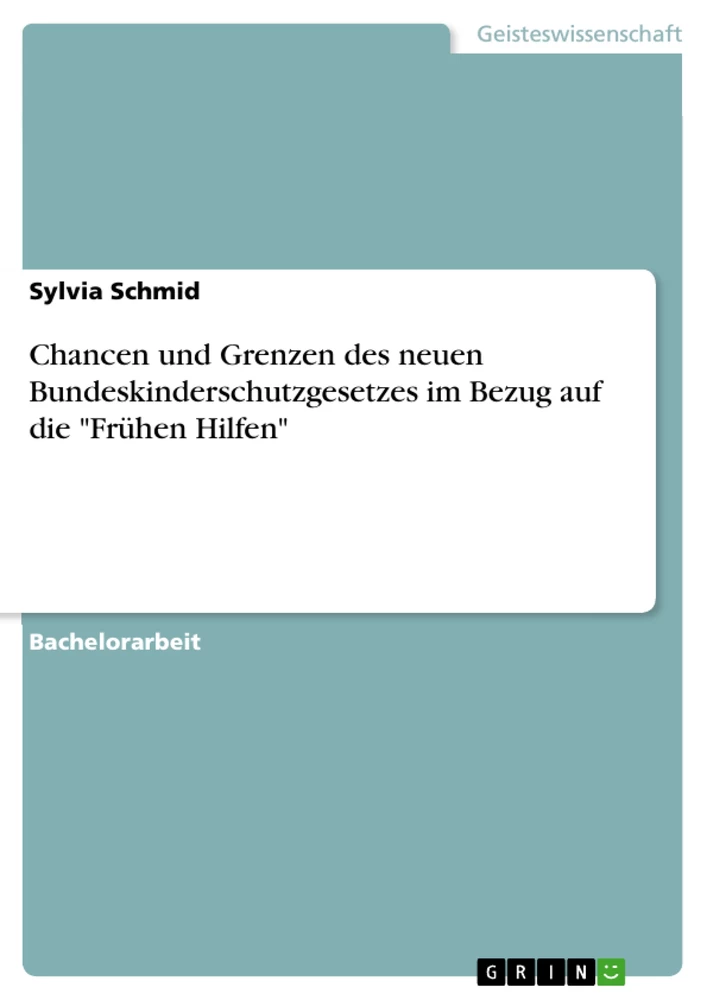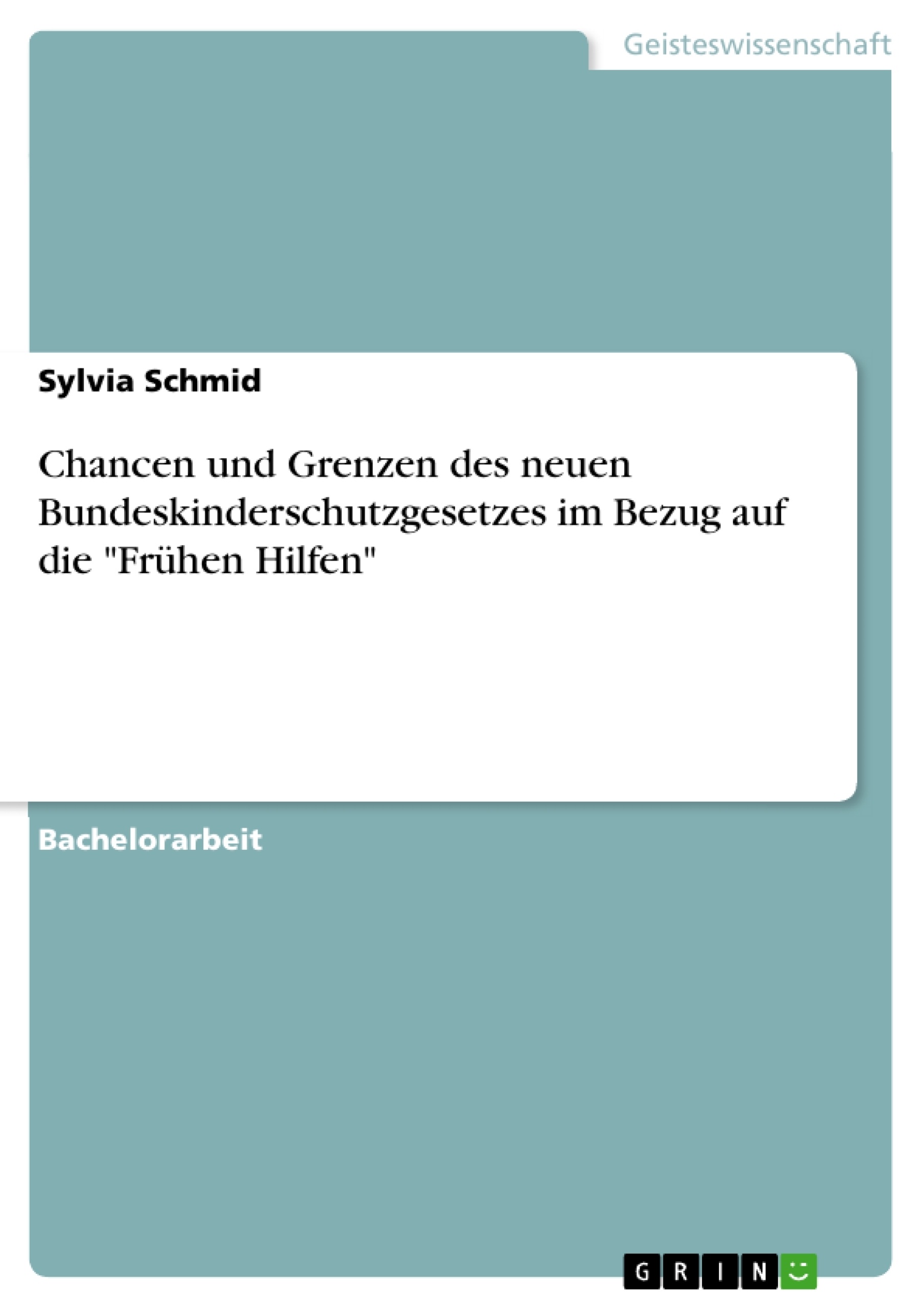Mangelnde Fürsorge, physische, psychische oder gar sexuelle Misshandlung sind nach allen einschlägigen Erfahrungen nicht einem wie auch immer gearteten Strukturwandel geschuldet, sondern gehören unbestritten in manchen Familien bedauerlicherweise zum Alltag. Außenstehende sehen sich in solchen Fällen regelmäßig nicht nur mit der Frage konfrontiert, wie “so etwas” geschehen konnte, sondern auch mit der Frage nach den Verantwortlichkeiten.
Schwierig wird es, wenn wir persönlich, sei es als Fachkraft oder Privatperson Kenntnis erlangen von Situationen, oder Handlungen beobachten, die dem Bereich der Kindeswohlgefährdung zuzuordnen sind. Zumeist handeln die Eltern nämlich nicht aus Überzeugung, sondern reagieren inadäquat auf Lebensumstände, die sie zu diesem Zeitpunkt überfordern. Diese Sicht der Dinge ist auch Ausfluss der Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts, wonach, Eltern grundsätzlich am besten zur Pflege und Erziehung und damit auch zum Schutz ihrer Kinder geeignet sind.
Das neue Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKiSchG), das am 01.01.2012 in Kraft trat, soll nun die Rahmenbedingungen schaffen, dass Familien eine umfassende Unterstützung erfahren mit dem Ziel, eventuelle Grenzsituationen gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. durch entsprechend genutzte Hilfsangebote abzumildern.
Während meiner Hospitation im Jugendamt Lindau hatte ich die Möglichkeit, die ersten Schritte zur Umsetzung des BKiSchG begleiten zu können. Die vielen damit verbundenen Unsicherheiten, die in Fragen münden wie die nach
- den geeigneten Wegen und Methoden wie die in Frage kommenden Akteure für eine Zusammenarbeit gewonnen werden können
- der richtigen und sinnvollen Ausgestaltung des Rechtsanspruchs auf Beratung durch eine insoweit erfahrenen Fachkräfte
- der Information wirklich aller Eltern
- dem Transport geeigneter Hilfen ohne tatsächliche oder vermeintliche Kontrollaspekte
- und nicht zuletzt der Frage, nach der Finanzierung, weckten mein Interesse, den Gesetzestext genauer anzuschauen.
Im Rahmen meiner Literarturarbeit werde ich mich bei der Beantwortung dieser Fragen auf den Kernbereich des BKiSchG, die “Frühen Hilfen”, konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1 Vorgeschichte zum neuen Bundeskinderschutzgesetz
- 1.1 Kindeswohl in der UN-Kinderrechtskonvention
- 1.2 Kindeswohl aus verfassungsrechtlicher Sicht
- 1.3 Zur Herstellung eines politischen Handlungsbedarfes
- 1.4 Politische Reaktionen
- 1.5 Zur Finanzierung der Gesetzesumsetzung
- Kapitel 2 Wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage für "Frühe Hilfen"
- 2.1 Einfluss der Sozialisationssysteme auf die kindliche Entwicklung
- 2.2 Besonderheiten der frühen Kindheit
- 2.3 Annäherung an den Begriff der Kindeswohlgefährdung
- 2.3.1 Vernachlässigung
- 2.3.2 Körperliche Misshandlung
- 2.3.3 Seelische Misshandlung
- 2.3.4 Sexueller Missbrauch
- 2.4 Zur Bedeutung der Feinfühligkeit
- Kapitel 3 Anforderungen und Stolpersteine bei der Umsetzung
- 3.1 Eckpunkte des Gesetzes
- 3.2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung
- 3.3 Verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz
- 3.4 Kooperation einer Vielzahl von Akteuren
- 3.5 Erfassung von Misshandlungen
- 3.6 Befugnisnorm der Berufsgeheimnisträger
- 3.7 Der einseitige Fokus auf die “Frühen Hilfen”
- 3.8 Niederschwelligkeit der “Frühen Hilfen”
- Kapitel 4 Analyse von Chancen und Grenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Grenzen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) im Hinblick auf die „Frühen Hilfen“. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob das Gesetz tatsächlich geeignet ist, den Kinderschutz nachhaltig zu verbessern, oder ob es eher ein „Schnellschuss“ ist, der vor allem darauf abzielt, die Öffentlichkeit zu beruhigen und die Handlungsfähigkeit der Legislative zu demonstrieren.
- Die Vorgeschichte des BKiSchG und die Hintergründe seiner Entstehung.
- Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bedeutung der frühen Kindheit und der Kindeswohlgefährdung.
- Die Eckpunkte des BKiSchG und die damit verbundenen Absichten des Gesetzgebers.
- Die Herausforderungen und Stolpersteine bei der Umsetzung des Gesetzes, insbesondere im Bereich der „Frühen Hilfen“.
- Eine Analyse der Chancen und Grenzen des BKiSchG im Hinblick auf die „Frühen Hilfen“.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 beleuchtet die Vorgeschichte des neuen Bundeskinderschutzgesetzes und die Gründe für seine Entstehung. Es wird erörtert, ob die Fälle von Kindeswohlgefährdung tatsächlich zunehmen oder ob die mediale Aufmerksamkeit für das Thema gestiegen ist.
Kapitel 2 widmet sich den wissenschaftlichen Erkenntnissen als Grundlage für die „Frühen Hilfen“. Es wird erläutert, wie wichtig die frühen Entwicklungsphasen für ein Kind sind und welche Faktoren zu Kindeswohlgefährdung führen können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Begriffen „Vernachlässigung“, „körperliche Misshandlung“, „seelische Misshandlung“ und „sexueller Missbrauch“.
Kapitel 3 analysiert die Eckpunkte des neuen Gesetzes und beleuchtet die Absichten des Gesetzgebers sowie die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung. Es wird diskutiert, warum der Gesetzgeber seinen Fokus zwar auf die „Frühen Hilfen“ gerichtet hat, aber gleichzeitig die Finanzierung dieser Maßnahmen nur unzureichend gesichert hat.
Schlüsselwörter (Keywords)
Bundeskinderschutzgesetz, Frühe Hilfen, Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch, Familienhebammen, Netzwerkstrukturen, Kooperation, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG)?
Das BKiSchG soll den aktiven Schutz von Kindern stärken und Familien durch „Frühe Hilfen“ unterstützen, um Gefährdungssituationen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Was versteht man unter „Frühen Hilfen“?
Das sind niederschwellige Unterstützungsangebote für Eltern ab der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes, wie z.B. Familienhebammen.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung des Gesetzes?
Kritische Punkte sind die oft unzureichende Finanzierung, die Kooperation vieler Akteure in Netzwerken sowie die Information aller Eltern ohne Kontrollaspekte.
Welche Befugnisse haben Berufsgeheimnisträger im Kinderschutz?
Das Gesetz regelt die Befugnisnormen, unter denen Fachkräfte (wie Ärzte oder Lehrer) bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung das Jugendamt informieren dürfen.
Was sind die vier Formen der Kindeswohlgefährdung?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung, seelischer Misshandlung und sexuellem Missbrauch.
- Quote paper
- Sylvia Schmid (Author), 2012, Chancen und Grenzen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes im Bezug auf die "Frühen Hilfen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312357