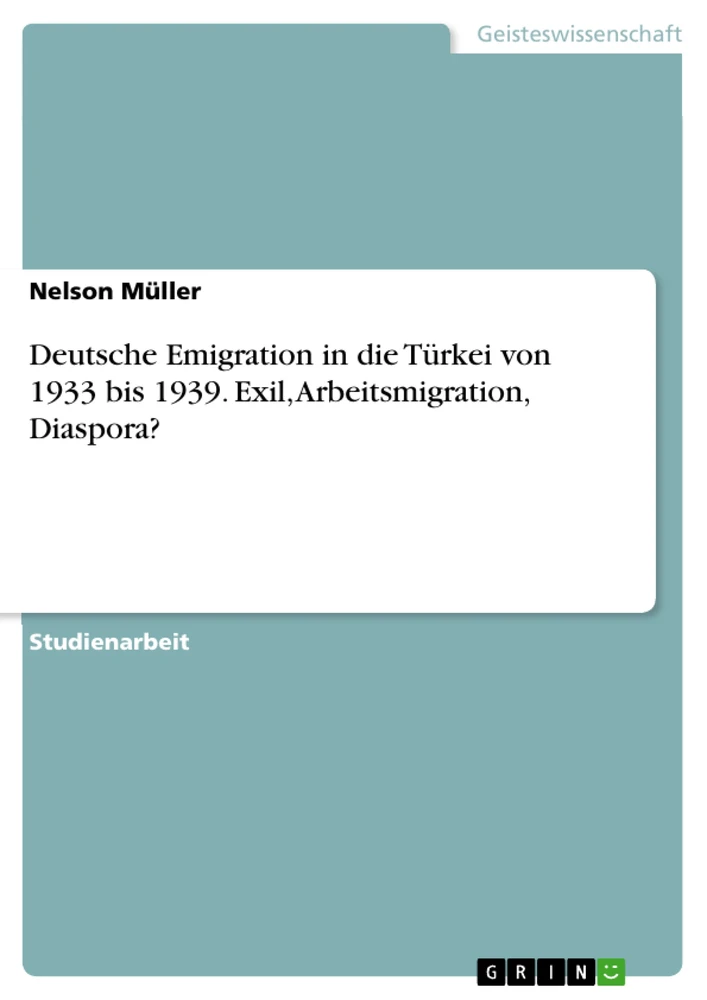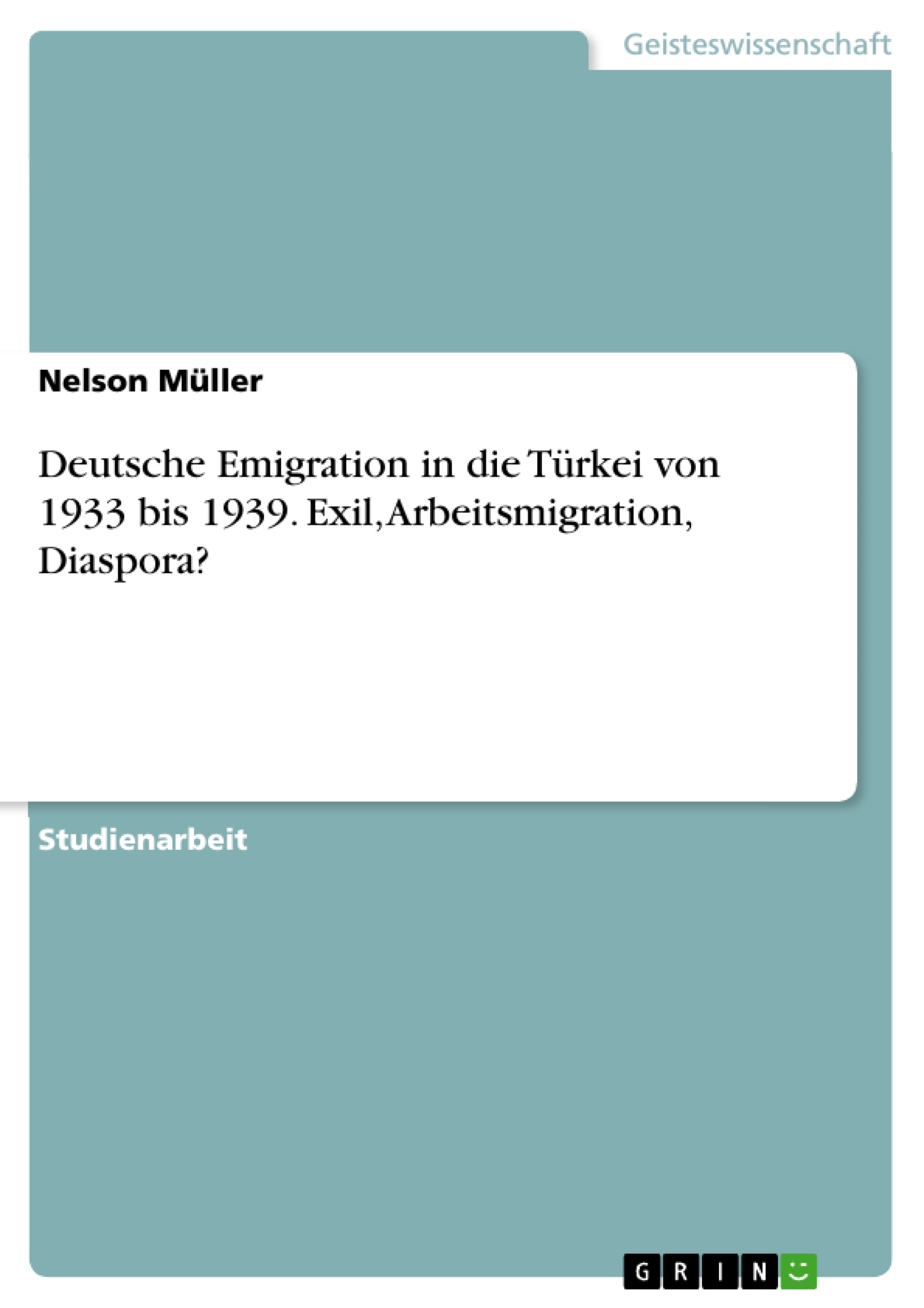Artikel 16(a), Abschnitt 1 des deutschen Grundgesetzes regelt die Grundrichtlinie des deutschen Asylrechts mit einem einfachen, kurzen Satz: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Dieser Satz wurde gewiss auch aus dem Geist der Dankbarkeit gegenüber den zahlreichen Aufnahmeländern formuliert, in denen bis zu Beginn des zweiten Weltkrieges ungefähr 400.000 Deutsche vor der nationalsozialistischen Herrschaft Zuflucht fanden und dadurch überleben konnten.
Ein besonders interessantes Aufnahmeland ist die Türkei. Sie wurde in der europäischen Forschung stark vernachlässigt, obwohl wahrscheinlich in keiner anderen Nation die Aufnahme deutschsprachiger Emigranten stärkere gesellschaftliche Auswirkungen hatte. In der folgenden Arbeit soll gezeigt werden, dass dies einer besonderen historischen Situation, die einen Dualismus zweier parallel verlaufender, entgegengesetzter Entwicklungen darstellt, geschuldet ist. „Das Projekt der deutschsprachigen Emigration in der Türkei“ gewann eine eigene spezifische Dynamik, welche dazu führte, dass das gesamte moderne türkische Hochschulsystem auf deutscher Aufbauhilfe fußt.
Noch heute ist das Wort ,,Haymatloz“, das die deutschsprachige Emigranten zwischen 1933 und 1945 meint, den meisten Türken ein Begriff. In Deutschland hingegen verschwand dieser erfreuliche Abschnitt der deutsch-türkischen Beziehungen aus dem kollektiven Gedächtnis und ihm wird auch bei den aktuellen politischen Diskursen, über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union einerseits, sowie über die (mangelnde) Integration türkischer Migranten in Deutschland andererseits, keine Bedeutung mehr zugemessen.
Der folgende Aufsatz soll aufzeigen, dass eine migrationswissenschaftliche Betrachtung der deutschsprachigen Emigration in der Türkei, im Besonderen ihrer Ursachen und Bedingungen, dennoch rentabel ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Exil als Gegenstand historischer Migrationsforschung
- 2.1 Schwerpunkte historischer Migrationsforschung
- 2.2 Verhältnis von Exilforschung und historischer Migrationsforschung
- 2.3 Theoretische Auffassungen historischer Migrationsforschung
- 2.4 Methodische Auffassungen historischer Migrationsforschung
- 3 Typisierung von Migranten
- 3.1 Problematisierung einer Migrantentypologie
- 3.2 Emigration
- 3.3 Diaspora-Migration
- 3.4 Arbeitsmigration
- 4 Theoretisierung des Exilbegriffs
- 4.1 Exil bei Bertolt Brecht
- 4.2 Exil bei Edward Said
- 5 Deutschsprachige Emigration in der Türkei (1933 - 1939)
- 5.1 Entwicklungen im deutschen Hochschulwesen
- 5.2 Entwicklungen im türkischen Hochschulwesen
- 5.3 Bedingungen der Emigration
- 5.4 Integration in der Türkei
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der deutschsprachigen Emigration in die Türkei zwischen 1933 und 1939. Sie zielt darauf ab, die spezifischen Charakteristika dieser Migration zu analysieren und sie im Kontext der historischen Migrationsforschung zu betrachten. Dabei stehen die Begriffe Exil, Emigration, Diaspora und Arbeitsmigration im Mittelpunkt der Untersuchung.
- Die Bedeutung der deutschsprachigen Emigration für die Entwicklung des türkischen Hochschulsystems
- Die Analyse der Begriffe Exil, Emigration, Diaspora und Arbeitsmigration im Kontext der deutschsprachigen Emigration in die Türkei
- Die Untersuchung der Ursachen und Bedingungen, die zur deutschsprachigen Emigration in die Türkei führten
- Die Integration deutschsprachiger Emigranten in die türkische Gesellschaft
- Die Relevanz der deutschsprachigen Emigration in der Türkei für die aktuelle politische Diskussion über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union und die Integration türkischer Migranten in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt den Grundstein für die Untersuchung, indem es den Kontext der deutschsprachigen Emigration in der Türkei einführt und die zentrale Bedeutung des Themas für die Geschichte der deutsch-türkischen Beziehungen hervorhebt. Es stellt die wichtigsten Fragen der Arbeit dar.
Kapitel 2 widmet sich der historischen Migrationsforschung als Fachdisziplin und beleuchtet deren Schwerpunkte, theoretische und methodische Ansätze. Es wird die Relevanz der Migrationsforschung für die Untersuchung des deutschsprachigen Exils in der Türkei herausgestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Typisierung von Migranten und stellt die Begriffe Emigration, Diaspora und Arbeitsmigration vor. Dabei werden die Problematiken und Grenzen einer klaren Unterscheidung zwischen diesen Begriffen diskutiert.
Kapitel 4 geht der Frage nach, wie der Begriff Exil theoretisch betrachtet werden kann. Die Analysen von Bertolt Brecht und Edward Said werden dazu herangezogen, um verschiedene Facetten des Exil-Begriffs zu beleuchten.
Kapitel 5 analysiert die deutschsprachige Emigration in der Türkei im Zeitraum von 1933 bis 1939. Die Entwicklungen im deutschen und türkischen Hochschulwesen werden dargelegt und die Bedingungen der Emigration sowie die Integration der Emigranten in der Türkei werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Deutschsprachige Emigration, Türkei, Exil, Migrationsforschung, Emigration, Diaspora, Arbeitsmigration, Hochschulsystem, Integration, Politik, Deutschland, Europa.
- Quote paper
- Nelson Müller (Author), 2012, Deutsche Emigration in die Türkei von 1933 bis 1939. Exil, Arbeitsmigration, Diaspora?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312275