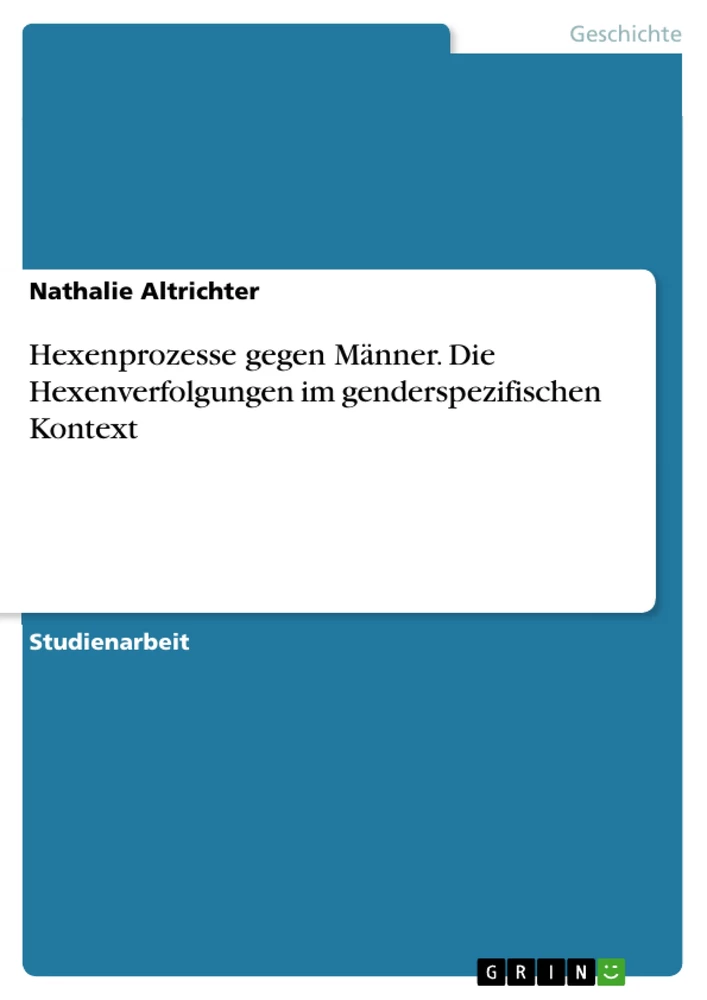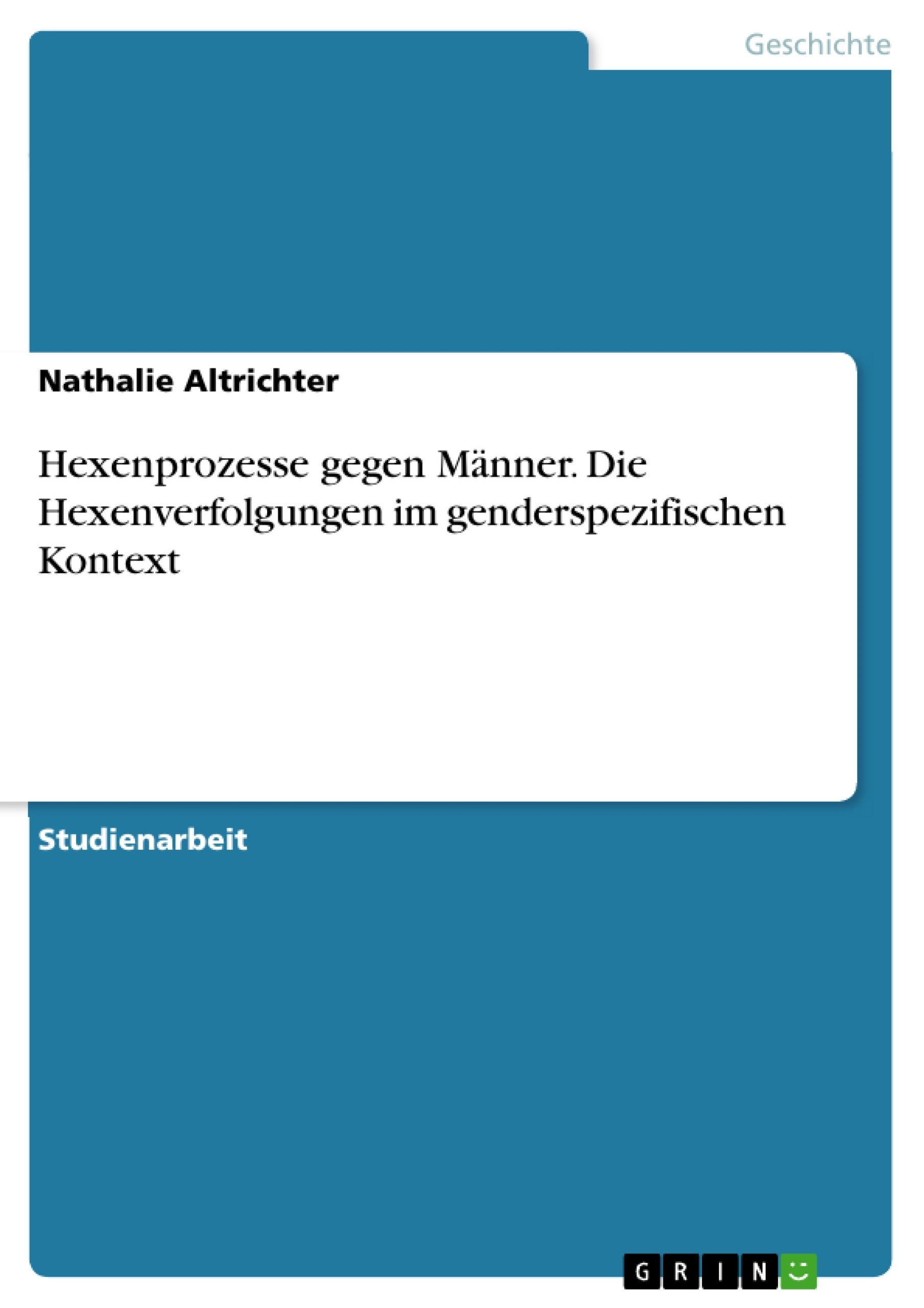Die Geschichte der „Hexenprozesse“ bringt man oftmals nicht unweigerlich mit Männern in der Rolle der Opfer in Verbindung, da diese zur Zeit der Verfolgungen einerseits in der Minderheit waren und andererseits weniger von ihnen überliefert ist als von solchermaßen verfolgten Frauen. Diese Arbeit thematisiert die Hexenverfolgungen in Österreich von ihren Anfängen in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zu ihrem Höhepunkt im 17. Jahrhundert.
Besonders werden dabei die Unterschiede hinsichtlich der Behandlung und Anklage, des Prozesses und der Hinrichtung zwischen Männern und Frauen untersucht. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, ob Männer und Frauen im Zuge der Hexenprozesse unterschiedlich bestraft beziehungsweise grundsätzlich verschieden behandelt wurden. Da sich die Hexenverfolgungen aus den Ketzerverfolgungen entwickelten, wird zuerst kurz die Begriffsentwicklung der „Hexe“ näher erläutert, um sie vom Ketzer abzugrenzen.
Anhand von einigen Fallbeispielen verschiedener Anklagen, Prozesse und Hinrichtungen von Männern und Frauen, wobei der Fokus auf den männlichen Opfern liegt, werden Unterschiede gesucht. Mittels dieser Fallbeispiele ist festzustellen, ob man bei Männern im Vergleich zu Frauen größere Milde walten ließ oder zu noch härteren Maßnahmen griff. Weiters wird untersucht, ob Männer derselben Taten bezichtigt wurden wie Frauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Hexe? Kulturgeschichtliche Begriffsbestimmung
- Hexerei und der Hexenhammer
- Ketzerei & der Papst
- „Malleus Maleficarum“ oder der „Hexenhammer“
- Hexenprozesse in ausgewählten österreichischen Ländern
- Hexenverfolgungen in der Steiermark
- Hexenverfolgungen in Salzburg oder die „Zauberer-Jackl-Prozesse“
- Hexenverfolgungen in Kärnten
- Schlusswort
- Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den genderspezifischen Kontext der Hexenverfolgungen im Raum des heutigen Österreichs. Sie beleuchtet den Beginn der mittelalterlichen Hexenverfolgungen ab dem 15. Jahrhundert und die kulturelle Entwicklung des Begriffs „Hexe“. Anhand von Fallbeispielen männlicher Opfer aus Österreich wird das typische Vorgehen bei den Verfolgungen demonstriert. Ziel ist es, anhand der Fachliteratur zu ergründen, ob es Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen während der Hexenprozesse gab.
- Kulturgeschichtliche Entwicklung des Begriffs „Hexe“
- Der „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum) und seine Bedeutung
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Verfolgung von Männern und Frauen
- Fallbeispiele aus der Steiermark, Salzburg und Kärnten
- Der Glaube an Hexen und seine gesellschaftlichen Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hexenverfolgungen ein und hebt die überraschende Rolle der Männer als Opfer hervor, im Gegensatz zum gängigen Bild der Hexe als Frau. Sie kündigt die Fokussierung auf den genderspezifischen Aspekt der Verfolgungen im österreichischen Raum an und benennt die Forschungsfrage nach möglichen Unterschieden in der Behandlung von Männern und Frauen.
Was ist eine Hexe? Kulturgeschichtliche Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel spürt den Ursprüngen des Hexenglaubens nach, beginnend bei alten Kulturen wie Babylon und der Bibel. Es verfolgt die Entwicklung des Begriffs „Hexe“ von mythologischen Wurzeln bis hin zu seiner theologischen und gesellschaftlichen Konnotation in der frühen Neuzeit. Die Darstellung betont, wie die Vorstellung von Hexen als Frauen mit traditionellen Rollenbildern und gesellschaftlichen Ängsten verbunden war, wobei die Rolle der Frau in der Nahrungs- und Viehwirtschaft als Ausgangspunkt für Anschuldigungen diskutiert wird. Der Begriff "Hexe" wird als Sammelbegriff präsentiert, der verschiedene Bezeichnungen für Zauberei umfasste.
Hexerei und der Hexenhammer: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des "Hexenhammers" (Malleus Maleficarum) als wichtiges Werk für die Hexenverfolgung. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Ketzerei und der Verfolgung durch die Kirche, wobei der "Hexenhammer" als Instrument der systematischen Verfolgung von angeblichen Hexen dargestellt wird. Die Bedeutung der Schrift für die Verbreitung und Legitimation von Hexenprozessen wird ausführlich behandelt.
Hexenprozesse in ausgewählten österreichischen Ländern: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele aus der Steiermark, Salzburg und Kärnten, um die regionalen Besonderheiten und die Durchführung von Hexenprozessen zu veranschaulichen. Es analysiert die jeweiligen Prozesse, indem es Details zu den Verfahren und den Schicksalen der Betroffenen aufzeigt. Die Kapitel bieten eine regionale Perspektive auf die umfassendere Problematik der Hexenverfolgung.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Gender, Österreich, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Malleus Maleficarum, Hexenhammer, Ketzerei, Zauberer, Volksglaube, Theologie, Fallbeispiele, Genderspezifische Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hexenverfolgungen im deutschsprachigen Raum
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Hexenverfolgungen im Raum des heutigen Österreichs mit einem besonderen Fokus auf den genderspezifischen Kontext. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs "Hexe", die Rolle des "Hexenhammers" (Malleus Maleficarum), und analysiert Fallbeispiele aus der Steiermark, Salzburg und Kärnten, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Verfolgung von Männern und Frauen aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die kulturgeschichtliche Entwicklung des Begriffs "Hexe", die Bedeutung des "Hexenhammers", die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Verfolgung von Männern und Frauen, Fallbeispiele aus verschiedenen österreichischen Regionen und den Einfluss des Hexenglaubens auf die Gesellschaft.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Der Fokus liegt auf dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, beginnend ab dem 15. Jahrhundert.
Welche Regionen Österreichs werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Hexenverfolgungen in der Steiermark, Salzburg und Kärnten.
Welche Rolle spielt der "Hexenhammer" (Malleus Maleficarum)?
Der "Hexenhammer" wird als zentrales Werk für die Hexenverfolgung analysiert. Seine Bedeutung für die Verbreitung und Legitimation von Hexenprozessen wird ausführlich behandelt, ebenso der Zusammenhang zwischen Ketzerei und der Verfolgung durch die Kirche.
Gab es Unterschiede in der Verfolgung von Männern und Frauen?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Anhand von Fallbeispielen, inklusive männlicher Opfer, wird untersucht, ob es Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen während der Hexenprozesse gab.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Fachliteratur.
Gibt es Fallbeispiele?
Ja, die Arbeit präsentiert Fallbeispiele aus der Steiermark, Salzburg und Kärnten, um die regionalen Besonderheiten und die Durchführung der Hexenprozesse zu veranschaulichen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird im Schlusswort und im Abstract zusammengefasst und erläutert die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der genderspezifischen Unterschiede in den Hexenverfolgungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hexenverfolgung, Gender, Österreich, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Malleus Maleficarum, Hexenhammer, Ketzerei, Zauberer, Volksglaube, Theologie, Fallbeispiele, Genderspezifische Unterschiede.
- Quote paper
- Nathalie Altrichter (Author), 2014, Hexenprozesse gegen Männer. Die Hexenverfolgungen im genderspezifischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312036