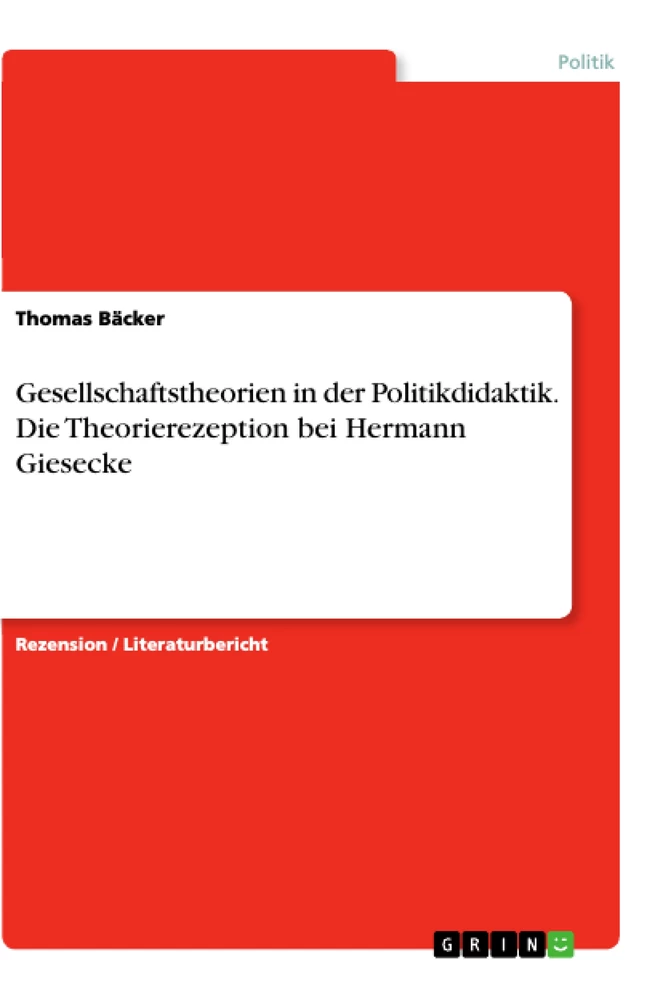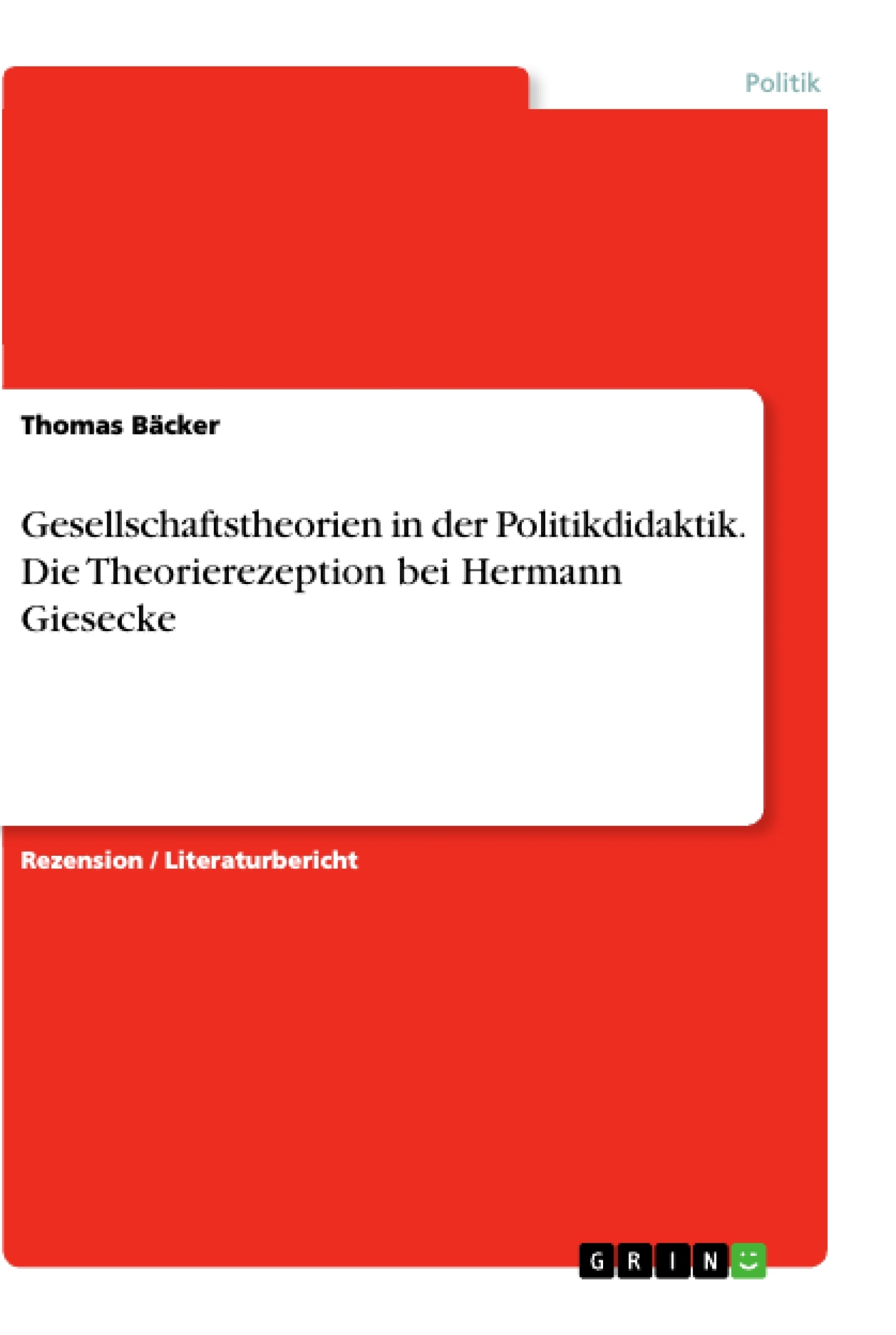Hermann Giesecke (geb. 1932) setzte mit seiner 1965 veröffentlichten "Didaktik der politischen Bildung" den Impuls zur "sozialwissenschaftlichen Wende" in der Politikdidaktik. Das Buch gilt bis heute als das am weitesten verbreitete politikdidaktische Werk und war die erste Monografie ihrer Art in Deutschland. Giesecke geht darin von der Prämisse aus, dass Politik in politischen Konflikten konkret werde.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Gesellschaftstheorie in der Politikdidaktik - eine Einführung
- zur Wdh.: Schwietring, Thomas: Was ist Gesellschaft?
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (I)
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (II)
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (III)
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (IV)
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (I)
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (II)
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (III)
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (IV)
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (V)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Text untersucht den Einfluss von Gesellschaftstheorien auf die Politikdidaktik. Dabei wird das Werk von Hermann Giesecke, insbesondere seine Rezeption von Konflikttheorien und der Kritischen Theorie, im Kontext der Entwicklung der Politikdidaktik in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet.
- Die Bedeutung von Gesellschaftstheorien für die Politikdidaktik
- Die Rezeption von Gesellschaftstheorien in der Politikdidaktik
- Die Rolle von Hermann Giesecke in der Entwicklung der Politikdidaktik
- Die Verbindung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik
- Die Herausforderungen und Chancen der kritischen politischen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Gesellschaftstheorie in der Politikdidaktik - eine Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Begriffs „Gesellschaft“ und stellt unterschiedliche Perspektiven auf den Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Individuum und Politik dar. Es wird auf die Rolle von Staat und Politik als Rahmenbedingungen der Gesellschaft eingegangen und die Bedeutung des Konzepts der Staatsbürgerschaft für das Zusammenleben in einer Gesellschaft erörtert.
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (I): Dieses Kapitel fokussiert auf die Konfliktdidaktik von Hermann Giesecke, die er in den 1960er Jahren mit Bezug auf die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf entwickelte. Es wird die Kritik an der traditionalen, konsensorientierten Politikdidaktik und die Betonung von Konflikten und Machtkämpfen in der Gesellschaft hervorgehoben. Die Konfliktdidaktik betont die Notwendigkeit, Schüler*innen zu befähigen, Konflikte konstruktiv zu bewältigen und aktiv am politischen Prozess teilzunehmen.
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (II): Dieses Kapitel setzt die Analyse der Konfliktdidaktik von Hermann Giesecke fort. Es geht detaillierter auf die Konzepte der Machtverteilung und Interessenkonflikte in der Gesellschaft ein. Die Konfliktdidaktik zielt darauf ab, Schüler*innen ein kritisches Bewusstsein für Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse zu entwickeln, um sie zu befähigen, eigene Positionen zu vertreten und sich aktiv für Veränderungen einzusetzen.
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (III): Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz von Konflikten für die politische Bildung. Es werden verschiedene Ansätze der Konfliktdidaktik diskutiert, die darauf abzielen, Schüler*innen zur Auseinandersetzung mit kontroversen Themen und Positionen zu motivieren. Die Konfliktdidaktik möchte Schüler*innen zu einer eigenständigen Urteilsbildung befähigen und ihnen helfen, ihre eigenen Standpunkte in einem öffentlichen Diskurs zu vertreten.
- Hermann Gieseckes ,,Konfliktdidaktik“ (IV): Dieses Kapitel setzt sich mit der Kritik an der Konfliktdidaktik von Hermann Giesecke auseinander. Es werden mögliche Nachteile der Konfliktdidaktik, wie zum Beispiel die Gefahr der Polarisierung oder die Vernachlässigung von Konsensbildungsprozessen, beleuchtet. Es wird die Notwendigkeit betont, die Konfliktdidaktik in einen größeren Kontext zu stellen und alternative Ansätze zur politischen Bildung zu berücksichtigen.
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (I): Dieses Kapitel beleuchtet die Hinwendung von Hermann Giesecke zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule in den 1970er Jahren. Es wird die Kritik an den bestehenden Machtstrukturen und der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sowie die Betonung von Emanzipation und Selbstbestimmung hervorgehoben. Die Kritische Theorie betont die Notwendigkeit, Schüler*innen zu befähigen, die bestehenden Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen und sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (II): Dieses Kapitel setzt die Analyse von Gieseckes Rezeption der Kritischen Theorie fort. Es geht detaillierter auf die Konzepte der Ideologiekritik und der Aufklärung ein. Die Kritische Theorie zielt darauf ab, Schüler*innen zu befähigen, Ideologien zu durchschauen und die eigenen Interessen und Bedürfnisse zu erkennen. Es wird die Bedeutung von kritischem Denken und eigenständigem Handeln für eine demokratische Gesellschaft hervorgehoben.
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (III): Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz der Kritischen Theorie für die politische Bildung in der heutigen Zeit. Es werden verschiedene Ansätze der kritischen politischen Bildung diskutiert, die darauf abzielen, Schüler*innen zu befähigen, sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einzubringen und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Die Kritische Theorie betont die Notwendigkeit, Schüler*innen zu einem kritischen und reflektierten Umgang mit Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnissen zu befähigen.
- Gieseckes neue Didaktik: Politische Bildung im Zeichen der Kritischen Theorie? (IV): Dieses Kapitel setzt sich mit der Kritik an der Kritischen Theorie im Kontext der politischen Bildung auseinander. Es werden mögliche Nachteile der Kritischen Theorie, wie zum Beispiel die Gefahr von Ideologisierung oder die Vernachlässigung pragmatischer Lösungsansätze, beleuchtet. Es wird die Notwendigkeit betont, die Kritische Theorie in einen größeren Kontext zu stellen und alternative Ansätze zur politischen Bildung zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Der Text befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten wie Gesellschaftstheorie, Politikdidaktik, Konfliktdidaktik, Kritische Theorie, Macht, Herrschaft, Emanzipation, Selbstbestimmung, Ideologiekritik, Aufklärung, politische Bildung und Bildung für Demokratie.
- Quote paper
- Thomas Bäcker (Author), 2014, Gesellschaftstheorien in der Politikdidaktik. Die Theorierezeption bei Hermann Giesecke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311815