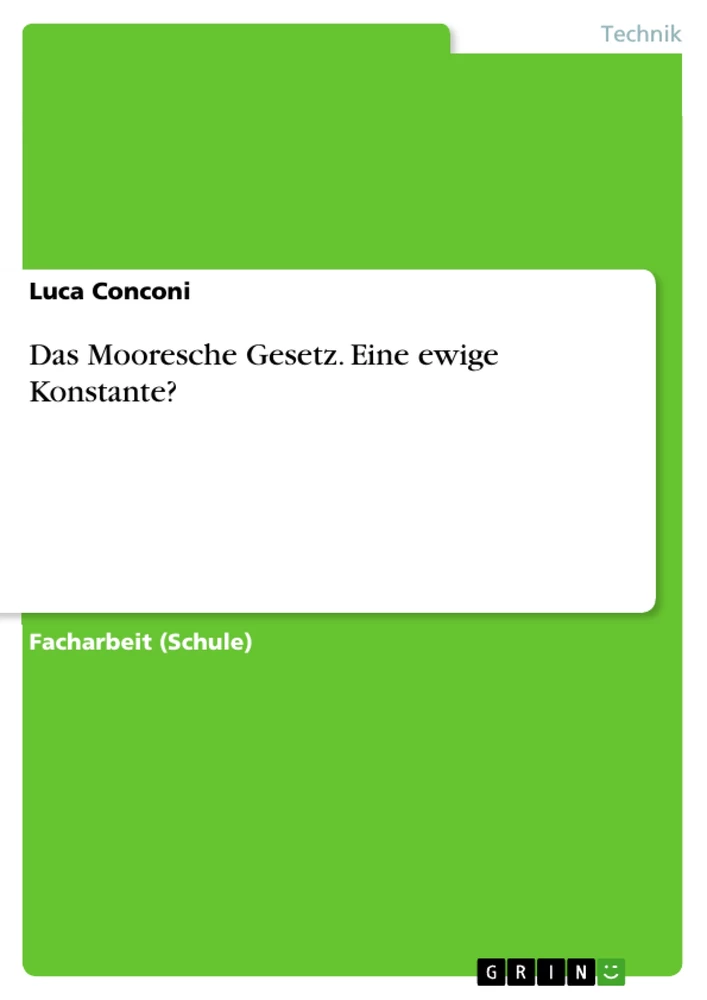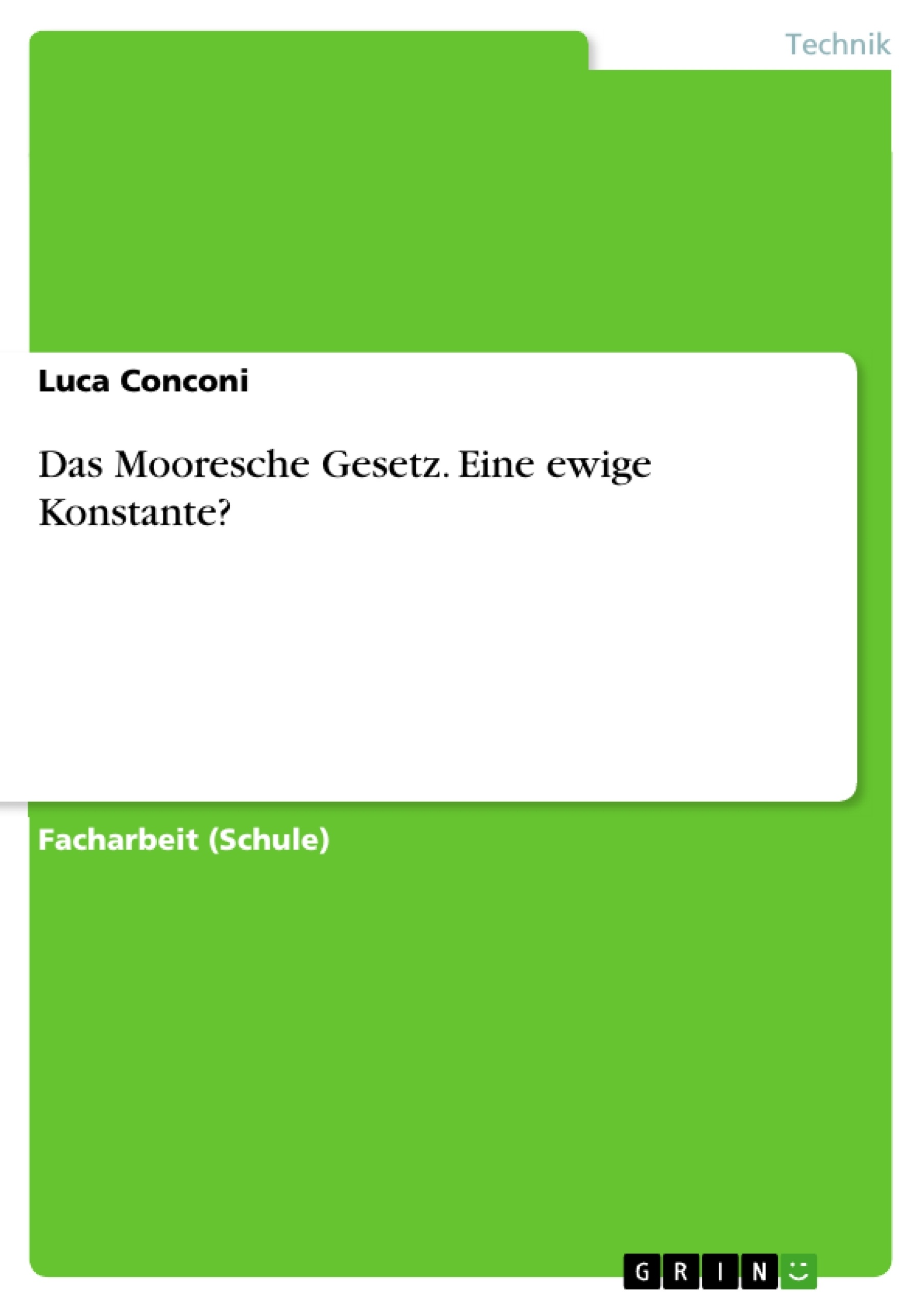Diese Facharbeit handelt über das exponentielle Wachstum unserer Rechenleistung unter Beachtung des Moorschen Gesetzes. Dabei wird Schritt für Schritt das Versagen des Moorschen Gesetzes längerfristig nähergelegt. Die Folgen und mögliche Lösungen werden in eigenen Nebenkapitel ausführlich behandelt.
Ich unterteile das Thema in eine Einführung, in welcher ich das Mooresche Gesetz zunächst einmal vorstelle. Dabei soll auch die Geschichte der Technologie eine Rolle spielen. Später soll dann eine genauere Erklärung der Formel von Gordon Moor das Wachstum verständlich machen und zu guter Letzt stelle ich ein paar Beispiele einer solchen Wachstumskurve vor.
Nach dieser ausführlichen Erklärung des Mooreschen Gesetzes werde ich die Hauptthese dieser Facharbeit aufstellen und im Verlauf der Herleitung Schritt für Schritt die Richtigkeit dieser These zu beweisen versuchen.
Ich strebe danach, die Herleitung meiner Aussage so verständlich wie möglich zu gestalten, indem ich die Begriffe in einer Einleitung am Anfang jedes grösseren Themas erläutere. Dabei werde ich auch nicht direkt relevante Gesichtspunkte streifen, wie zum Beispiel die Geschichte oder Entstehung von einzelnen Aspekten.
Das für mich übergeordnete Ziel bleibt die Naivität des fundamentalen Glaubens an eine ewig grenzenlose Leistungssteigerung. Es ist meine Absicht, diese Erwartung in ein rationaleres und vielleicht ernüchternderes Licht zu rücken. Jedoch ist es mir dabei auch wichtig, einige Lösungsvorschläge vorzustellen, weil diese Problematik weitgehende Folgen haben würde. Natürlich sind solche „Lösungsvorschläge“ noch reine Zukunftsmusik, jedoch gibt es bei all diesen Plänen auch schon Prototypen zu deren Verwirklichung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffslexikon
- Das Mooresche Gesetz
- Geschichte
- Erklärung
- Beispiele
- Formel
- These
- Herleitung
- Prozessoren
- Transistoren
- Funktionsweise
- Herstellung
- Geschichte
- Heisenbergsche Unschärfe-Relation
- Erklärung
- Bezug auf das Thema
- Schlussfolgerung
- Die Folgen
- Mögliche Lösungen und deren Probleme
- Atomare Transistoren
- Kubische Prozessoren
- Quanten-Prozessoren
- Zusammengeschaltete Prozessoren
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Facharbeit untersucht das Mooresche Gesetz und hinterfragt dessen Gültigkeit als ewige Konstante. Ziel ist es, die zugrundeliegende Technologie zu erklären und die Grenzen der bisherigen Leistungssteigerung von Prozessoren aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung, die mathematische Formel und die technischen Herausforderungen zukünftiger Entwicklungen.
- Das Mooresche Gesetz und seine historische Entwicklung
- Die technische Grundlage der Prozessoren und Transistoren
- Die physikalischen Grenzen der Miniaturisierung
- Mögliche zukünftige Technologien zur Leistungssteigerung
- Die Folgen einer Stagnation der Leistungssteigerung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehung der Facharbeit, ausgehend von der Lektüre von Michio Kakus Buch „DIE PHYSIK DER ZUKUNFT“. Der Autor beschreibt seine Faszination für das Thema Prozessoren und seine persönliche Motivation, sich mit dem Mooreschen Gesetz auseinanderzusetzen, basierend auf seiner familiären Umgebung und seinem Hobby des Computerbaus. Die Arbeit wird strukturiert und das übergeordnete Ziel, die Grenzen der Leistungssteigerung aufzuzeigen, wird formuliert.
Das Mooresche Gesetz: Dieses Kapitel beleuchtet das Mooresche Gesetz, seine Bekanntheit und die Bedeutung der genauen Zahlenwerte und unterschiedlichen Sichtweisen. Anhand einer Tabelle werden die Entwicklung der Transistorenanzahl in verschiedenen Prozessoren und deren jeweilige Bedeutung (z.B. erster 16-Bit-Prozessor, erster Prozessor mit über 100.000 Transistoren) veranschaulicht. Die Bedeutung des Mooreschen Gesetzes für die Technologieentwicklung wird hervorgehoben.
Prozessoren: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit Prozessoren, ihren Bestandteilen (Transistoren) und deren Funktionsweise sowie Herstellung. Die Geschichte der Prozessoren wird ebenfalls beleuchtet, um den Kontext des Mooreschen Gesetzes zu verdeutlichen. Die Kapitelteilthemen (Transistoren, Funktionsweise, Herstellung, Geschichte) werden zu einem umfassenden Bild der Prozessortechnologie zusammengefügt, wobei der Fokus auf deren Relevanz für das Mooresche Gesetz liegt.
Schlüsselwörter
Mooresches Gesetz, Transistoren, Prozessoren, Miniaturisierung, Leistungssteigerung, physikalische Grenzen, Halbleiter, Heisenbergsche Unschärfe-Relation, Quanten-Prozessoren, Zukunftstechnologien.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Das Mooresche Gesetz und seine Grenzen
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht das Mooresche Gesetz und seine Gültigkeit als dauerhafte Konstante. Sie beleuchtet die zugrundeliegende Technologie, die Grenzen der bisherigen Leistungssteigerung von Prozessoren und mögliche zukünftige Entwicklungen.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Mooreschen Gesetzes, die mathematische Formel, die technische Grundlage von Prozessoren und Transistoren, die physikalischen Grenzen der Miniaturisierung, mögliche zukünftige Technologien zur Leistungssteigerung (z.B. atomare Transistoren, kubische Prozessoren, Quanten-Prozessoren) und die Folgen einer Stagnation der Leistungssteigerung.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Begriffslexikon, ein Kapitel zum Mooreschen Gesetz (inklusive Geschichte, Erklärung und Formel), ein Kapitel zu Prozessoren (inkl. Transistoren, Funktionsweise, Herstellung und Geschichte), ein Abschnitt zur Heisenbergschen Unschärferelation und deren Bezug zum Thema, eine Schlussfolgerung, die Darstellung möglicher Lösungen und deren Probleme, sowie eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Rolle spielt das Mooresche Gesetz in der Facharbeit?
Das Mooresche Gesetz bildet den zentralen Gegenstand der Arbeit. Es wird untersucht, wie die Entwicklung der Transistoranzahl in Prozessoren das Gesetz illustriert und welche Grenzen der Miniaturisierung die Gültigkeit des Gesetzes langfristig in Frage stellen.
Wie werden Prozessoren in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit befasst sich detailliert mit der Funktionsweise, der Herstellung und der Geschichte von Prozessoren. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Prozessoren für das Mooresche Gesetz und die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche physikalischen Grenzen werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die physikalischen Grenzen der Miniaturisierung, insbesondere im Kontext der Heisenbergschen Unschärferelation, und deren Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung von Prozessoren.
Welche möglichen zukünftigen Technologien werden vorgestellt?
Die Facharbeit diskutiert mögliche zukünftige Technologien zur Leistungssteigerung, darunter atomare Transistoren, kubische Prozessoren, Quanten-Prozessoren und zusammengeschaltete Prozessoren, sowie die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Technologien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Facharbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mooresches Gesetz, Transistoren, Prozessoren, Miniaturisierung, Leistungssteigerung, physikalische Grenzen, Halbleiter, Heisenbergsche Unschärfe-Relation, Quanten-Prozessoren und Zukunftstechnologien.
Was ist die Zielsetzung der Facharbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, das Mooresche Gesetz zu untersuchen, dessen Gültigkeit als ewige Konstante zu hinterfragen und die Grenzen der bisherigen Leistungssteigerung von Prozessoren aufzuzeigen.
Welche Inspiration liegt der Facharbeit zugrunde?
Die Inspiration für die Facharbeit stammt aus der Lektüre von Michio Kakus Buch „DIE PHYSIK DER ZUKUNFT“ und dem persönlichen Interesse des Autors an Prozessoren und Computerbau.
- Quote paper
- Luca Conconi (Author), 2015, Das Mooresche Gesetz. Eine ewige Konstante?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311711