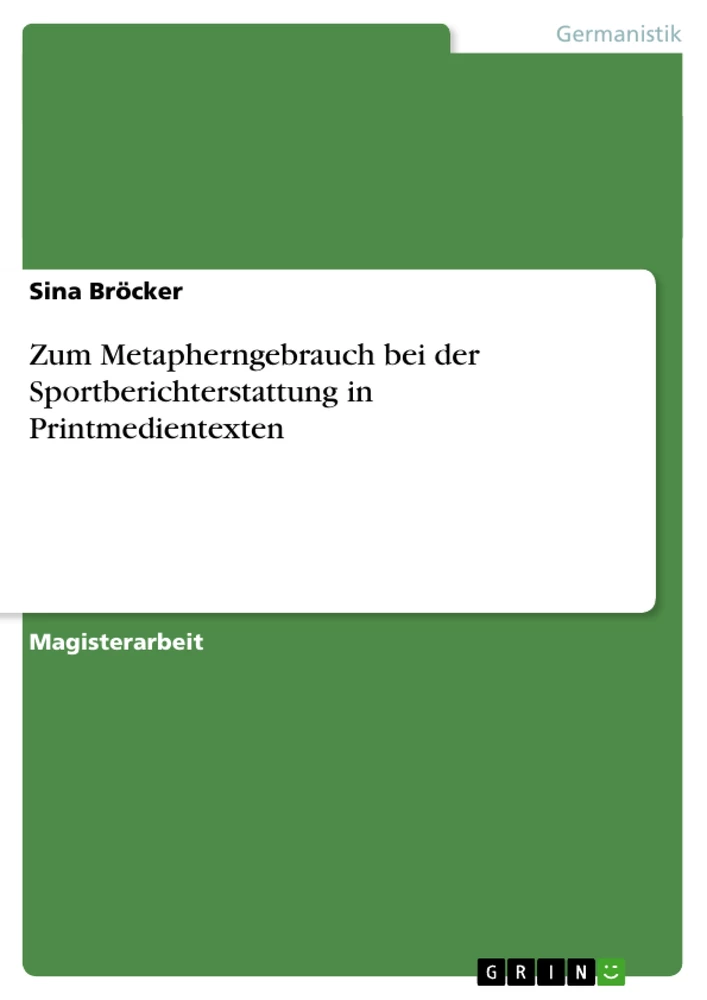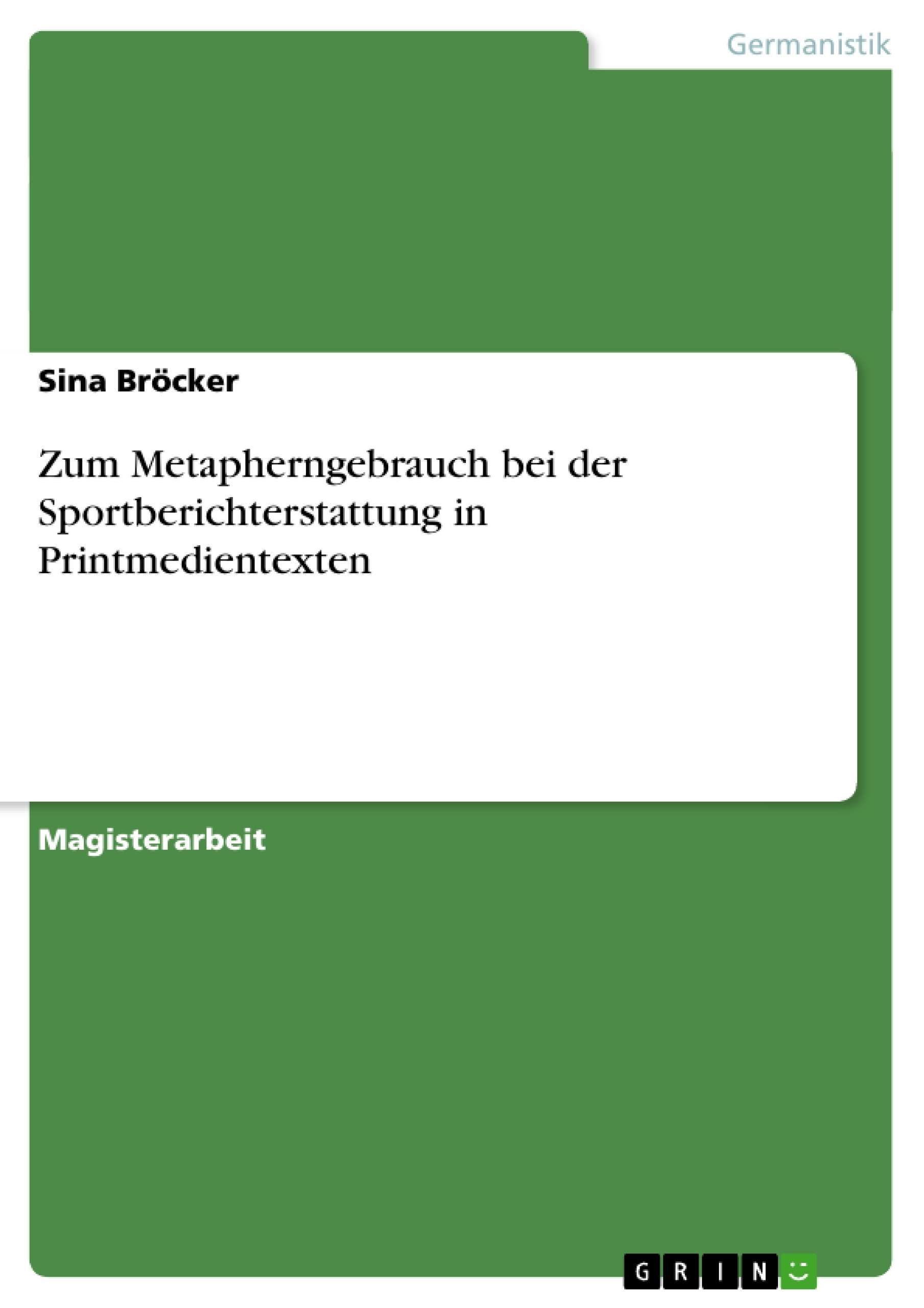Im vorliegenden Werk wird in einer komparativen Analyse der Metapherngebrauch von Handball-Spielberichten einer ausgewählten Tages- und einer ausgewählten Fachzeitschrift untersucht. Die Spielberichte aus der Saison 2002/2003 werden auf die Bildspenderbereiche sowie den Lexikalisierungsgrad der in ihnen verwendeten Metaphern untersucht. Insgesamt werden 18 Spielberichte auf ihren bildhaften Sprachgebrauch hin miteinander verglichen.
Es wird versucht, den Beweis anzutreten, dass sich die Tagespresse (Kieler Nachrichten) aufgrund ihres großen Leserkreises, dem Sportmuffel, Sportbegeisterte sowie normale Sportinteressierte angehören, eher der okkasionellen Metapher bedient. Dies geschieht wahrscheinlich vor allem aus persuasiven Gründen, denn innovative Metaphern, die nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln sind, wecken eher das Interesse und die Neugier von Lesern, als klare und eindeutige Aussagen. Insbesondere Überschriften sind ein beliebtes Mittel für derartige Metaphern, da sie aufgrund ihrer Größe und Positionierung als Erstes auffallen und von Lesern oftmals erst nach Begutachtung der jeweiligen Überschrift eines Artikels entschieden wird, ob dieser lesenswert ist oder nicht.
Genau entgegengesetzt wird der Metapherngebrauch in Fachzeitschriften (Handballwoche) vermutet. Die ausgewählte Handball-Fachzeitschrift bedient sich wahrscheinlich aufgrund ihres ausschließlich handballinteressierten Leserkreises, im Gegensatz zur Tageszeitung, häufiger der lexikalisierten Metaphern. Hier ist es nicht mehr nötig das Interesse der Leser zu wecken, denn es beziehen ausschließlich Handballinteressierte dieses Magazin. Sie wollen vor allem Fakten, Statistiken und eine Berichterstattung, die so nah und klar wie möglich die Geschehnisse auf dem Spielfeld wiedergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Metapherntheorie
- Einleitende Worte zum Metaphernverständnis
- Traditionelle Metapherntheorien und neuere Erklärungsversuche
- Die kognitiv-linguistische Theorie des Metaphernverständnisses
- Funktionen und Leistungen von Metaphern
- Leistungen der Metaphern
- Kommunikative Funktionen von Metaphern
- Die phatische Metaphernfunktion
- Die katachretische Metaphernfunktion
- Die epistemische Metaphernfunktion
- Die illustrative Metaphernfunktion
- Die argumentative Metaphernfunktion
- Die sozial-regulative Metaphernfunktion
- Metaphorische Einheiten
- Einwortmetaphern
- Wortgruppenmetaphern
- Der Sportbericht in der Tages- und in der Fachzeitschrift
- Tageszeitungen: Ein Überblick
- Der Sportbericht in der Tageszeitung
- Fachzeitschriften: Ein Überblick
- Der Sportbericht in der Fachzeitschrift
- Analyse des Korpusmaterials
- Die Metaphernverwendung in Überschriften
- Einteilung der okkasionellen Metaphern in Bildspenderbereiche
- Analyse der verwendeten Wortgruppenmetaphern
- Vorstellung und Erläuterung der verwendeten okkasionellen und lexikalisierten Einwortmetaphern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht vergleichend den Metapherngebrauch in Handball-Spielberichten einer Tageszeitung und einer Fachzeitschrift. Im Fokus steht die Analyse der Bildspenderbereiche und des Lexikalisierungsgrades der verwendeten Metaphern. Das Korpus umfasst 18 Spielberichte der Saison 2002/2003.
- Vergleich des Metapherngebrauchs in Tageszeitungen und Fachzeitschriften zum Thema Handball.
- Identifizierung der Bildspenderbereiche der verwendeten Metaphern.
- Untersuchung des Lexikalisierungsgrades der Metaphern.
- Analyse des Einflusses des Adressatenkreises auf den Metapherngebrauch.
- Beurteilung der Funktionen von Metaphern in der Sportberichterstattung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert den Metapherngebrauch in Handballspielberichten der Kieler Nachrichten (Tageszeitung) und der Handballwoche (Fachzeitschrift) der Saison 2002/2003, um den Einfluss des Adressatenkreises auf die Metaphorik zu untersuchen. Die Hypothese ist, dass Tageszeitungen eher okkasionelle, Fachzeitschriften eher lexikalisierte Metaphern verwenden.
1. Metapherntheorie: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte der Metapherntheorie, von Aristoteles bis zur kognitiv-linguistischen Theorie von Lakoff und Johnson. Es werden verschiedene Metapherntheorien und deren Stärken und Schwächen diskutiert, um den theoretischen Hintergrund für die anschließende Analyse zu legen.
2. Funktionen und Leistungen von Metaphern: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Funktionen und Leistungen von Metaphern, unterteilt in kommunikative, phatische, katachretische, epistemische, illustrative, argumentative und sozial-regulative Funktionen. Jede Funktion wird mit Beispielen erläutert und ihre Bedeutung im Kontext der Sportberichterstattung hervorgehoben.
3. Metaphorische Einheiten: Hier werden verschiedene Arten metaphorischer Einheiten unterschieden, insbesondere Einwortmetaphern (okkasionell und lexikalisiert) und Wortgruppenmetaphern (Phraseologismen). Der Prozess der Lexikalisierung und die Merkmale von Phraseologismen werden detailliert erklärt.
4. Der Sportbericht in der Tages- und in der Fachzeitschrift: Dieses Kapitel beschreibt die Unterschiede zwischen Tageszeitungen und Fachzeitschriften im Hinblick auf ihren Adressatenkreis, ihre Stilistik und ihren Zweck. Es werden die spezifischen Merkmale von Sportberichten in beiden Mediengattungen analysiert, einschließlich der Funktionen von Überschriften und der Rolle der Sprache.
Schlüsselwörter
Metapher, Sportberichterstattung, Handball, Tageszeitung, Fachzeitschrift, Bildspender, Lexikalisierung, Okkasionelle Metapher, Phraseologismus, Kognitive Linguistik, Lakoff & Johnson, Adressatenkreis, Kommunikative Funktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Metapherngebrauch in Handball-Spielberichten
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht vergleichend den Metapherngebrauch in Handball-Spielberichten einer Tageszeitung (Kieler Nachrichten) und einer Fachzeitschrift (Handballwoche) der Saison 2002/2003. Der Fokus liegt auf der Analyse der Bildspenderbereiche und des Lexikalisierungsgrades der verwendeten Metaphern, um den Einfluss des Adressatenkreises auf die Metaphorik zu beleuchten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse eines Korpus von 18 Handball-Spielberichten. Analysiert werden die verwendeten Metaphern hinsichtlich ihrer Bildspender, ihres Lexikalisierungsgrades (okkasionell vs. lexikalisiert), ihrer Funktion und ihrer Einordnung als Einwortmetaphern oder Wortgruppenmetaphern. Der Vergleich zwischen Tageszeitung und Fachzeitschrift ermöglicht die Untersuchung des Einflusses des Adressatenkreises.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die kognitiv-linguistische Metapherntheorie von Lakoff und Johnson. Es wird ein Überblick über die Geschichte der Metapherntheorie gegeben, von Aristoteles bis zur kognitiven Linguistik. Verschiedene Metapherntheorien werden diskutiert, um den theoretischen Hintergrund für die Analyse zu liefern.
Welche Arten von Metaphern werden untersucht?
Die Analyse umfasst sowohl Einwortmetaphern (okkasionell und lexikalisiert) als auch Wortgruppenmetaphern (Phraseologismen). Der Unterschied zwischen okkasionellen und lexikalisierten Metaphern sowie die Merkmale von Phraseologismen werden detailliert erläutert.
Welche Funktionen von Metaphern werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Funktionen von Metaphern, darunter kommunikative, phatische, katachretische, epistemische, illustrative, argumentative und sozial-regulative Funktionen. Die Bedeutung jeder Funktion im Kontext der Sportberichterstattung wird hervorgehoben.
Welche Ergebnisse werden erwartet / wurden erzielt?
Die Hypothese der Arbeit ist, dass Tageszeitungen eher okkasionelle, Fachzeitschriften eher lexikalisierte Metaphern verwenden. Die Analyse untersucht, ob diese Hypothese durch die Daten bestätigt wird und welche Bildspenderbereiche in beiden Medien bevorzugt werden. Die Ergebnisse zeigen den Einfluss des Adressatenkreises auf den Metapherngebrauch in der Sportberichterstattung auf.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Korpus der Arbeit besteht aus 18 Handball-Spielberichten der Saison 2002/2003 aus der Kieler Nachrichten (Tageszeitung) und der Handballwoche (Fachzeitschrift).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Metapher, Sportberichterstattung, Handball, Tageszeitung, Fachzeitschrift, Bildspender, Lexikalisierung, Okkasionelle Metapher, Phraseologismus, Kognitive Linguistik, Lakoff & Johnson, Adressatenkreis, Kommunikative Funktion.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Metapherntheorie, ein Kapitel zu Funktionen und Leistungen von Metaphern, ein Kapitel zu metaphorischen Einheiten, ein Kapitel zum Sportbericht in Tages- und Fachzeitschriften und ein Kapitel zur Analyse des Korpusmaterials. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Literaturverzeichnis.
- Quote paper
- Sina Bröcker (Author), 2004, Zum Metapherngebrauch bei der Sportberichterstattung in Printmedientexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31161