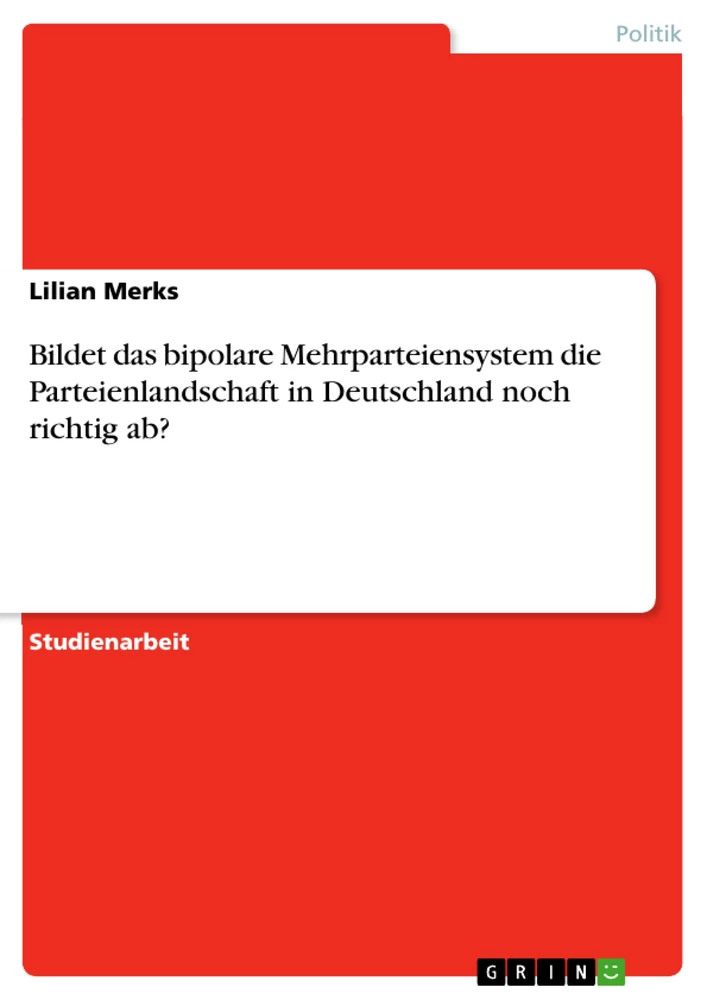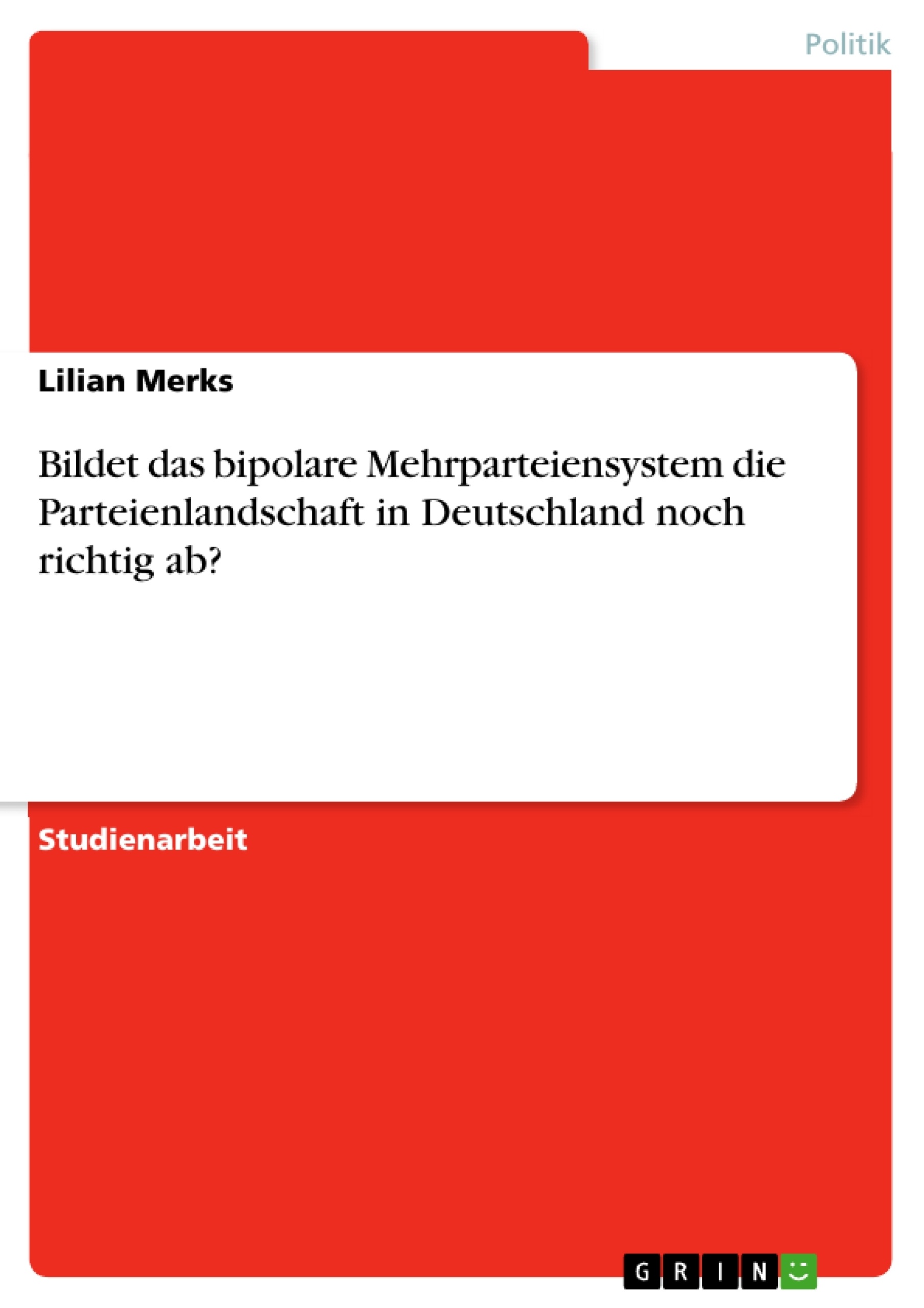In den vergangenen Wahljahren gab es besonders durch den Einzug der Grünen in den Bundestag im Jahr 1983 und den Einzug der Linken im Jahr 1998 immer deutlicher auftretende Veränderungen in der deutschen Parteienlandschaft. Inwieweit der Eintritt neuer kleinerer Parteien die Rolle der beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD beeinflusst und dadurch die deutsche Parteienlandschaft umstrukturiert, beziehungsweise gar das Parteiensystem weg vom jahrelang anhaltenden bipolaren Mehrparteiensystem verändert, soll in der folgenden Arbeit untersucht werden.
Eine logische Konsequenz des Erstarkens neuer Parteien, ist die Schwächung bereits existierender Parteien. Besonders seit den Wahlergebnissen im Jahr 2009, als die SPD ihr schlechtestes Wahlergebnis und die CDU/CSU ihr zweitschlechtestes Ergebnis erleben mussten und beide Parteien mit nur 61,9% kumulativ ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren haben, scheint die Frage mehr als berechtigt, ob die beiden großen Parteien ihre jeweiligen polaren Position weiterhin halten können. Um diese Fragestellung vollständig beantworten zu können, bedarf es einer Vielzahl an Untersuchungen unterschiedlicher Wirkungszusammenhänge, auf welche in dieser Arbeit nicht vollständig im Detail eingegangen werden kann.
Der Fokus der Arbeit liegt auf der Darstellung ausgewählter Veränderungen im deutschen Parteiensystem, die auf den ersten Blick nicht immer sichtbar sind. Ebenfalls beschäftigt sich diese Arbeit mit den möglichen Gründen für diese Veränderungen. Anhand von verschiedenen Vergleichen wird schlussfolgernd versucht, eine Einschätzung darüber zu geben, ob das bipolare Mehrparteiensystem die deutsche Parteienlandschaft noch richtig abbildet. Der betrachtete Zeitraum für diese Untersuchung wird auf die Jahre 1949 bis 2013 eingeschränkt, wobei ein besonderer Fokus auf die letzten sieben Wahljahre zwischen 1990 bis 2013 gelegt wird.
In der Arbeit wird der Parteiname „die Grünen“ als Bezeichnung für den Zusammenschluss des Bündnis 90 und der Grünen verwendet, sowie der aktuelle Parteiname „die Linke“ für die ehemalige SED bzw. PDS genutzt wird. Ebenfalls werden die Parteien der CSU und CDU in dieser Arbeit als Union zusammengefasst und als eine der beiden großen Parteien angesehen, da sie auf Bundesebene als Vereinigung angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die verschiedenen existierenden Parteiensysteme
- 3. Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949
- 3.1 Grobe, historische Zusammenfassung
- 3.2 Das Verhältnis der beiden großen Parteien zueinander
- 3.3 Die sinkenden Mitgliederzahlen der großen Parteien
- 3.4 Die Bedeutung der Nichtwähler
- 3.5 Ein Exkurs auf die Landesebene
- 4. Mögliche Gründe für die Veränderungen im deutschen Parteiensystem
- 5. Begriffliche Einordnung des deutschen Parteiensystem anhand der eigenen Entwicklung und von Vergleichen mit den Parteiensystemen der USA und der Weimarer Republik
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Veränderungen in der deutschen Parteienlandschaft und die Frage, ob das bipolare Mehrparteiensystem die aktuelle Situation noch adäquat abbildet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seit 1949, insbesondere seit 1990, mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses kleinerer Parteien auf die beiden großen Parteien (CDU/CSU und SPD).
- Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949
- Einfluss kleinerer Parteien auf das Zweiparteiensystem
- Vergleich des deutschen Parteiensystems mit anderen Systemen (USA, Weimarer Republik)
- Analyse der Mitgliederentwicklung der großen Parteien
- Bedeutung der Nichtwähler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht, inwieweit das Erstarken kleinerer Parteien (wie die Grünen und die Linke) das deutsche Parteiensystem, traditionell als bipolares Mehrparteiensystem charakterisiert, verändert hat. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seit 1949, besonders nach 1990, und analysiert die Auswirkungen auf die beiden großen Parteien, CDU/CSU und SPD, insbesondere vor dem Hintergrund deren schlechten Wahlergebnisse 2009. Die Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte Veränderungen und deren mögliche Ursachen, und vergleicht das deutsche System mit anderen Modellen.
2. Die verschiedenen existierenden Parteiensysteme: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Parteiensysteme, beginnend mit dem Einparteiensystem, welches in Deutschland durch das Grundgesetz ausgeschlossen ist. Es beschreibt das Zweiparteiensystem, wie es beispielsweise in den USA und Großbritannien vorkommt, und das Mehrparteiensystem, dem das deutsche System zugeordnet wird. Es wird das Zweieinhalbparteiensystem als eine Variante des Mehrparteiensystems erläutert, in dem zwar zwei große Parteien dominieren, aber eine dritte Partei entscheidenden Einfluss auf die Regierungsbildung hat. Das Kapitel liefert so einen theoretischen Rahmen für die Analyse des deutschen Systems.
3. Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des deutschen Parteiensystems. Es analysiert das Verhältnis der beiden großen Parteien zueinander, die sinkenden Mitgliederzahlen der großen Parteien und die Bedeutung der Nichtwähler. Es untersucht auch die Entwicklung auf Landesebene. Der Schwerpunkt liegt auf der Veränderung der Parteienlandschaft durch den Aufstieg neuer Parteien und deren Auswirkungen auf das traditionelle Zweiparteiensystem. Die Analyse bezieht Daten von Bundestagswahlen von 1949 bis 2013 ein.
4. Mögliche Gründe für die Veränderungen im deutschen Parteiensystem: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für die beobachteten Veränderungen im deutschen Parteiensystem. Es untersucht mögliche Ursachen für das Erstarken kleinerer Parteien und den Rückgang der Mitgliederzahlen der großen Parteien. Die Analyse berücksichtigt gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Faktoren, die die Entwicklung des Parteiensystems beeinflusst haben könnten. Die Untersuchung bietet mögliche Erklärungen für die Verschiebungen in der Machtbalance.
5. Begriffliche Einordnung des deutschen Parteiensystem anhand der eigenen Entwicklung und von Vergleichen mit den Parteiensystemen der USA und der Weimarer Republik: Dieses Kapitel ordnet das deutsche Parteiensystem anhand seiner eigenen Entwicklung und im Vergleich zu den Parteiensystemen der USA und der Weimarer Republik ein. Durch den Vergleich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich. Dies dient dazu, das deutsche System besser zu verstehen und seine Besonderheiten herauszustellen. Der Vergleich mit dem Zweiparteiensystem der USA und dem instabilen Mehrparteiensystem der Weimarer Republik soll helfen, die aktuelle Situation im deutschen Parteiensystem einzuordnen.
Schlüsselwörter
Bipolares Mehrparteiensystem, Deutschland, Parteiensystem, CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke, Bundestagswahlen, Mitgliederzahlen, Nichtwähler, Zweiparteiensystem, Mehrparteiensystem, USA, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Seminararbeit: Entwicklung des deutschen Parteiensystems
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Veränderungen im deutschen Parteiensystem und die Frage, ob das bipolare Mehrparteiensystem die aktuelle Situation noch adäquat beschreibt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seit 1949, insbesondere seit 1990, mit besonderem Augenmerk auf dem Einfluss kleinerer Parteien auf die großen Parteien (CDU/CSU und SPD).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949, den Einfluss kleinerer Parteien auf das Zweiparteiensystem, einen Vergleich mit anderen Systemen (USA, Weimarer Republik), die Analyse der Mitgliederentwicklung der großen Parteien und die Bedeutung der Nichtwähler.
Welche Parteiensysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche Parteiensystem mit dem Zweiparteiensystem der USA und dem Mehrparteiensystem der Weimarer Republik. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt, um das deutsche System besser zu verstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, verschiedene existierende Parteiensysteme, Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949, mögliche Gründe für Veränderungen, Einordnung des deutschen Parteiensystems durch Vergleich und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Entwicklung und des Charakters des deutschen Parteiensystems.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit 1949, mit besonderem Fokus auf die Zeit nach 1990. Die Analyse bezieht Daten von Bundestagswahlen von 1949 bis 2013 ein.
Welche Rolle spielen kleinere Parteien?
Die Arbeit untersucht den Einfluss kleinerer Parteien wie die Grünen und die Linke auf das deutsche Parteiensystem und ihre Auswirkungen auf die beiden großen Parteien (CDU/CSU und SPD). Das Erstarken dieser Parteien ist ein zentraler Aspekt der Analyse.
Welche Faktoren werden für die Veränderungen im Parteiensystem analysiert?
Die Arbeit analysiert gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Faktoren, die die Entwicklung des Parteiensystems beeinflusst haben könnten, um mögliche Ursachen für das Erstarken kleinerer Parteien und den Rückgang der Mitgliederzahlen der großen Parteien zu erklären.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, inwieweit das bipolare Mehrparteiensystem die aktuelle Situation im deutschen Parteiensystem noch adäquat abbildet. Die detaillierte Schlussfolgerung ist im Fazit der Arbeit nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bipolares Mehrparteiensystem, Deutschland, Parteiensystem, CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke, Bundestagswahlen, Mitgliederzahlen, Nichtwähler, Zweiparteiensystem, Mehrparteiensystem, USA, Weimarer Republik.
- Quote paper
- Lilian Merks (Author), 2015, Bildet das bipolare Mehrparteiensystem die Parteienlandschaft in Deutschland noch richtig ab?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311498