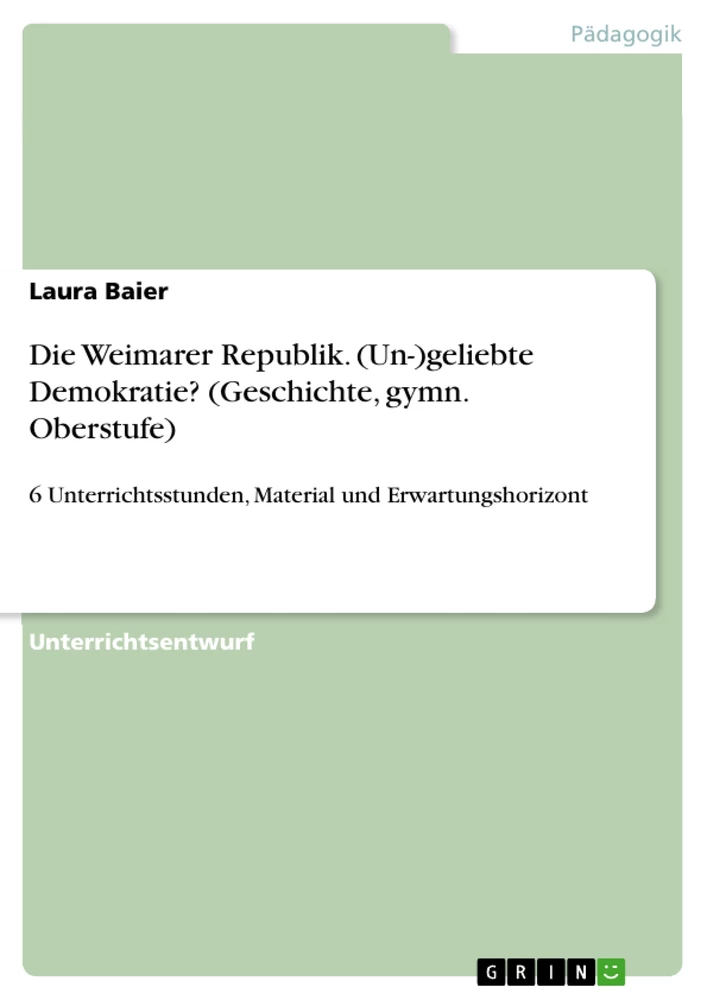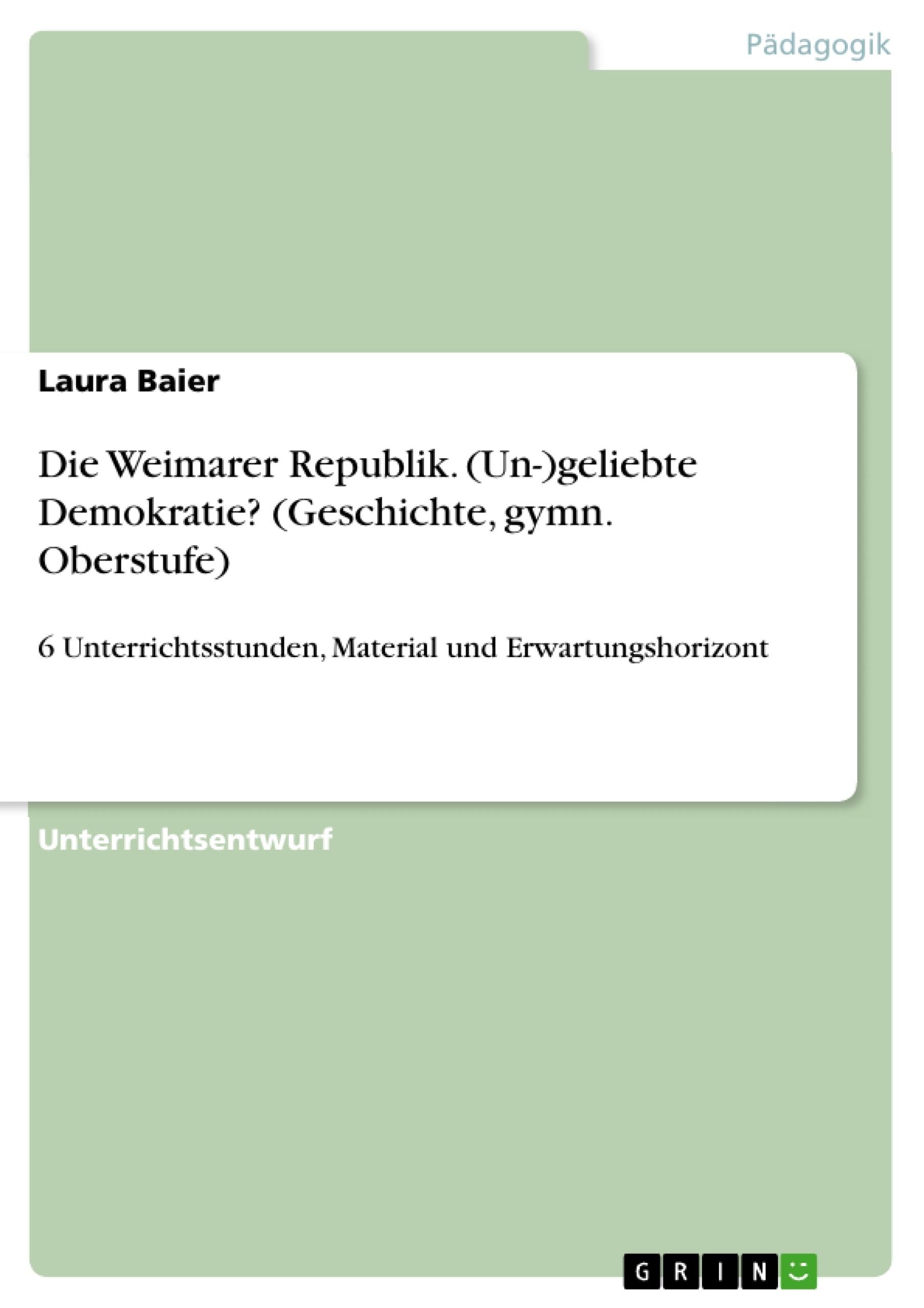Der Themenkomplex zur Frühphase der Weimarer Republik lässt sich im Hinblick auf die Einordnung in curriculare Vorgaben im Bremer Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geschichte für die Qualifikationsphase unter dem Punkt „Q2 Das Zeitalter der Extreme- Totalitarismus und Demokratie“ einordnen. Dort ist zu lesen: „Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Auseinandersetzungen um den Aufbau neuer gesellschaftlicher und politischer Ordnungen sowie die Tatsache, dass sich nach dem Aufschwung der Demokratie autoritäre und diktatorische Ordnungen in vielen Ländern durchsetzen.“ Damit ist die Weimarer Republik zentrale Weichenstellung für das Verständnis von Demokratie und Parlamentarismus von heute.
Aus schulischer Beschäftigung waren vornehmlich der Versailler Vertrag und das Scheitern der Weimarer Republik in Erinnerung. Als gute Hilfestellung zur Wissensauffrischung stellte sich u.a. das Handbuch „Weimarer Republik. 1929-33“ aus der Reihe Geschichte kompakt heraus, das schnell und übersichtlich Einblick in zentrale Ereignisse und Wendepunkte der Endphase der Weimarer Republik gibt und grundlegende historische (Er-)Kenntnisse zusammenstellt. Knapp und zugleich umfassend analysiert Gunther Mai in „Die Weimarer Republik“ aus der Reihe C.H. Beck Wissen drei Zeitabschnitte, in denen er besonderen Wert auf Modernisierungskonflikte legt. Zunächst nimmt er „Revolution und Konterrevolution“ (1918-1923/24) in den Blick, dann „Scheinblüte und Desorientierung“ (1924-1939) und schließlich „Zerfall und Zerstörung“ (1939-1933) bis hin zu „Machtergreifung“ und „Führerstaat“ (1933/34). In den drei ersten Abschnitten wird festgestellt, dass die Weimarer Republik häufig nur als Negativfolie für die heutige Demokratie bzw. als Vorgeschichte des Nationalsozialismus und die Frage, wie man einen neuen Nationalsozialismus verhindern könne, steht. Der ersten deutschen Demokratie ist allerdings neben finanziellen Belastungen durch die Reparationen und dem Rückgriff auf Beamte aus dem Kaiserreich zuzugestehen, dass die „Erfüllungspolitik“ instrumentalisiert wurde und der Aussöhnungskurs mit Frankreich in die Wege geleitet war. Doch eine Demokratie braucht Demokraten, die deren Werte verinnerlichen, und gesellschaftlicher Wandel benötigt Zeit. Dieser Wandel kam in zwei Punkten zum Tragen. Erstens war die Weimarer Republik eine Demokratie und zweitens galten die demokratischen Rechte für alle Staatsbürger. Gerade wegen großer Schwierigkeiten und ihrem Scheitern bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachanalyse des Lerngegenstands: Weimarer Republik- (Un-)Geliebte Demokratie?
- Didaktische Analyse
- Detailplanung der Stundenkurzentwürfe (6)
- Material
- Erwartungshorizont
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Frühphase der Weimarer Republik, beleuchtet deren Herausforderungen und untersucht, inwieweit die Verfassung zum Scheitern der ersten deutschen Demokratie beitrug. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem gängigen Narrativ vom unvermeidlichen Scheitern und der Berücksichtigung alternativer Perspektiven.
- Der Zusammenbruch des Kaiserreichs und die Novemberrevolution von 1918
- Der Versailler Vertrag und seine Auswirkungen auf die Weimarer Republik
- Die Weimarer Verfassung und ihre strukturellen Schwächen
- Gefährdungen der Weimarer Republik durch extremistische Kräfte
- Die Weltwirtschaftskrise von 1929 und der Aufstieg der NSDAP
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Weimarer Republik ein und ordnet es in den Kontext des Bremer Bildungsplans ein. Es werden relevante historische Werke und Forschungsansätze zur Weimarer Republik vorgestellt und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise des Themas betont. Die Weimarer Republik wird als ein "demokratisches Experiment" dargestellt, das trotz zahlreicher Schwierigkeiten und letztlichen Scheiterns wertvolle Lehren für das Verständnis heutiger Demokratien bietet.
Sachanalyse des Lerngegenstands: Weimarer Republik- (Un-)Geliebte Demokratie?: Dieses Kapitel analysiert die gängige Geschichtswissenschaftliche Interpretation der Weimarer Republik, die oft auf das Scheitern und die Ursachen des Aufstiegs des Nationalsozialismus fokussiert. Es wird jedoch auch auf alternative Perspektiven hingewiesen, die das „demokratische Experiment“ nicht als von vornherein zum Scheitern verurteilt darstellen. Der Fokus liegt auf den Belastungen der jungen Republik, wie den Kriegsfolgen (Versailler Vertrag), der Elitenkontinuität (Ebert-Gröner-Bündnis) und den Verfassungsmängeln, die die Krise zuspitzten. Trotzdem wird die Bedeutung der Weimarer Republik als Weichenstellung für Demokratie und Parlamentarismus hervorgehoben, sowie aktuelle Forschungstendenzen und Desiderate diskutiert. Die Novemberrevolution und der Versailler Vertrag werden als zentrale Ereignisse der Frühphase beschrieben und deren Interpretationen kritisch beleuchtet.
Didaktische Analyse: Dieser Abschnitt befasst sich mit der didaktischen Aufbereitung des Themas für den Unterricht. Es werden historische Parallelen zwischen der Weimarer Republik und der aktuellen Lage in Griechenland gezogen, um einen Gegenwartsbezug für die Schüler herzustellen. Die Bedeutung der Weimarer Republik als "historische Scharnierfunktion" für das Verständnis der nationalsozialistischen Diktatur wird unterstrichen. Der Abschnitt skizziert die inhaltliche Gliederung des geplanten Unterrichts und die Auswahl wichtiger Schlüsselereignisse.
Schlüsselwörter
Weimarer Republik, Novemberrevolution, Versailler Vertrag, Weimarer Verfassung, Demokratie, Parlamentarismus, Nationalsozialismus, Extremismus, Weltwirtschaftskrise 1929, Ebert-Gröner-Bündnis, Politische Bildung, Demokratisierungsprozesse, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Weimarer Republik - (Un-)Geliebte Demokratie?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Frühphase der Weimarer Republik, ihre Herausforderungen und untersucht den Beitrag der Verfassung zum Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Sie hinterfragt das gängige Narrativ vom unvermeidlichen Scheitern und berücksichtigt alternative Perspektiven. Ein besonderer Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der gängigen Interpretation und der Einordnung in den Bremer Bildungsplan.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zusammenbruch des Kaiserreichs und die Novemberrevolution von 1918, den Versailler Vertrag und seine Folgen, die Weimarer Verfassung und ihre strukturellen Schwächen, die Gefährdungen durch extremistische Kräfte, die Weltwirtschaftskrise von 1929 und den Aufstieg der NSDAP. Es werden auch aktuelle Forschungstendenzen und Desiderate diskutiert sowie historische Parallelen zur aktuellen Lage in Griechenland gezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Sachanalyse der Weimarer Republik, eine didaktische Analyse, detaillierte Stundenkurzentwürfe (6 Stück, im Text nicht explizit aufgeführt), Materialangaben und einen Erwartungshorizont. Die Einleitung ordnet das Thema in den Kontext des Bremer Bildungsplans ein und stellt relevante historische Werke und Forschungsansätze vor. Die Sachanalyse untersucht gängige und alternative Interpretationen des Scheiterns der Republik. Die didaktische Analyse befasst sich mit der didaktischen Aufbereitung des Themas für den Unterricht und dem Bezug zur Gegenwart.
Wie wird die Weimarer Republik dargestellt?
Die Weimarer Republik wird als ein „demokratisches Experiment“ dargestellt, das trotz Scheitern wertvolle Lehren für heutige Demokratien bietet. Die Arbeit hinterfragt die einseitige Fokussierung auf das Scheitern und berücksichtigt die Belastungen der jungen Republik (Kriegsfolgen, Elitenkontinuität, Verfassungsmängel), hebt aber gleichzeitig ihre Bedeutung als Weichenstellung für Demokratie und Parlamentarismus hervor.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Weimarer Republik, Novemberrevolution, Versailler Vertrag, Weimarer Verfassung, Demokratie, Parlamentarismus, Nationalsozialismus, Extremismus, Weltwirtschaftskrise 1929, Ebert-Gröner-Bündnis, Politische Bildung, Demokratisierungsprozesse und Verfassungsrecht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik ab, die über die gängige Interpretation hinausgeht und alternative Perspektiven berücksichtigt. Sie soll zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge und der Herausforderungen für junge Demokratien beitragen und didaktische Vorschläge für den Unterricht liefern.
- Quote paper
- Laura Baier (Author), 2014, Die Weimarer Republik. (Un-)geliebte Demokratie? (Geschichte, gymn. Oberstufe), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311358