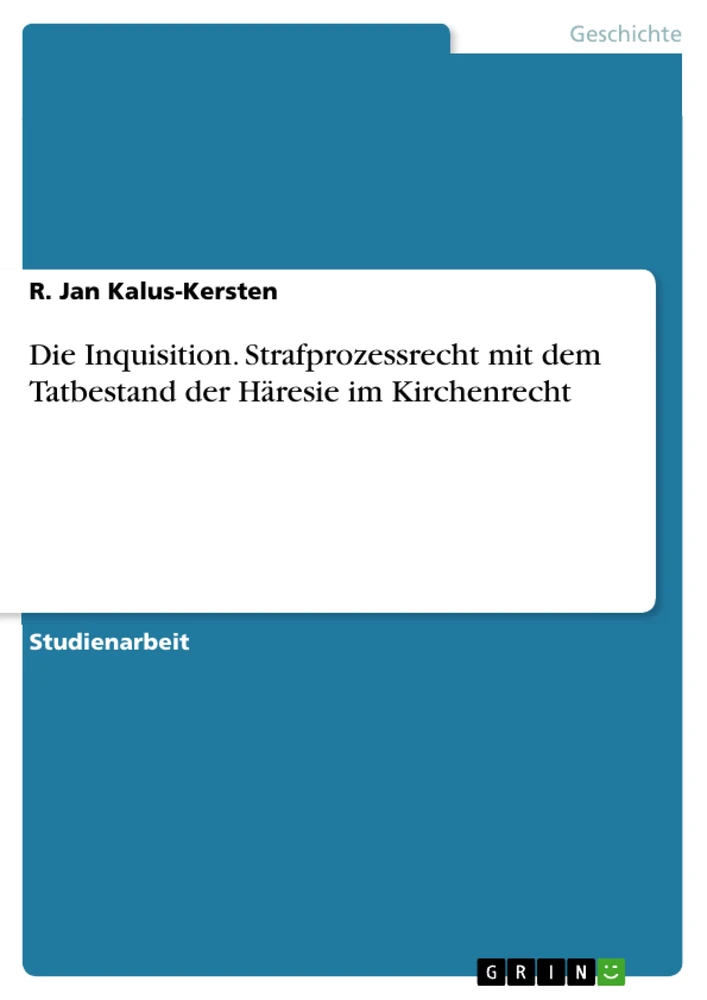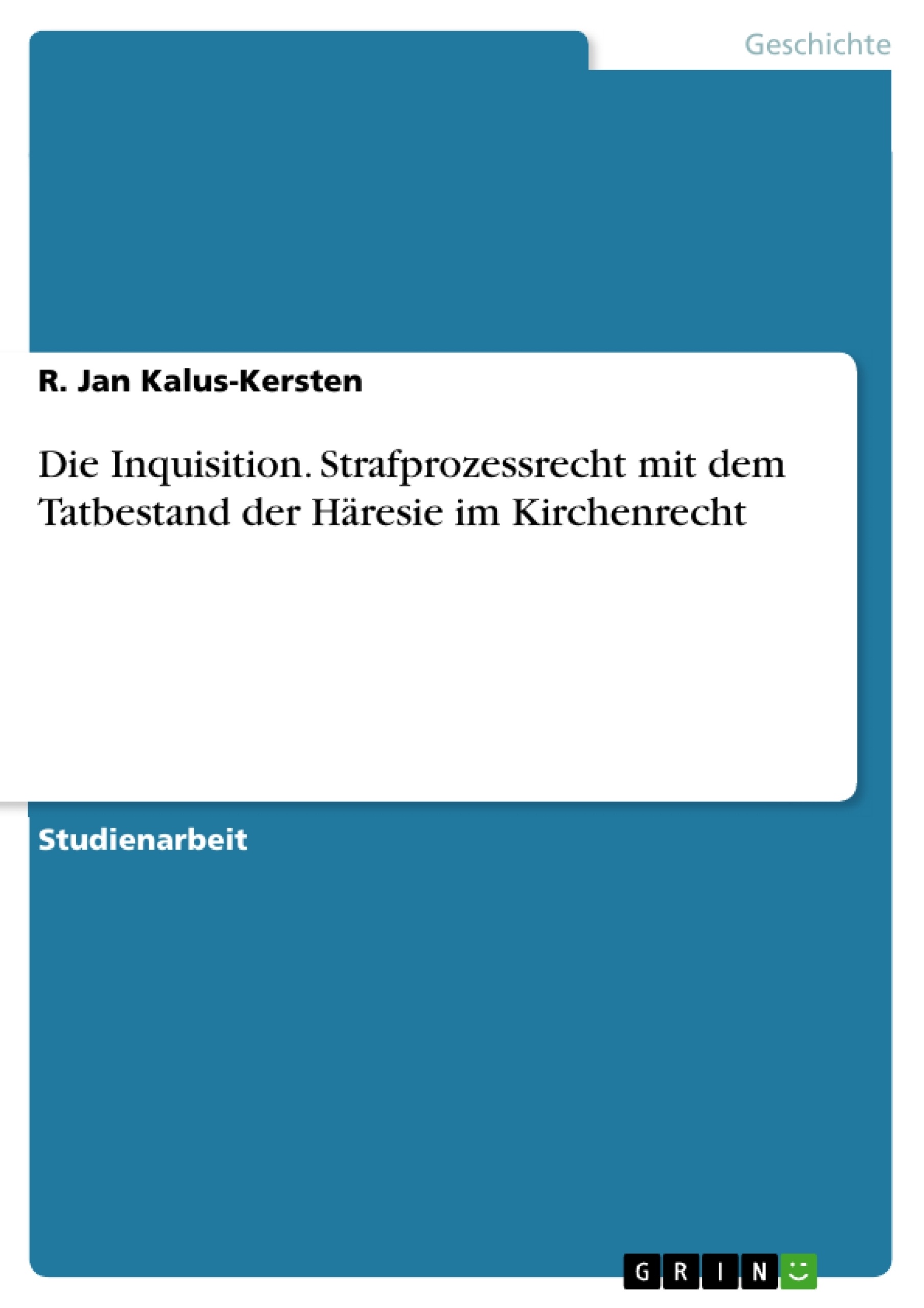Wenige hinterfragen Beweggründe, Ursachen und Wirkungen der Inquisition oder anders formuliert, was war die Inquisition? Was war die Aufgabe dieser Institution? Diente sie ausschließlich zum Machterhalt der Jurisdiktionsgewalt des Papstes? Würde man die Fragen weiter verfolgen, neue stellen oder vertiefen, wird einem deutlich, das die Inquisition sowohl als Institution als auch als Substitut zur Regulierung von Interpretationen der Heiligen Schrift als auch zur Glaubenskonformität, weitaus mehr beinhaltete und nach institutionellen Vorbild eine Dauer benötigte, um dieses Instrument religiöser und politischer „Gerichtsbarkeit“ zu werden.
Hierfür ist notwendig, dass man die Fragen nach rechtlicher Legitimation, nach strafrechtlicher Definition, Kumulationen innerhalb der Tatbestände sowie nach der Verfahrensweise stellt. Ähnlich wie im heutigen Strafprozessrecht, musste ein Tatbestand bestehen, um Anklage erheben zu können. Daher ist es im besonderen Maße notwendig, dass ein Tatbestand definitorisch erfasst ist. Denn sowohl Verfahrensweise als auch die Definition für eine strafrechtliche Verfolgung von Tatbeständen, sind im Verlauf des Mittelalters immer durch Anwendung geprägt, folglich durch regionale und situative Gegebenheiten, nicht durch allgemeine Festlegung. Im Inquisitionsverfahren muss der Tatbestand der Häresie vermutet werden, doch dieser musste definiert sein, um einen rechtsgültigen Charakter zum Tatbestand aufweisen zu können sowie die Differenzierungen nach Schwere der Tat, um dementsprechend ein Strafmaß festlegen zu können. Im Vergleich zu anderen Verfahrensarten im Mittelalter, wies das Inquisitionsverfahren gewissen Neuerungen auf, daher wird der Inquisitionsprozess und die Frage nach dem Inhalt und Verfahrensweg den Kern dieser Arbeit ausmachen, da eine Abgrenzung zu den anderen Verfahrensarten wie dem Akkusations- und Infamationsprozess notwendig ist, um die Innovation darzustellen sowie die spätere Institutionalisierung als Amt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. KIRCHENRECHT UND GEMEINES RECHT
- 1.1 ENTWICKLUNG DES KIRCHENRECHTS
- 1.2 GEIMEINRECHT
- 1.3 UNTERSCHIED ZWISCHEN KIRCHENRECHT UND GEMEINRECHT
- II. DER TATBESTAND DER HÄRESIE
- 2.1 ABLEITUNG UND DEFINITION DES TATBESTANDES
- 2.2 DAS CRIMEN LAESAE MAIESTATIS-PRINZIP
- 2.3 KETZERVERFOLGUNG DURCH DIE WELTLICHE AUTORITÄT
- 2.4 QUALITÄTSBESTIMMUNG DER HÄRESIE
- III. GERICHTLICHE VERFAHRENSWEISEN ZUR ERMITTLUNG DER SCHULD
- 3.1 DAS AKKUSATIONSVERFAHREN
- 3.2 DAS INFAMATIONSVERFAHREN
- 3.3 DER INQUISITIONSPROZESS
- 3.4 DER INQUISITIONSPROZESS UNTER DEM TATVERDACHT DER HÄRESIE
- 3.5 DIE INQUISITOREN
- 3.6 WEITERE ENTWICKLUNG
- SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Begriffs der Häresie und die damit verbundenen Gerichtsverfahren im Mittelalter. Sie befasst sich mit der rechtlichen Legitimation der Inquisition, der Definition des Tatbestandes der Häresie und den verschiedenen Verfahrensweisen, die zur Ermittlung der Schuld angewendet wurden.
- Entwicklung des Kirchenrechts und des Gemeinrechts im Mittelalter
- Definition des Tatbestandes der Häresie und des CRIMEN LAESAE MAIESTATIS-Prinzips
- Verfahrensweisen im Mittelalter, insbesondere der Inquisitionsprozess im Vergleich zum Akkusations- und Infamationsprozess
- Die Rolle der Inquisitoren und die Entwicklung der Inquisition als Institution
- Legitimation und Aufgabenbereich der Inquisition im Kontext der kirchlichen und weltlichen Machtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Inquisition ein und erläutert die Notwendigkeit, die Beweggründe, Ursachen und Wirkungen dieser Institution zu hinterfragen. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar, die sich auf die rechtliche Legitimation, die strafrechtliche Definition der Häresie, die Verfahrensweisen und die Rolle der Inquisition als Instrument religiöser und politischer „Gerichtsbarkeit“ konzentrieren.
Kapitel I behandelt die Entwicklung des Kirchenrechts und des Gemeinrechts im Mittelalter. Es werden die Quellen des Kirchenrechts und die Bedeutung der Konzilien, Synodialbeschlüsse und Schriften der Kirchenväter erläutert. Die Systematisierung des Kirchenrechts durch Gratian und die Entstehung des Corpus iuris canonici werden beschrieben.
Kapitel II befasst sich mit der Definition des Tatbestandes der Häresie und der Rolle des CRIMEN LAESAE MAIESTATIS-Prinzips. Die Abgrenzung von Häresie im Kirchenrecht und Majestätsverbrechen im Gemeinrecht wird dargestellt. Die Bedeutung des Dekrets Vergentis in senium von Innozenz III. für die Formalisierung des Inquisitionsprozesses wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Kirchenrecht, Gemeinrecht, Häresie, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS, Inquisition, Inquisitionsprozess, Akkusationsverfahren, Infamationsprozess, Inquisitoren, Legitimation, Tatbestand, Strafrecht, mittelalterliche Rechtsgeschichte.
- Quote paper
- R. Jan Kalus-Kersten (Author), 2014, Die Inquisition. Strafprozessrecht mit dem Tatbestand der Häresie im Kirchenrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311355