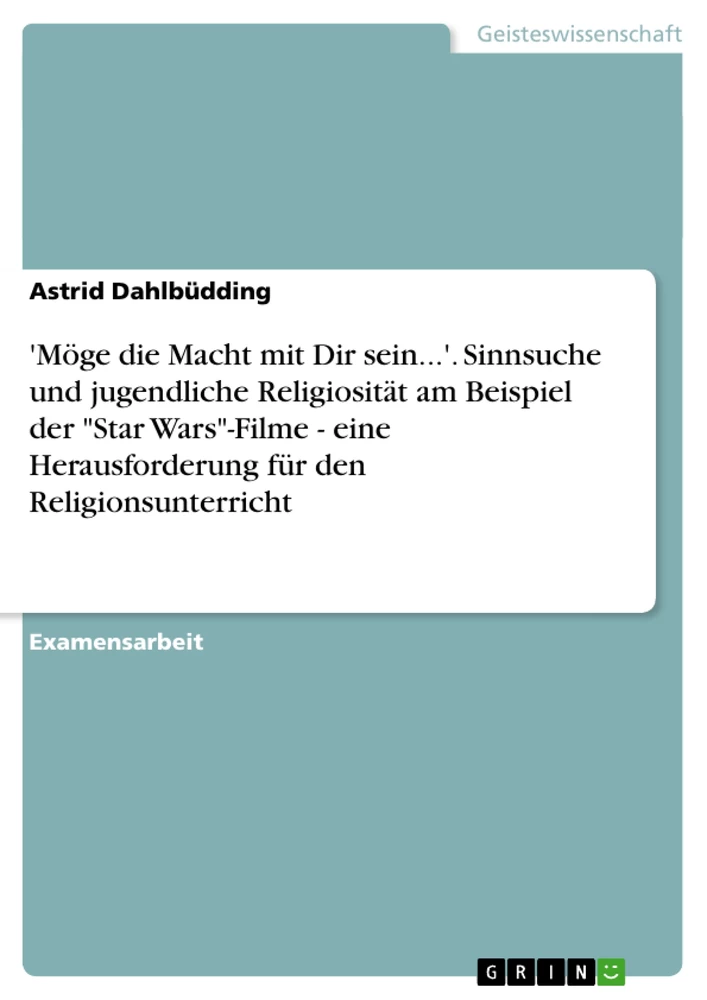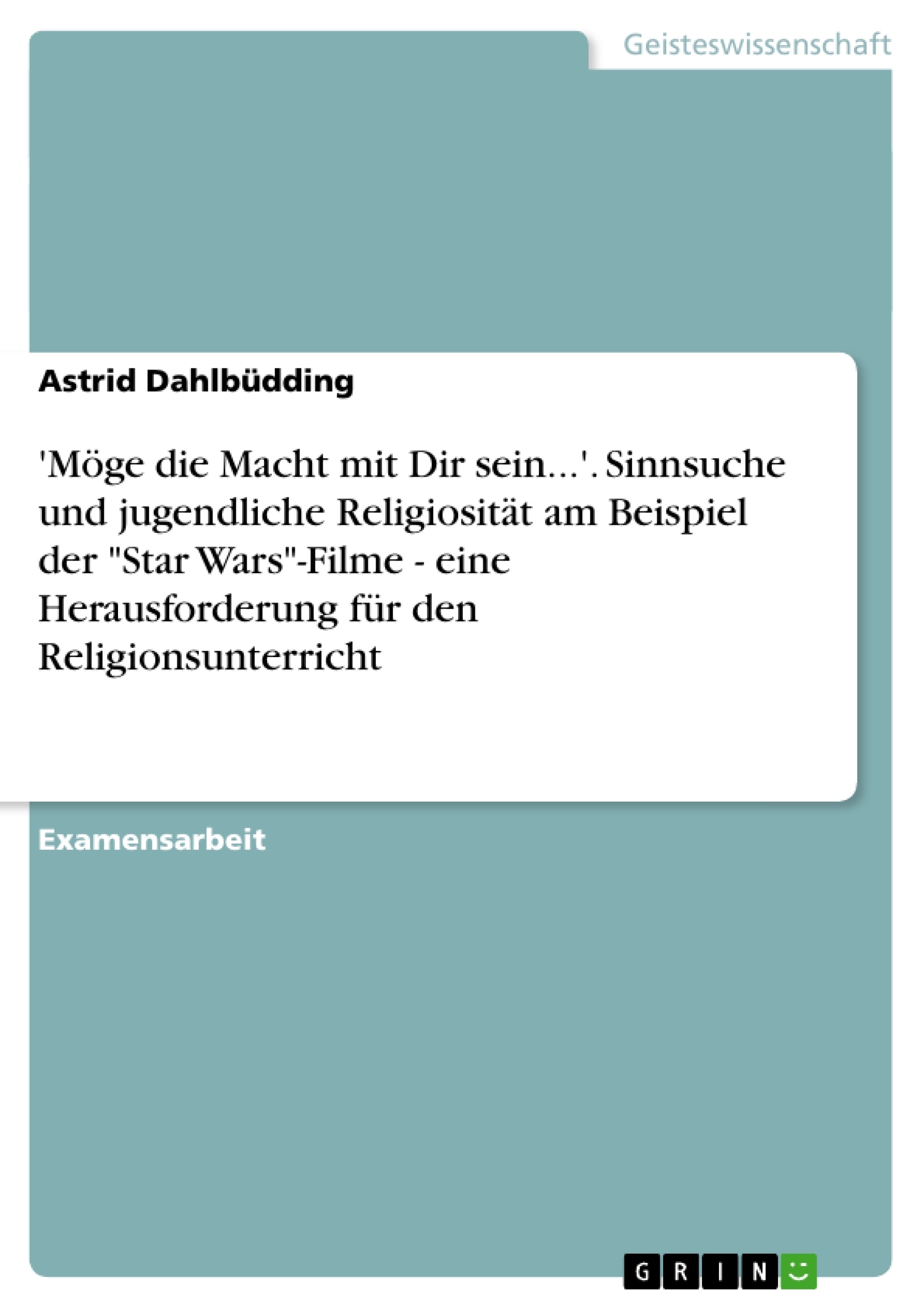“Die Religion der Zukunft wird Kino sein und in Hollywood produziert.”
Diese These des Filmkritikers Georg Seeßlen aus einem Artikel des Jahres 2000 lässt aufhorchen. Das Kino soll in Zukunft die Kirche ersetzen? Viele werden diese Behauptung als übertrieben abtun. Natürlich gibt es religiöse Aspekte im Kinofilm, das zeigt sich nicht zuletzt an den aktuellen Diskussionen über den spirituellen Charakter der Filmreihen „Der Herr der Ringe“ oder „Die Matrix“. Aber wird dadurch die traditionelle Religion verdrängt? Die meisten Theologen werden dies wahrscheinlich verneinen, da sie sich der traditionellen Verankerung ihres Glaubens sicher sind.
Hier bietet es sich an einen Blick nach England zu werfen. Dort stellte die jährliche Volkszählung im Jahr 2001 über 390.000 Einwohner fest, die sich zur „Religion“ der „Jedi Ritter“ bekannten. Die Idee dieser „Religion“ basiert auf dem sechsteiligen Science-Fiction-Epos „Star Wars“, das in Deutschland auch „Krieg der Sterne“ genannt wird. „Jedi-Ritter“ sind in dieser Filmreihe die, mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestatteten, Krieger des Guten.
Die Geschichte der Filme stammt von dem amerikanischen Filmregisseur George Lucas. Die ersten drei Filme der Reihe liefen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre überaus erfolgreich in den Kinos. Ende der 90er Jahre kamen sie, an Grafik und Klang überarbeitet, erneut in die Lichtspielhäuser und bildeten den Auftakt für eine weitere Trilogie, die 1999 mit der ersten Episode startete und deren letzter Teil noch erwartet wird. Wie in den 70ern und 80ern wurden die Filme auch heute wieder zum Kinomagneten. Dieser erneute Boom war Auslöser für eine E-Mail, die im Internet kursierte und Engländer dazu aufforderte, auf ihrem Bogen zur Volkszählung den Begriff „Jedi Ritter“ an Stelle einer offiziellen Religion anzugeben. Laut dieser Mail seien 10.000 Unterschriften ausreichend, um diese Religion als staatlich akzeptiert durchzusetzen. Dem war nicht so , doch reichte es aus, um den Fragebogen der folgenden Volkszählung 2001 um die Position „Jedi Ritter“ bei den wählbaren Religionen zu ergänzen. Die Reaktion darauf war, wie schon genannt, eine 390.000fache Wahl dieser „Religion“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sinnsuche und Religiosität im Jugendalter
- 2.1 Die Lebensphase Jugend
- 2.1.1 Ziele und Dauer des Jugendalters
- 2.1.2 Einflussfaktoren in der Jugendphase
- 2.2 Sinnsuche und Religiosität als Aspekte jugendlicher Sozialisation
- 2.2.1 Sinnsuche und Religiosität im psychologischen Kontext
- 2.2.2 Sinnsuche und Religiosität im soziologischen Kontext
- 2.3 Jugendliche Religiosität
- 2.1 Die Lebensphase Jugend
- 3. Die Star-Wars-Hexalogie
- 3.1 Wichtige Begriffe
- 3.1.1 Die Macht
- 3.1.2 Die Jedi-Ritter
- 3.1.3 Der Imperator
- 3.1.4 Der Todesstern
- 3.2 Figuren der Star-Wars-Hexalogie
- 3.2.1 Die Skywalker-Genealogie
- 3.2.2 Weitere Filmfiguren
- 3.3 Inhaltsangaben Episode I – Episode VI
- 3.3.1 Episode I - Die dunkle Bedrohung
- 3.3.2 Episode II – Angriff der Klonkrieger
- 3.3.3 Episode III - Titel noch unbekannt
- 3.3.4 Episode IV - Eine neue Hoffnung
- 3.3.5 Episode V - Das Imperium schlägt zurück
- 3.3.6 Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
- 3.1 Wichtige Begriffe
- 4. Die konstruierte Sinnwelt der Star-Wars-Saga
- 4.1 Exkurs: Das Kino als spiritueller Kultort
- 4.2 Star-Wars als Heldenreise
- 4.2.1 Trennung
- 4.2.2 Initiation
- 4.2.3 Rückkehr
- 4.2.4 Der Monomythos als Allegorie jugendlicher Entwicklung
- 4.3 Der dualistische Aufbau der Star-Wars-Hexalogie
- 4.3.1 Figurenpaare
- 4.3.2 Natur und Technik
- 4.3.3 Leib und Seele
- 4.3.4 Die Macht
- 4.3.5 Handlungsperspektiven in einer zweidimensionale Welt
- 4.4 Die bildliche Darstellung der Figuren
- 4.4.1 Figuren der dunklen Seite der Macht
- 4.4.2 Figuren der hellen Seite der Macht
- 4.4.3 Exkurs: Kritisierte Motivwahl
- 4.4.4 Die visuelle Informationsebene
- 4.5 Verwendung christlicher Motive
- 4.5.1 Der Erlöser
- 4.5.2 Die jungfräuliche Empfängnis
- 4.5.3 Die Wüste
- 4.5.4 Das Motiv des abgeschlagenen Arms
- 4.5.5 Tod und Auferstehung
- 4.5.6 Die Saga der gemischten Mythen
- 4.6 Eine Welt zum Staunen
- 5. Die mediale Herausforderung des Religionsunterrichts
- 5.1 Star Wars als Teil der Jugendkultur
- 5.2 Star Wars als Unterrichtsmaterial
- 5.2.1 Klasse 7/8: Nach Gott fragen - Gottesbilder
- 5.2.2 Klasse 9/10: Christsein in der pluralen Gesellschaft
- 5.2.3 Umfang des Einsatzes der Filmreihe
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Star Wars-Saga im Kontext jugendlicher Sinnsuche und Religiosität. Im Fokus steht die Frage, inwiefern die konstruierte Sinnwelt von Star Wars als cineastische Religiosität verstanden werden kann und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich daraus für den Religionsunterricht ergeben.
- Jugendliche Sinnsuche und Religiosität
- Star Wars als narrative Konstruktion einer Sinnwelt
- Die Verwendung religiöser Motive und Symbole in Star Wars
- Star Wars als Phänomen der Jugendkultur
- Didaktische Potenziale und Herausforderungen von Star Wars im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie das Phänomen der "Jedi Ritter" als selbsterklärte Religion in der englischen Volkszählung 2001 beleuchtet. Sie stellt die These auf, dass das Kino eine zunehmende Rolle in der Sinnsuche und Religiosität junger Menschen einnimmt und diskutiert die mögliche "Bedrohung" traditioneller Religionen durch cineastische Erzählungen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Hypothese näher zu untersuchen.
2. Sinnsuche und Religiosität im Jugendalter: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensphase Jugend, ihre Charakteristika und die damit verbundenen Prozesse der Identitätsfindung und Sinnsuche. Es analysiert den Einfluss von sozialen und psychologischen Faktoren auf die Entwicklung religiöser und spiritueller Orientierungen im Jugendalter. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Sinnsuche und Religiosität als zentrale Aspekte jugendlicher Sozialisation.
3. Die Star-Wars-Hexalogie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Star Wars-Filme, ihre zentralen Figuren, die Handlungsstränge und die wichtigsten Symbole. Es beschreibt die mythologische Struktur der Saga und die verschiedenen Welten, die darin dargestellt werden. Die Analyse der einzelnen Episoden wird knapp gehalten, um den Fokus auf die Gesamtstruktur der Hexalogie zu legen.
4. Die konstruierte Sinnwelt der Star-Wars-Saga: Dieses Kapitel analysiert die narrative Struktur und die symbolischen Elemente von Star Wars, um deren Bedeutung im Kontext jugendlicher Sinnsuche zu erörtern. Es untersucht die Parallelen zu klassischen Mythen und Archetypen, insbesondere die Heldenreise und den dualistischen Aufbau der Geschichte. Die Verwendung christlicher Motive und deren Funktion innerhalb der Erzählung werden eingehend betrachtet.
5. Die mediale Herausforderung des Religionsunterrichts: Dieses Kapitel diskutiert die Relevanz von Star Wars als Teil der Jugendkultur und die Möglichkeiten, die Filmreihe im Religionsunterricht einzusetzen. Es skizziert konkrete didaktische Ansätze für verschiedene Altersstufen und geht auf mögliche Schwierigkeiten und ethische Fragen ein.
Schlüsselwörter
Jugendliche Religiosität, Sinnsuche, Star Wars, Cineastische Religiosität, Medienpädagogik, Religionsunterricht, Mythos, Heldenreise, Dualismus, Symbolanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Star Wars-Saga im Kontext jugendlicher Sinnsuche und Religiosität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Star Wars-Saga im Kontext jugendlicher Sinnsuche und Religiosität. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwiefern die fiktive Welt von Star Wars als eine Form von cineastischer Religiosität verstanden werden kann und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für den Religionsunterricht ergeben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Jugendliche Sinnsuche und Religiosität, Star Wars als narrative Konstruktion einer Sinnwelt, die Verwendung religiöser Motive und Symbole in Star Wars, Star Wars als Phänomen der Jugendkultur und die didaktischen Potenziale und Herausforderungen von Star Wars im Religionsunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Sinnsuche und Religiosität im Jugendalter, Die Star-Wars-Hexalogie, Die konstruierte Sinnwelt der Star-Wars-Saga, Die mediale Herausforderung des Religionsunterrichts und Resümee. Jedes Kapitel baut aufeinander auf und vertieft die Thematik schrittweise.
Was wird in Kapitel 2 ("Sinnsuche und Religiosität im Jugendalter") behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die Lebensphase Jugend, ihre Eigenschaften und die damit verbundenen Prozesse der Identitätsfindung und Sinnsuche. Es analysiert den Einfluss sozialer und psychologischer Faktoren auf die Entwicklung religiöser und spiritueller Orientierungen im Jugendalter und konzentriert sich auf die Bedeutung von Sinnsuche und Religiosität als zentrale Aspekte der jugendlichen Sozialisation.
Was wird in Kapitel 3 ("Die Star-Wars-Hexalogie") behandelt?
Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Star Wars-Filme, ihre Hauptfiguren, die Handlungsstränge und die wichtigsten Symbole. Es beschreibt die mythologische Struktur der Saga und die verschiedenen dargestellten Welten. Die Analyse der einzelnen Episoden ist kurz gehalten, um den Fokus auf die Gesamtstruktur der Hexalogie zu legen.
Was ist der Schwerpunkt von Kapitel 4 ("Die konstruierte Sinnwelt der Star-Wars-Saga")?
Kapitel 4 analysiert die narrative Struktur und die symbolischen Elemente von Star Wars, um deren Bedeutung im Kontext jugendlicher Sinnsuche zu untersuchen. Es untersucht Parallelen zu klassischen Mythen und Archetypen, insbesondere die Heldenreise und den dualistischen Aufbau der Geschichte. Die Verwendung christlicher Motive und deren Funktion innerhalb der Erzählung werden eingehend betrachtet.
Welche didaktischen Aspekte werden in Kapitel 5 ("Die mediale Herausforderung des Religionsunterrichts") behandelt?
Kapitel 5 diskutiert die Relevanz von Star Wars als Teil der Jugendkultur und die Möglichkeiten, die Filmreihe im Religionsunterricht einzusetzen. Es skizziert konkrete didaktische Ansätze für verschiedene Altersstufen und geht auf mögliche Schwierigkeiten und ethische Fragen ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendlicher Religiosität, Sinnsuche, Star Wars, Cineastische Religiosität, Medienpädagogik, Religionsunterricht, Mythos, Heldenreise, Dualismus, Symbolanalyse.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass das Kino eine zunehmende Rolle in der Sinnsuche und Religiosität junger Menschen einnimmt und diskutiert die mögliche "Bedrohung" traditioneller Religionen durch cineastische Erzählungen. Die Arbeit hat zum Ziel, diese Hypothese zu untersuchen.
- Quote paper
- Astrid Dahlbüdding (Author), 2004, 'Möge die Macht mit Dir sein...'. Sinnsuche und jugendliche Religiosität am Beispiel der "Star Wars"-Filme - eine Herausforderung für den Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31059