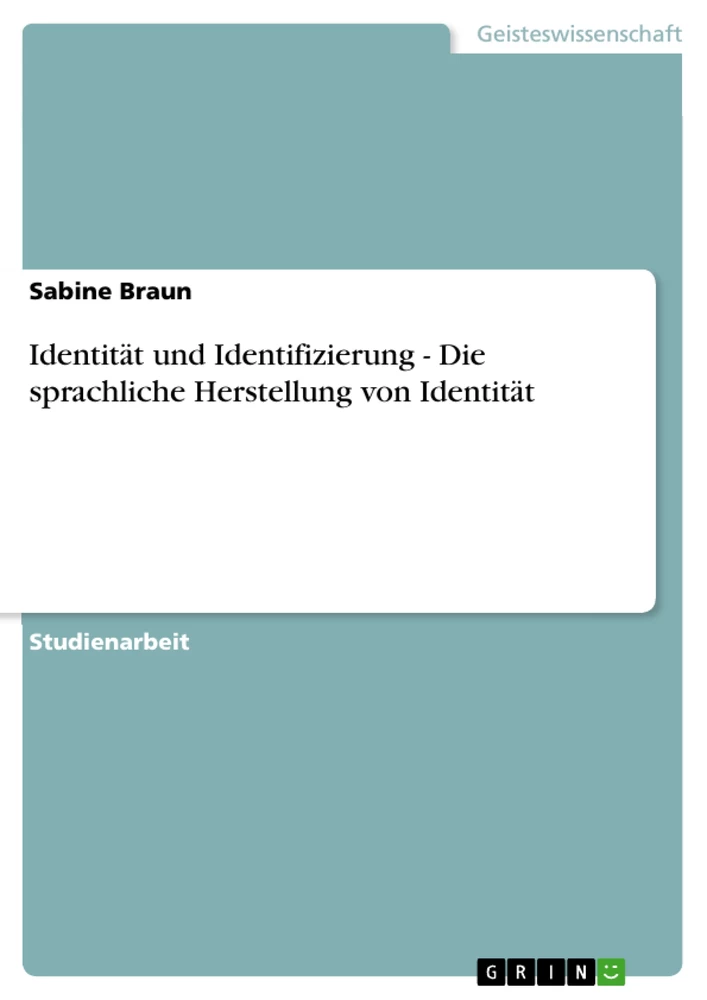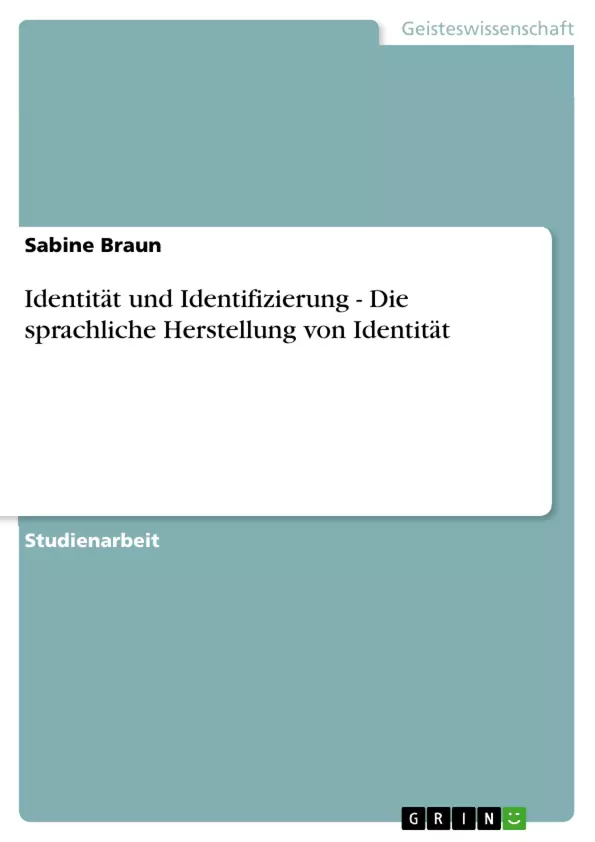„Ich bin ein Berliner!“ verkündete John F. Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, am 23. Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus, und die West-Berliner Massen spendeten dem Mann aus Massachusetts tosenden Applaus – gerade so, als sei er durch diesen Ausspruch wahrhaftig ‘einer von ihnen‘ geworden. Mit dieser mittlerweile historischen verbalen Geste gelang es John F. Kennedy eine Brücke in die Herzen der Bürger West-Berlins zu schlagen, obwohl er diesen Satz sehr wahrscheinlich lediglich als geschickten rhetorischen Schachzug - zumal auf deutsch - in seine Rede eingebaut hatte; ohne Berücksichtigung der komplexen Identitätsdimension, die dieses klare Statement wörtlich genommen beinhaltet hätte. Das führt uns zu der Frage: Was macht eigentlich einen Berliner zum Berliner? Ist es seine Sprache? Sein spezifisches äußeres Erscheinungsbild? Genetische Reinrassigkeit? Oder sind es preußische Tugend und Tradition, über die sich die Berliner definieren? In abstrahierter Form erlangt diese Fragestellung durchaus wissenschaftliche Relevanz: Anhand welcher Kriterien erfolgt die Selbstpositionierung eines Individuums in seinem sozialen Umfeld? Welche Rolle spielt die Sprache bei der Entwicklung sowohl der persönlichen Identität des Einzelnen als auch der Identität einer Gruppe? Auf welche Weise kommen Kategorien wie ‘Gemeinschaft‘, ‘Ethnie‘, ‘Sprache‘ oder ‘Rasse‘ überhaupt zustande? Nach welchen Mustern werden diese Einteilungen vorgenommen?
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Identität und Identifizierung: Die sprachliche Herstellung von Identität
- Diskussionsgrundlage
- Definition des Begriffs 'identifizieren'
- Methodische Abgrenzung gegenüber anderen Soziolinguisten
- Positivismus als zugrunde liegende Weltsicht
- Begriffe zur Kategorienbildung
- Das Prinzip der 'predictability'
- Unmöglichkeit der Definition des Begriffs 'Ethnie'
- Unmöglichkeit der Definition des Begriffs 'Rasse'
- Die Beziehung zwischen ‘Sprache' und '‘Ethnizität‘
- Diskussionsgrundlage
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Schriftfassung untersucht die Rolle der Sprache bei der Herstellung von Identität, sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene. Sie analysiert, wie Kategorien wie 'Gemeinschaft', 'Ethnie', 'Sprache' und 'Rasse' entstehen und welche Muster bei ihrer Bildung befolgt werden.
- Die Bedeutung von Sprache bei der Selbstpositionierung von Individuen in ihrem sozialen Umfeld
- Die Beziehung zwischen individueller Identität und Gruppenidentität
- Die Entstehung von Kategorien wie 'Gemeinschaft', 'Ethnie', 'Sprache' und 'Rasse'
- Die Rolle des Positivismus als theoretische Grundlage der Analyse
- Das Prinzip der 'predictability' als Werkzeug zur Erklärung von Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Sprache bei der Identitätsbildung und führt anhand des Beispiels von John F. Kennedy in Berlin die Komplexität des Themas vor.
Das Kapitel 'Identität und Identifizierung: Die sprachliche Herstellung von Identität' diskutiert die grundlegende Definition des Begriffs 'identifizieren' und geht auf die methodische Abgrenzung gegenüber anderen Soziolinguisten ein. Es stellt den Positivismus als zugrunde liegende Weltsicht vor und analysiert die Begriffe zur Kategorienbildung. Zudem wird das Prinzip der 'predictability' und die Unmöglichkeit der Definition von 'Ethnie' und 'Rasse' erörtert.
Schlüsselwörter
Sprache, Identität, Identifizierung, Ethnie, Rasse, Positivismus, 'predictability', Kategorienbildung, Soziolinguistik, Belize, Caribbean communities, 'Acts of Identity'
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Sprache und Identität zusammen?
Sprache dient als zentrales Werkzeug zur Selbstpositionierung eines Individuums und zur Definition der Zugehörigkeit zu einer sozialen oder ethnischen Gruppe.
Was bewirkte John F. Kennedys Ausspruch „Ich bin ein Berliner“?
Es war eine rhetorische Geste, die eine sofortige Identifikation der West-Berliner mit dem US-Präsidenten schuf, obwohl er kein Berliner im biologischen Sinne war.
Warum sind Begriffe wie „Ethnie“ oder „Rasse“ wissenschaftlich schwer zu definieren?
Die Arbeit argumentiert, dass diese Kategorien oft soziale Konstrukte sind, die sich einer präzisen, allgemeingültigen Definition entziehen.
Was besagt das Prinzip der „predictability“ in der Identitätsbildung?
Dieses Prinzip wird als Werkzeug genutzt, um zu erklären, wie Individuen basierend auf sozialen Erwartungen und Mustern Kategorien bilden.
Welche Rolle spielt der Positivismus in dieser Analyse?
Der Positivismus dient als zugrunde liegende Weltsicht, um die sprachliche Herstellung von Identität methodisch greifbar zu machen.
- Arbeit zitieren
- Sabine Braun (Autor:in), 2000, Identität und Identifizierung - Die sprachliche Herstellung von Identität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3105