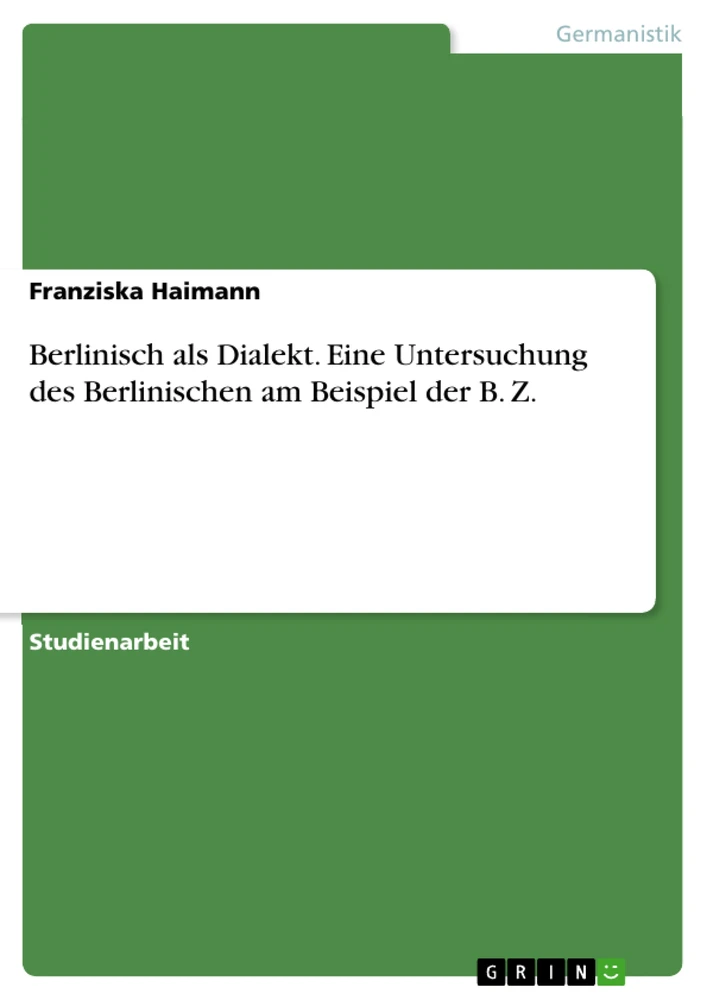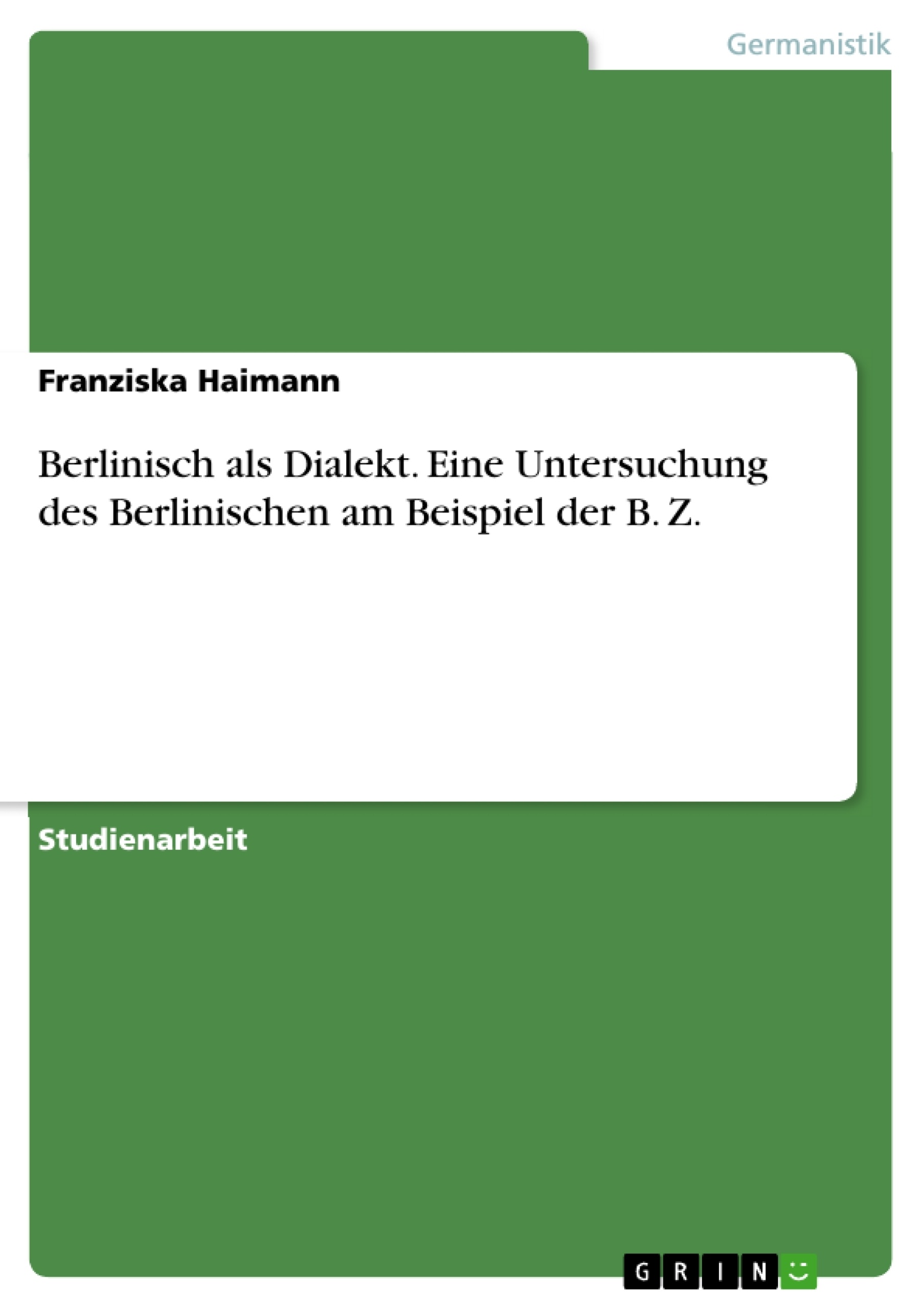Die typische „Berliner Schnauze“ findet man selten noch auf den Straßen Berlins. Charakteristisch verbinden viele mit dem Berlinischen Wörter wie „Schrippe“, „Molle“ oder „Bulette“. Darüber hinaus sind auch grammatische Merkmale kennzeichnend, wie die Verwechslung von Dativ und Akkusativ.
Heutzutage wird der Dialekt nicht nur von einem Großteil der 3,4 Millionen Berliner benutzt, sondern ist weit bis in das Land Brandenburg verbreitet. Demnach ergibt sich für diese Arbeit eine Arbeitsdefinition, in der sich Berlinisch als Sprache der im Raum Berlins Aufgewachsenen charakterisieren lässt, welche auf allen sprachlichen Ebenen regelmäßig vom Standard abweicht. Doch worin bestehen die lexikalischen, phonetischen und syntaktischen Unterschiede? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Hausarbeit beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten: Varietät, Dialekt, Umgangssprache, Standard, Stadtsprache
- Sprachgeschichte des Berlinischen
- Berlinisch in der Stadtsprachenforschung
- Einige Besonderheiten im Berlinischen
- Phonetische und grammatische Besonderheiten im Berlinischen
- Untersuchungen am Beispiel der B•Z•
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Berlinische, eine regionale Sprachvarietät Berlins und Brandenburgs. Ziel ist es, die lexikalischen, phonetischen und syntaktischen Unterschiede zum Standarddeutschen zu beleuchten und den heutigen Stand des Berlinischen zu erfassen. Die Arbeit betrachtet die Sprachgeschichte des Berlinischen, den Forschungsstand der Stadtsprachenforschung und analysiert schließlich anhand der Zeitung B•Z• typische Merkmale des Berlinischen.
- Sprachgeschichtliche Entwicklung des Berlinischen
- Begriffliche Klärung von Varietät, Dialekt, Umgangssprache und Stadtsprache
- Untersuchung lexikalischer, phonetischer und grammatischer Besonderheiten des Berlinischen
- Analyse des Berlinischen anhand der Zeitung B•Z•
- Der Stellenwert des Berlinischen im Kontext der Stadtsprachenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den lexikalischen, phonetischen und syntaktischen Unterschieden des Berlinischen zum Standarddeutschen. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung durch den engen Zusammenhang sprachlicher Entwicklungen mit sozioökonomischen Verhältnissen und skizziert den Aufbau der Arbeit: Sprachgeschichte, Forschungsstand, detaillierte Beschreibung der sprachlichen Besonderheiten des Berlinischen und eine Analyse anhand der B•Z•.
Begrifflichkeiten: Varietät, Dialekt, Umgangssprache, Standard, Stadtsprache: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe. "Varietät" wird als Oberbegriff für verschiedene Ausprägungen des Deutschen definiert. "Dialekt" beschreibt eine regionale Ausdrucksweise, "Umgangssprache" eine Mischform aus Dialekt und Standardsprache, und "Standardsprache" eine überregionale, historisch legitimierte Sprachform. Der Begriff "Stadsprache" wird im Kontext der sprachlichen Vielfalt innerhalb einer Stadt erläutert, wobei betont wird, dass es sich nicht um einen Dialekt, sondern eher um einen Metrolekt handelt, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.
Sprachgeschichte des Berlinischen: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachgeschichtliche Entwicklung des Berlinischen. Es beschreibt die Besiedlung des Gebietes zwischen Elbe und Oder durch slawische Stämme und die spätere Ansiedlung deutscher Kolonisten, die zur Entstehung der Doppelstadt Berlin/Cölln führten. Die Geschichte der Askanier und ihre Rolle bei der Kolonisation werden ebenfalls erwähnt. Das Kapitel liefert somit einen historischen Kontext für die Entwicklung des Berlinischen als heterogene Sprachform.
Schlüsselwörter
Berlinisch, Stadtsprache, Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache, Sprachgeschichte, Lexik, Phonetik, Grammatik, B•Z•, Soziolinguistik, Pragmatik, Varietät, Metrolekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Berlinischen: Eine Sprachwissenschaftliche Untersuchung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Berlinische, eine regionale Sprachvarietät Berlins und Brandenburgs. Der Fokus liegt auf der Analyse der lexikalischen, phonetischen und syntaktischen Unterschiede zum Standarddeutschen und der Erfassung des heutigen Stands des Berlinischen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachgeschichtliche Entwicklung des Berlinischen, klärt die Begriffe Varietät, Dialekt, Umgangssprache und Stadtsprache, untersucht lexikalische, phonetische und grammatische Besonderheiten des Berlinischen und analysiert diese anhand von Beispielen aus der Zeitung B•Z•. Der Stellenwert des Berlinischen im Kontext der Stadtsprachenforschung wird ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung (Varietät, Dialekt usw.), ein Kapitel zur Sprachgeschichte des Berlinischen, ein Kapitel zur Analyse anhand der B•Z• und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Abschnitts.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert sprachhistorische Ansätze mit einer Analyse anhand von konkreten Textbeispielen aus der Zeitung B•Z•. Es werden lexikalische, phonetische und grammatische Besonderheiten des Berlinischen untersucht und mit dem Standarddeutschen verglichen.
Welche Begriffe werden geklärt?
Die Arbeit klärt die zentralen Begriffe Varietät, Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache und Stadtsprache. "Varietät" dient als Oberbegriff, "Dialekt" bezeichnet eine regionale Ausdrucksweise, "Umgangssprache" eine Mischform aus Dialekt und Standardsprache, und "Standardsprache" eine überregionale, historisch legitimierte Sprachform. "Stadtsprache" wird als Metrolekt im Kontext der sprachlichen Vielfalt innerhalb einer Stadt erläutert.
Welche Rolle spielt die Zeitung B•Z• in der Untersuchung?
Die Zeitung B•Z• dient als Korpus zur Analyse typischer Merkmale des Berlinischen. Anhand von Textbeispielen aus der B•Z• werden die im theoretischen Teil beschriebenen lexikalischen, phonetischen und grammatischen Besonderheiten des Berlinischen illustriert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Das Fazit ist in der Vorlage nicht explizit zusammengefasst. Die Schlussfolgerungen lassen sich aus den vorangehenden Kapiteln ableiten und betreffen wahrscheinlich den aktuellen Stand des Berlinischen, seine Unterschiede zum Standarddeutschen und seine Bedeutung im Kontext der Stadtsprachenforschung.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Berlinisch, Stadtsprache, Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache, Sprachgeschichte, Lexik, Phonetik, Grammatik, B•Z•, Soziolinguistik, Pragmatik, Varietät, Metrolekt.
- Arbeit zitieren
- Franziska Haimann (Autor:in), 2014, Berlinisch als Dialekt. Eine Untersuchung des Berlinischen am Beispiel der B. Z., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310485