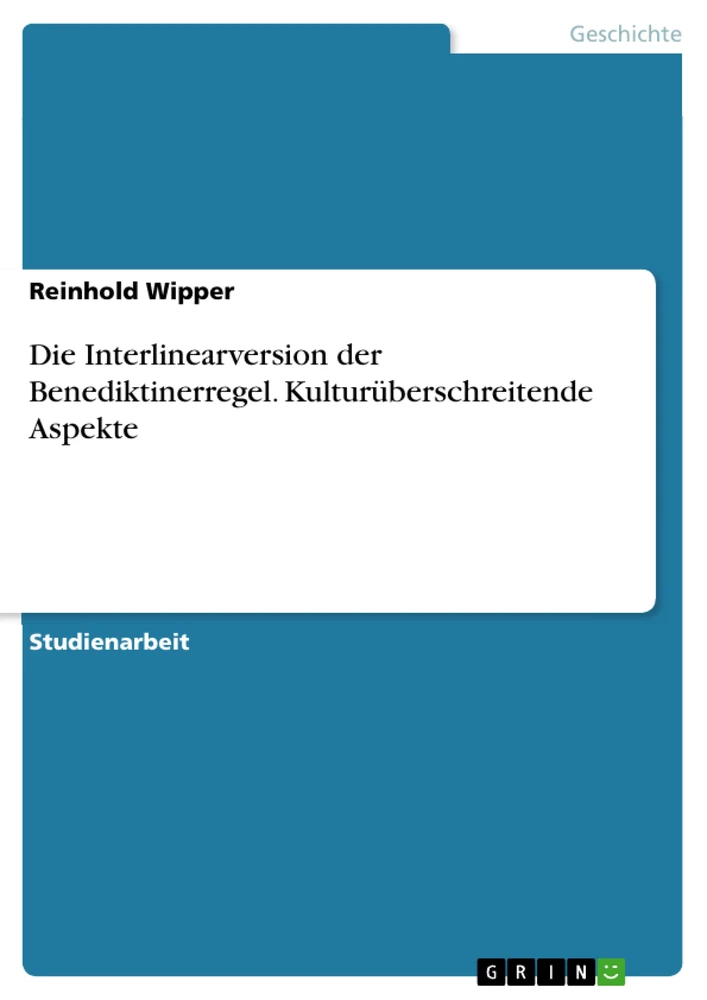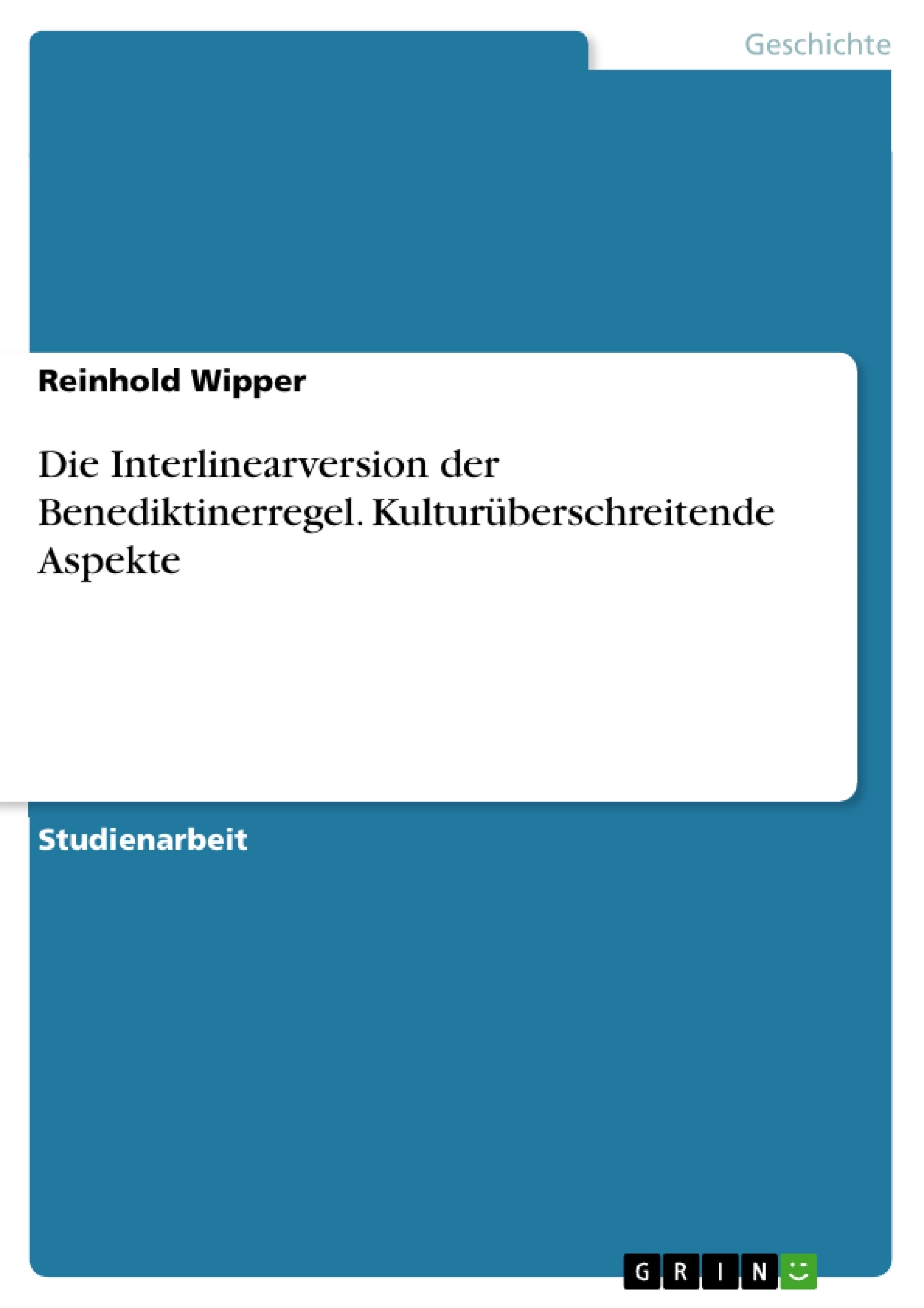Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Interlinearversion der Benediktinerregel aus Cod. Sang. 916 unter transkulturellen Aspekten zu betrachten und eine Vorstellung von transkulturellen Funktionen und Bezügen dieser Interlinearversion im Kontext der Übergänge zwischen Latein als Bildungssprache und Deutsch als Volkssprache Hintergründe zu gewinnen.
Genannte Zielsetzung wird verfolgt, indem nach einer Einleitung (Abschnitt 1) zunächst die Sachgrundlagen sowie einschlägige theoretische Konzepte der Paläographie herausgearbeitet werden (Abschnitt 2). Im Hauptteil der vorliegenden Arbeit kommt es dann zu einer Auseinandersetzung mit dem transkulturellen Charakter der Handschrift, und zwar anhand einer paläographischen Analyse. Ausgehend von diesen Ergebnissen sollen dann Funktionen und Bezüge der Interlinearversion unter den genannten Paradigmen untersucht und dargestellt werden (Abschnitt 3). Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf mögliche weitere Ansatzpunkte paläographischer Forschung (Abschnitt 4).
Aus methodischer Sicht ist die vorliegende Arbeit vor allem als eine Literaturarbeit zu verstehen; es wurde der Versuch gemacht, die relevanter Fachliteratur in einer der Fragestellung angemessenen Weise zu rezipieren und einzubinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachgrundlagen
- Aspekte der Überlieferung
- Inhalt und historischer Kontext der Handschrift
- Analyse der Interlinearversion: Transkulturelle Übergänge zwischen Lateinischer Schriftkultur und deutscher Volkssprache
- Vergleichende Textanalysen
- Schriftbild und Textgestaltung
- Transkulturelle Dimensionen der Textgegenüberstellung
- Die Interlinearglossierung als Moment eines transkulturellen Prozesses
- Thesen zum Resultat des transkulturellen Prozesses
- Vergleich mit anderen transkulturellen Prozessen der Epoche
- Vergleichende Textanalysen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Interlinearversion der Benediktinerregel aus Cod. Sang. 916 und analysiert deren transkulturelle Funktionen und Bezüge im Kontext des Übergangs von Latein als Bildungssprache zu Deutsch als Volkssprache. Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Rolle der Interlinearglossierung im Kontext kultureller Transferprozesse zu erforschen.
- Analyse der Interlinearglossierung als Moment des Kulturtransfers zwischen lateinischer Schriftkultur und deutscher Volkssprache
- Vergleichende Textstruktur-Analyse der lateinischen und deutschen Versionen
- Bewertung der Bedeutung der deutschen Volkssprache im Kontext der zeitgenössischen Bildungsprozesse
- Darstellung der Ergebnisse des transkulturellen Prozesses
- Vergleich mit anderen transkulturellen Phänomenen der Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Arbeit widmet sich der Untersuchung der Interlinearversion der Benediktinerregel aus Cod. Sang. 916 unter transkulturellen Gesichtspunkten. Sie will ein Verständnis von den transkulturellen Funktionen und Bezügen dieser Interlinearversion im Kontext des Übergangs von Latein zu Deutsch gewinnen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Interlinearglossierung im Kontext konkreter kultureller Transferprozesse.
Sachgrundlagen
Aspekte der Überlieferung
Die Althochdeutsche Benediktinerregel in ihrer Interlinearversion ist in Cod. Sang. 916 enthalten. Die Handschrift entstand wahrscheinlich in St. Gallen nach 799 und ist seitdem dort verblieben. Sie ist auf Pergament geschrieben und umfasst 172 Seiten im Format 19,5 x 12,5 cm. Die Paginierung erfolgte im 19. Jahrhundert.
Die Handschrift besteht aus einem alten Buchblock mit 86 Blättern. Es enthält auch nachträglich hinzugefügte Einzelblätter, die vermutlich als Ersatz ins Konvolut gelangten. Die Kapitalzahlen und die Paginierung wurden erst später eingefügt.
Der Schriftraum ist einspaltig und in Blindlinierung ausgeführt. Im ersten Teil der Handschrift ist eine alemannische Minuskel des frühen 9. Jahrhunderts zu erkennen, während der lateinische Text mit einer Hand geschrieben wurde. Der zweite Teil der Handschrift ist ebenfalls in alemannischer Minuskel des frühen 9. Jahrhunderts ausgeführt und durchgängig mit einer Hand geschrieben.
Der Buchschmuck ist schlicht gehalten. Der lateinische Text im ersten Teil ist in schwarzbrauner Tinte geschrieben, der deutsche Text in brauner Tinte. Im ersten Teil sind Kapitelüberschriften zwischen p. 51-125 in roter Tinte ausgeführt. Der Schreiber des lateinischen Textes hat einfache Initialen als Gliederungselemente verwendet.
Die Überlieferung des ersten Teils der Handschrift erscheint weitgehend unbeschadet und vollständig. Der zweite Teil der Handschrift, der die Erklärung der Benediktinerregeln enthält, ist nicht mehr vom Interlineartext bestimmt. Da dieser Teil für die vorliegende Arbeit keine zentrale Rolle spielt, wird auf eine genaue Textbeschreibung an dieser Stelle verzichtet.
Der hier interessierende Teil der Interlinearversion der Benediktinerregel weist einige spätere Ergänzungen auf. Die althochdeutsche Interlinearversion wurde von drei Händen geschrieben, die einander in der Niederschrift abwechselten. Auch der lateinische Text wurde zeitgenössisch teilweise nachkorrigiert. Der lateinische Text scheint insbesondere dem Cod. Sang. 915 angepasst worden zu sein, ebenfalls aber in St. Gallen.
Inhalt und historischer Kontext der Handschrift
Die Handschrift enthält im ersten Teil (p. 2-158) die althochdeutsche Benediktinerregel in einer lateinischen Interlinearversion. Die genaue Aufteilung des Texts gestaltet sich wie folgt: p. 2-6 bringen die „Capitula“, also eine Inhaltsübersicht des Bandes; p. 6-7 den Text „De moribus perfectionis“, den Eingang zur Benediktinerregel. Darauf folgt bis p. 151 die Interlinearversion der Benediktinerregel, p. 152 enthält nur lateinischen Text.
Der Inhalt der Benediktinerregel entspricht grundsätzlich den vom Heiligen Benedikt von Nursia im Jahr 529 verfassten Regularien für das Kloster Monte Cassino. Der „Ordo Sancti Benedicti“ (OSB), auch Benediktiner genannt, akzeptierte diese Regularien als Ordensregeln und tradierte sie in die mittelalterlichen Klosterfilialen auch außerhalb des italienischen/lateinischen Sprachraums.
Benedikt hatte diese Regularien zunächst nicht als universelle Ordensregel entworfen. Vielmehr handelte es sich um ein didaktisches Werk, das seine Auffassung vom Klosterleben wiedergeben und für die Lehre nutzbar machen sollte.
Der Text ist nicht ohne strukturelles Vorbild; er orientiert sich nach Didaktik und Rhetorik an der so genannten Magisterregel (Regula Magistri); zusätzlich findet eine Anlehnung an Augustinus statt. Auffällig an diesem Text ist, dass es sich nicht um Regularien für Klostervertraute handelte sondern um ein Werk, das sich an Neueinsteiger (Novizen) und wohl auch an potenzielle Eintrittskandidaten richtete.
Auch im Aufbau (Prolog und 73 Kapitel) lässt sich eine strukturelle Orientierung an zeitgenössischen didaktischen Werken erkennen, die stark auf Regelhaftigkeit und Formelbildung gerichtet sind.
Über Gallien gelangte der Text nach Irland und wieder zurück nach dem Frankenreich, wo sich die RB¹³ schnell verbreiteten.
Schlüsselwörter
Interlinearversion, Benediktinerregel, Cod. Sang. 916, transkultureller Prozess, Kulturtransfer, lateinische Schriftkultur, deutsche Volkssprache, Textanalyse, Vergleichende Textanalyse, Bildungsprozesse, transkulturelle Phänomene, Epoche.
- Arbeit zitieren
- Reinhold Wipper (Autor:in), 2015, Die Interlinearversion der Benediktinerregel. Kulturüberschreitende Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310345