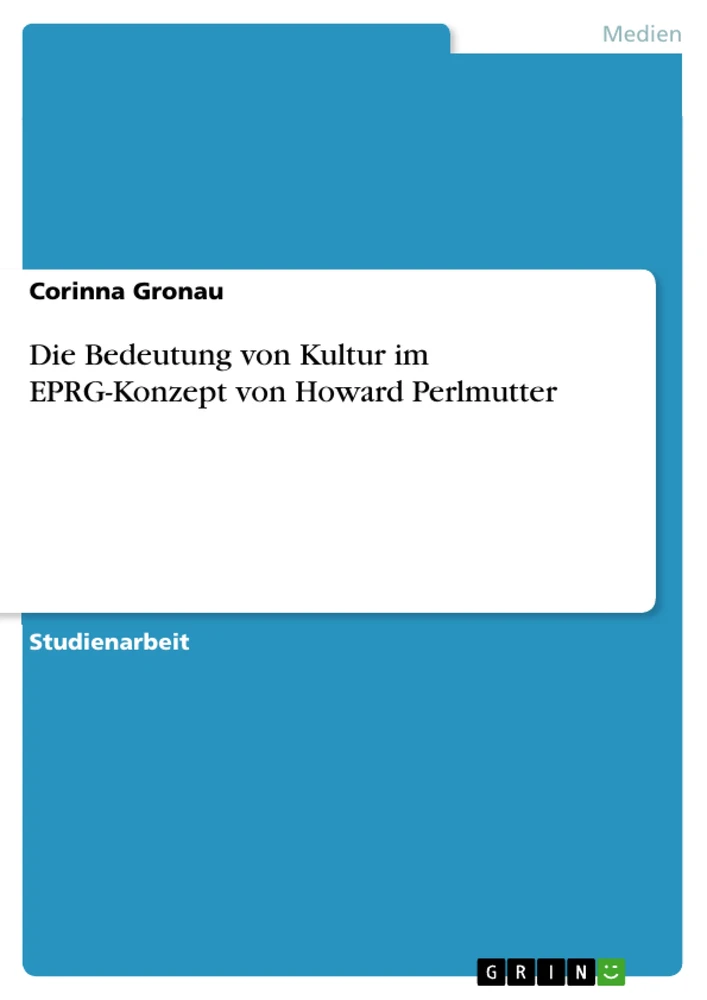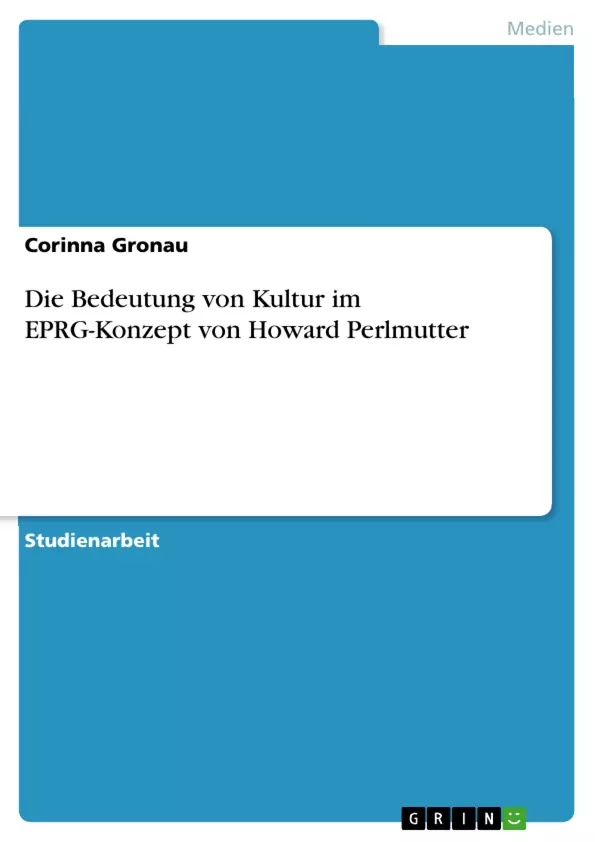Adidas erwirtschaftete 2010 fast 95 Prozent seines Umsatzes im Ausland und beschäftigte 33.164 seiner Mitarbeiter in anderen Ländern, was einem Auslandsanteil von 91 Prozent entspricht. Auch andere deutsche Unternehmen wie Bayer, Deutsche Post, Siemens oder Volkswagen erzielen den Großteil ihres Gewinnes in anderen Ländern und auch hier übersteigen die Beschäftigtenzahlen im Ausland die Beschäftigtenzahlen im Inland. Das Phänomen der Internationalisierung weitet sich durch eine zunehmende Globalisierung der gesamten Unternehmenstätigkeit immer mehr aus und erfasst auch kleine und mittelständische Unternehmen.
Motive für eine grenzüberschreitende Tätigkeit von Unternehmen liegen in der Steigerung des Absatzes, dem Erzielen von Kostenvorteilen, der Risikostreuung über zusätzliche Märkte oder Kundengruppen oder in der Erschließung von weltweiten Ressourcen. Dabei stellen die räumliche und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmensteilen besondere Anforderungen an die Kommunikation zwischen Stammunternehmen und Auslandsgesellschaften. Nach dem populären EPRG-Modell – in der Literatur zum Internationalen Management – von Howard Perlmutter lassen sich vier Grundstrategien für internationale Aktivitäten unterscheiden, je nachdem wie stark das Stammunternehmen die Auslandsgesellschaft beeinflusst, zum Beispiel durch die Besetzung von Führungspositionen. Die Vorgehensweise bei der Internationalisierung lässt Rückschlüsse darauf zu, ob fremde Kulturen innerhalb des Unternehmens akzeptiert werden, sich an sie angepasst oder ihre Vielfalt genutzt wird.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst das EPRG-Konzept von Perlmutter vorgestellt und anschließend im Hinblick auf das Verständnis und die Rolle von Kultur diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des EPRG-Konzeptes von Perlmutter
- Ethnozentrische Strategie
- Polyzentrische Strategie
- Geozentrische Strategie
- Regiozentrische Strategie
- Die Rolle von Kultur im EPRG-Konzept von Perlmutter
- Zugrundeliegender Kulturbegriff
- Dominanz vs. Anpassung
- Bewertung des EPRG-Konzeptes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem EPRG-Konzept von Perlmutter im internationalen Management und analysiert die Rolle von Kultur in diesem Kontext. Das Ziel ist es, die verschiedenen Strategien des EPRG-Modells zu erläutern und deren Implikationen für das Verständnis und die Berücksichtigung kultureller Unterschiede in internationalen Unternehmen zu beleuchten.
- Ethnozentrische, Polyzentrische, Geozentrische und Regiozentrische Strategien im internationalen Management
- Der Einfluss von Kultur auf die Wahl der Internationalisierungsstrategie
- Die Bedeutung interkultureller Kommunikation in internationalen Unternehmen
- Die Herausforderungen und Chancen der Kulturintegration in multinationalen Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die steigende Internationalisierung von Unternehmen und die damit verbundenen Herausforderungen für das Management. Im zweiten Kapitel wird das EPRG-Konzept von Perlmutter vorgestellt, welches vier verschiedene Strategien für internationale Aktivitäten unterscheidet: Ethnozentrisch, Polyzentrisch, Geozentrisch und Regiozentrisch. Jedes dieser Modelle spiegelt einen unterschiedlichen Grad der Einflussnahme des Stammunternehmens auf die Auslandsgesellschaften wider. Das dritte Kapitel analysiert die Rolle von Kultur im EPRG-Konzept, indem es den zugrundeliegenden Kulturbegriff, das Spannungsverhältnis zwischen Dominanz und Anpassung sowie die Bewertung des EPRG-Konzeptes im Hinblick auf die Berücksichtigung kultureller Unterschiede untersucht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Internationalisierung, EPRG-Konzept, Kultur, Ethnozentrische Strategie, Polyzentrische Strategie, Geozentrische Strategie, Regiozentrische Strategie, Interkulturelle Kommunikation, Management, Unternehmenskultur.
- Quote paper
- Corinna Gronau (Author), 2014, Die Bedeutung von Kultur im EPRG-Konzept von Howard Perlmutter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310299