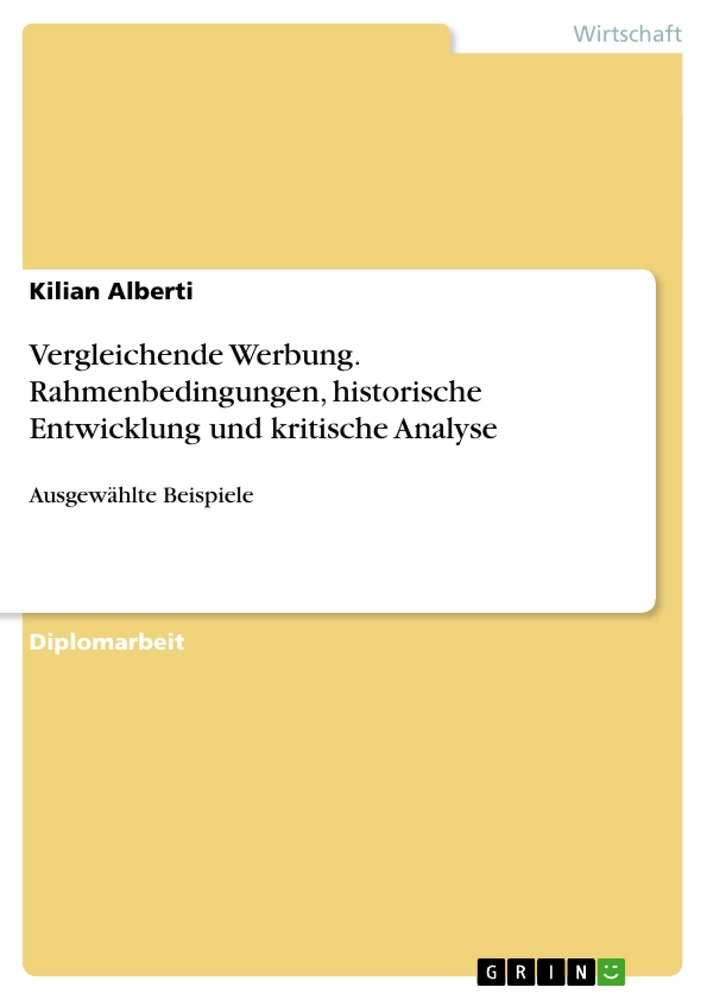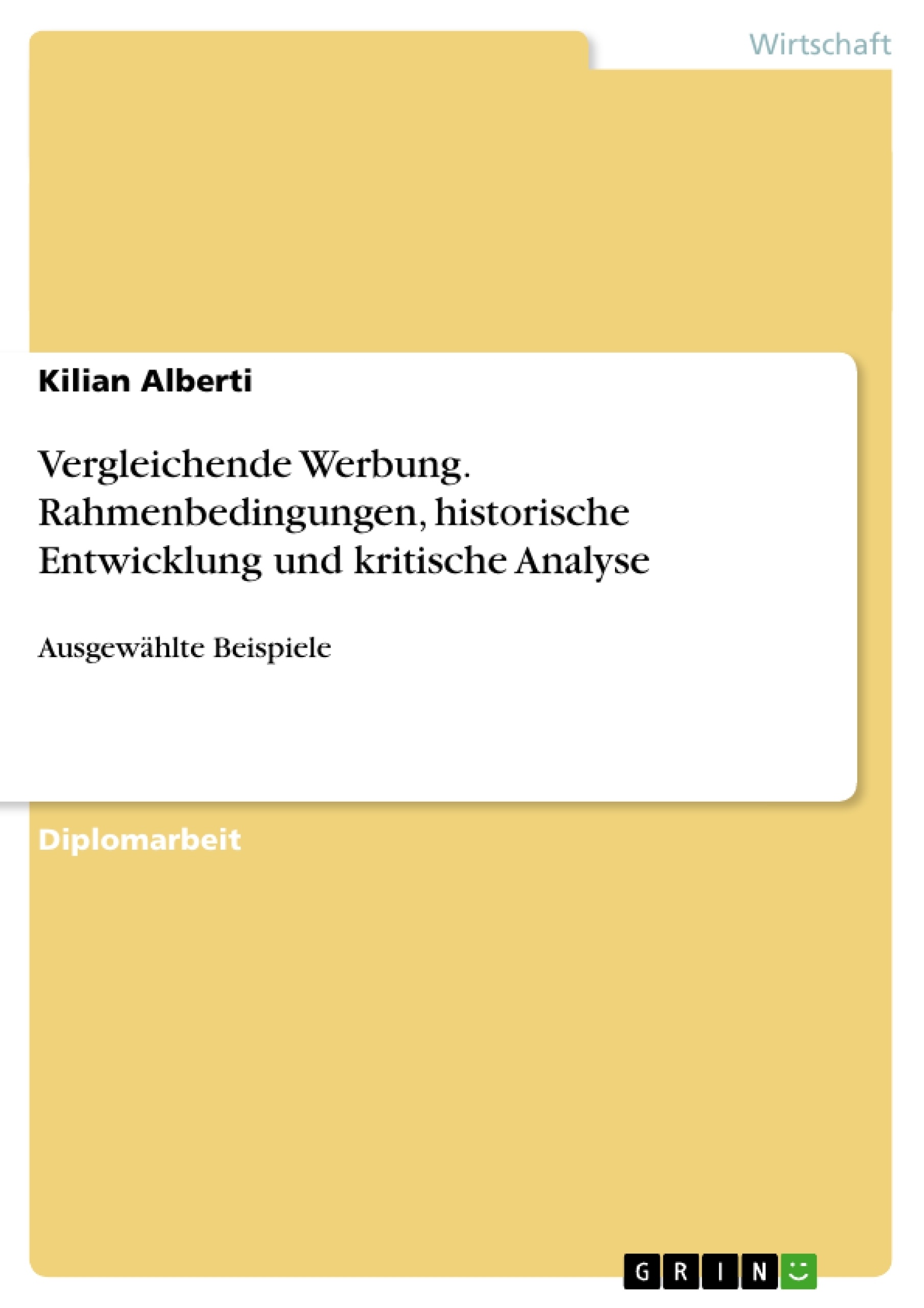Die Konsumenten sehen sich heutzutage einer regelrechten Flut an Werbemitteln gegenüber. Die Reizüberflutung (Information Overload) in unserer Gesellschaft ist dermaßen hoch, dass empirische Studien in den Vereinigten Staaten und Deutschland zeigen, dass die Informationsüberlastung in Massenmedien und Werbung bis zu 99% beträgt (vgl. Kroeber-Riel, 1987, S. 259). Dies bedeutet, dass die einem Verbraucher dargebotenen Informationen nur zu etwa 1% kognitiv verarbeitet werden. Seit den Neunzigern sind darüber hinaus noch neue Medien wie zum Beispiel das Internet hinzu gekommen, die das Informationsangebot noch weiter steigern. Man kann also davon ausgehen, dass die Reizüberflutung und die damit verbundene Informationsabwehr sich bis heute sogar noch gesteigert hat. Allein die Anzahl der in Deutschland veröffentlichten Werbemittel hat sich von 1990 – 1996 verdoppelt (vgl. Nielsen, 1997).
Konsumenten sehen sich aber gleichzeitig mit einer auf der Qualitätsebene konvergierenden Produktpalette gegenüber. Homogene Güter und Dienstleistungen führen dazu, dass sich Unternehmen nur noch über die Kommunikationspolitik von den Wettbewerbern abgrenzen können. Damit die Unternehmenskommunikation und Werbung überhaupt noch wahrgenommen werden kann, bedienen sich Werbetreibende immer wieder innovativer Werbeformate. Ein neuer Pfeil im Köcher der Marketingabteilungen und Werbeagenturen ist seit der Verabschiedung der EU-Richtlinie 97/55/EG und der Grundsatzurteile des Bundesgerichtshofes 1998 die direkt vergleichende Werbung.
Über die Liberalisierung des deutschen Werberechts wurde lange kontrovers diskutiert. Die Befürworter erwarteten sich durch das neue Marketing-Tool mehr Abwechslung und Markttransparenz, da vergleichende Elemente in einer Werbung eine Steigerung des Informationsgehaltes bedeuten (vgl. Harmon, Razzouk & Stern, 1983, S. 17). Einige Wissenschaftler dagegen hielten den Vorstoß der EU-Kommission für wettbewerbspolitisch falsch. Sie befürchteten, dass die Markttransparenz durch zusätzliche Informationen abnehmen werde und die bestehende Informationsüberlastung noch verschlimmert werden würde (vgl. Ahlert & Schröder, 1993, S. 173; Mayer & Siebeck, 1997, S. 436).
Der durch die Autoren prophezeite rapide Anstieg des Einsatzes von vergleichender Werbung nach der Umsetzung der EU-Richtlinie ist ausgeblieben (vgl. Ahlert & Schröder, S. 173)...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen
- 2.1 Definition von vergleichender Werbung
- 2.2 Arten von vergleichender Werbung
- 2.2.1 Vergleich mit eigenen Produkten
- 2.2.2 Brand X - Vergleich
- 2.2.3 Alleinstellungswerbung
- 2.2.4 Direkter Vergleich
- 2.2.5 Indirekter Vergleich
- 2.2.6 Kritisierende vergleichende Werbung
- 2.2.7 Anlehnende vergleichende Werbung
- 2.2.8 Persönlich vergleichende Werbung
- 2.2.9 Werbung mit Warentests
- 2.2.10 Mischformen
- 2.3 Gegenstand des Vergleichs
- 2.4 Fazit der Begriffsbestimmung
- 3. Marketingorientierte Betrachtung und empirische Befunde
- 3.1 Einordnung vergleichender Werbung in die Marketing-strategie
- 3.2 Verbreitung der vergleichenden Werbung
- 3.2.1 Branchen und Unternehmen der vergleichenden Werbung
- 3.2.2 Akzeptanz in der Werbepraxis
- 3.2.3 Medien der vergleichenden Werbung
- 3.3 Zielgruppen der vergleichenden Werbung
- 3.3.1 Einteilung nach soziodemographischen Merkmalen
- 3.3.2 Einteilung nach Produktloyalität
- 4. Historische Entwicklung der vergleichenden Werbung in der Praxis und Rechtsprechung
- 4.1 Historische Entwicklung in den USA
- 4.1.1 Rechtsgrundlagen zur vergleichenden Werbung vor 1971
- 4.1.2 Selbstregulierungsmechanismen der Wirtschaft
- 4.1.3 Vergleichende Werbung ab den Siebziger Jahren
- 4.2 Historische Entwicklung in Deutschland
- 4.2.1 Rechtsprechung des Reichsgerichts
- 4.2.1.1 Rechtsprechung bis 1927
- 4.2.1.2 Neue Rechtsauffassung nach 1927
- 4.2.1.3 Die Ausnahmetatbestände
- 4.2.2 Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
- 4.2.3 Einfluss der europäischen Rechtsprechung auf die deutsche Entwicklung
- 4.2.4 Aktuelle Rechtslage in Deutschland
- 4.2.4.1 Die Richtlinie 97/55/EG
- 4.2.4.2 Umsetzung in deutsches Recht
- 5. Konsumentenverhalten und Werbewirkung
- 5.1 Der Kaufentscheidungsprozess
- 5.1.1 Einfluss des Involvement
- 5.1.2 Höherwertige Information
- 5.2 Modelle der Werbewirkung
- 5.2.1 Mechanistische Ansätze
- 5.2.2 Das Hierarchy-of-Effects-Modell
- 5.3.3 Das Modell der Wirkungspfade
- 6. Bisherige Forschung zur Wirkung vergleichender Werbung und Implikationen für ihren Gebrauch
- 6.1 Effekte von vergleichender Werbung
- 6.1.1 Einfluss auf die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung
- 6.1.1.1 Aufmerksamkeit durch Neuartigkeit oder Irritation
- 6.1.1.2 Aufmerksamkeit durch selektive Wahrnehmung
- 6.1.2 Einfluss auf die Erinnerung
- 6.1.3 Einfluss auf die Einstellung
- 6.1.4 Einfluss auf die Kaufabsicht
- 6.1.5 Einfluss auf die Glaubwürdigkeit
- 6.1.6 Einfluss auf den Informationsgehalt
- 6.2 Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit von vergleichender Werbung
- 6.2.1 Einfluss des Produktinvolvement
- 6.2.2 Einfluss des Marktanteils des beworbenen Produkts
- 6.2.3 Einfluss der Intensität des Vergleichs
- 6.2.4 Einfluss von Testergebnissen
- 7. Ableitung von Empfehlungen
- 7.1 Überprüfung von weiteren Beispielen
- 7.1.1 OKI
- 7.1.2 WEB.DE
- 7.1.3 AOL Online Werbung
- 7.2 Einsatzmöglichkeiten für vergleichende Werbung
- 7.3 Reaktionsmöglichkeiten auf vergleichende Werbung
- 7.3.1 Rechtliche Schritte
- 7.3.2 Ignoranz
- 7.3.3 Gegenattacke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vergleichende Werbung. Ziel ist es, die Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, marketingorientierten Aspekte, die historische Entwicklung sowie das Konsumentenverhalten im Kontext vergleichender Werbung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert auch die bisherigen Forschungsbefunde und leitet daraus Empfehlungen für den Einsatz und die Reaktion auf vergleichende Werbung ab.
- Begriffsbestimmung und -abgrenzung der vergleichenden Werbung
- Marketingstrategische Einordnung und empirische Befunde zur Verbreitung und Zielgruppen
- Historische Entwicklung der vergleichenden Werbung in den USA und Deutschland
- Konsumentenverhalten und die Wirkung von vergleichender Werbung
- Forschungsstand und Implikationen für den praktischen Gebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der vergleichenden Werbung ein und skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Arbeit. Es benennt den Forschungsgegenstand und die zu bearbeitenden Fragestellungen.
2. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen: Hier wird der Begriff der vergleichenden Werbung präzise definiert und eingegrenzt. Es werden verschiedene Arten und Erscheinungsformen der vergleichenden Werbung detailliert beschrieben, von direkten und indirekten Vergleichen bis hin zu Mischformen und Werbung mit Warentests. Der Fokus liegt auf der klaren Abgrenzung und Systematisierung der verschiedenen Ausprägungen, um eine solide Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Das Kapitel beleuchtet auch den Gegenstand des Vergleichs, also welche Aspekte der Produkte oder Dienstleistungen im Wettbewerb gegenübergestellt werden.
3. Marketingorientierte Betrachtung und empirische Befunde: Dieses Kapitel betrachtet die vergleichende Werbung aus marketingstrategischer Perspektive. Es analysiert die Verbreitung der vergleichenden Werbung in verschiedenen Branchen und Unternehmen, untersucht die Akzeptanz in der Werbepraxis und die genutzten Medien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zielgruppenanalyse, die sowohl soziodemographische Merkmale als auch die Produktloyalität der Konsumenten berücksichtigt. Empirische Befunde werden herangezogen, um die theoretischen Aussagen zu untermauern und zu veranschaulichen.
4. Historische Entwicklung der vergleichenden Werbung in der Praxis und Rechtsprechung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der vergleichenden Werbung in den USA und Deutschland. Es untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung in beiden Ländern, von frühen Urteilen bis zur aktuellen Rechtslage. Besonders wird der Einfluss der europäischen Rechtsprechung auf die deutsche Entwicklung hervorgehoben. Das Kapitel zeigt, wie sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Werbepraxis im Laufe der Zeit entwickelt haben und wie sich diese Entwicklung gegenseitig beeinflusst haben.
5. Konsumentenverhalten und Werbewirkung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konsumentenverhalten und der Wirkung von vergleichender Werbung. Es analysiert den Kaufentscheidungsprozess, den Einfluss des Involvement und die Rolle höherwertiger Informationen. Es werden verschiedene Modelle der Werbewirkung vorgestellt und diskutiert, um die komplexen Wirkmechanismen zu erklären. Die Kapitel verbindet Konsumentenpsychologie mit der Wirkung der Werbung, um die Relevanz und den Einfluss der Werbung für den Kaufentscheidungsprozess aufzuzeigen.
6. Bisherige Forschung zur Wirkung vergleichender Werbung und Implikationen für ihren Gebrauch: Dieses Kapitel fasst den Forschungsstand zur Wirkung der vergleichenden Werbung zusammen. Es untersucht die Einflüsse auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung, Einstellung, Kaufabsicht, Glaubwürdigkeit und Informationsgehalt. Darüber hinaus werden wichtige Einflussfaktoren wie Produktinvolvement, Marktanteil des beworbenen Produkts, Intensität des Vergleichs und Testergebnisse analysiert. Das Kapitel dient als Grundlage für die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
7. Ableitung von Empfehlungen: Dieses Kapitel leitet aus den vorherigen Kapiteln Empfehlungen für den Einsatz und die Reaktion auf vergleichende Werbung ab. Es werden anhand von Beispielen aus der Praxis (OKI, WEB.DE, AOL) verschiedene Szenarien analysiert und bewertet. Die Kapitel beschreibt Einsatzmöglichkeiten der vergleichenden Werbung und mögliche Reaktionen auf diese, einschließlich rechtlicher Schritte, Ignoranz und Gegenattacken. Die Empfehlungen sollen sowohl Unternehmen als auch Konsumenten Orientierung bieten.
Schlüsselwörter
Vergleichende Werbung, Marketing, Konsumentenverhalten, Werbewirkung, Rechtsprechung, historische Entwicklung, USA, Deutschland, Marktforschung, Wettbewerbsrecht, Kaufentscheidung, Involvement, Glaubwürdigkeit, Effektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur vergleichenden Werbung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema der vergleichenden Werbung. Sie untersucht die Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, marketingorientierten Aspekte, die historische Entwicklung sowie das Konsumentenverhalten im Kontext vergleichender Werbung. Darüber hinaus werden Forschungsbefunde analysiert und daraus Empfehlungen für den Einsatz und die Reaktion auf vergleichende Werbung abgeleitet.
Welche Aspekte der vergleichenden Werbung werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Aspekten ab, darunter die genaue Definition und Abgrenzung der vergleichenden Werbung, verschiedene Arten und Erscheinungsformen (z.B. direkter und indirekter Vergleich, Werbung mit Warentests), die marketingstrategische Einordnung, die Verbreitung in verschiedenen Branchen und Medien, die Zielgruppenanalyse, die historische Entwicklung in den USA und Deutschland (einschließlich der relevanten Rechtsprechung), das Konsumentenverhalten und die Wirkung der Werbung (einschließlich der Analyse verschiedener Werbewirkungsmodelle), der Forschungsstand und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Konsumenten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen, Marketingorientierte Betrachtung und empirische Befunde, Historische Entwicklung der vergleichenden Werbung, Konsumentenverhalten und Werbewirkung, Bisherige Forschung zur Wirkung und Implikationen, sowie Ableitung von Empfehlungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der vergleichenden Werbung und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Arten von vergleichender Werbung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von vergleichender Werbung, wie z.B. Vergleich mit eigenen Produkten, Brand X - Vergleich, Alleinstellungswerbung, direkter und indirekter Vergleich, kritisierende und anlehnende vergleichende Werbung, persönlich vergleichende Werbung, Werbung mit Warentests und Mischformen. Diese werden detailliert beschrieben und voneinander abgegrenzt.
Wie wird die historische Entwicklung der vergleichenden Werbung dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der vergleichenden Werbung sowohl in den USA als auch in Deutschland. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung in beiden Ländern, von frühen Urteilen bis zur aktuellen Rechtslage, einschließlich des Einflusses der europäischen Rechtsprechung auf die deutsche Entwicklung.
Welche Rolle spielt das Konsumentenverhalten?
Das Konsumentenverhalten spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert den Kaufentscheidungsprozess, den Einfluss des Involvement, die Rolle höherwertiger Informationen und verschiedene Modelle der Werbewirkung, um die komplexen Wirkmechanismen zu erklären und den Einfluss der Werbung auf den Kaufentscheidungsprozess aufzuzeigen.
Welche Forschungsbefunde werden präsentiert und wie werden sie angewendet?
Die Arbeit präsentiert Forschungsbefunde zu den Effekten von vergleichender Werbung auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung, Einstellung, Kaufabsicht, Glaubwürdigkeit und Informationsgehalt. Sie analysiert auch Einflussfaktoren wie Produktinvolvement, Marktanteil und Intensität des Vergleichs. Diese Befunde dienen als Grundlage für die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Welche Empfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit leitet aus den Forschungsbefunden Empfehlungen für den Einsatz und die Reaktion auf vergleichende Werbung ab. Anhand von Beispielen aus der Praxis (OKI, WEB.DE, AOL) werden verschiedene Szenarien analysiert und bewertet. Es werden Einsatzmöglichkeiten und mögliche Reaktionen (rechtliche Schritte, Ignoranz, Gegenattacke) beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vergleichende Werbung, Marketing, Konsumentenverhalten, Werbewirkung, Rechtsprechung, historische Entwicklung, USA, Deutschland, Marktforschung, Wettbewerbsrecht, Kaufentscheidung, Involvement, Glaubwürdigkeit, Effektivität.
- Quote paper
- Kilian Alberti (Author), 2004, Vergleichende Werbung. Rahmenbedingungen, historische Entwicklung und kritische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31026