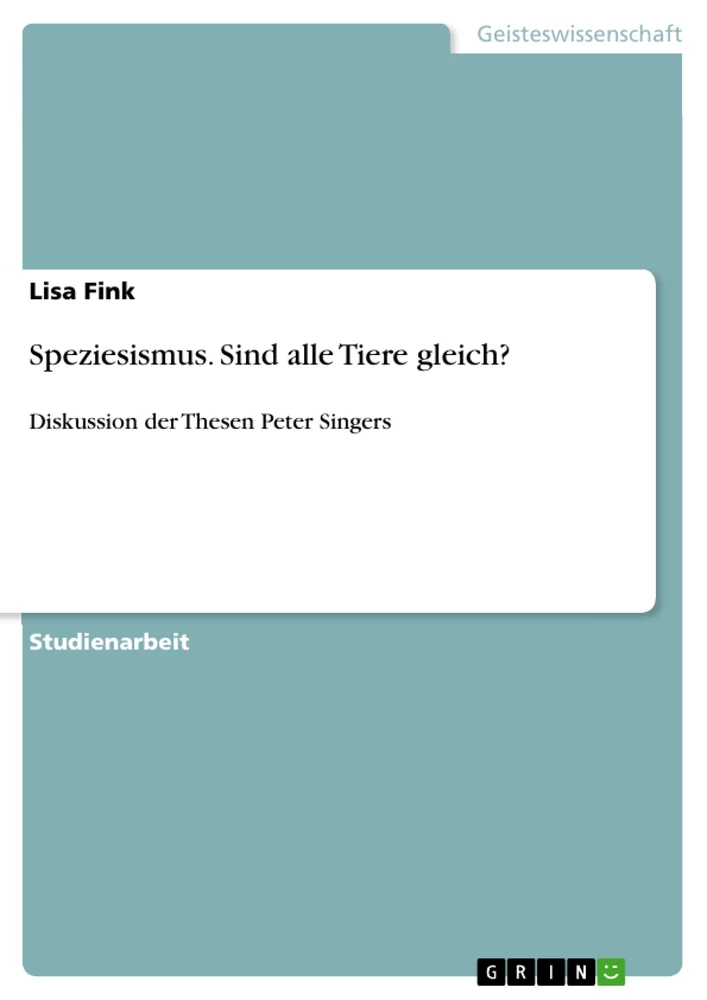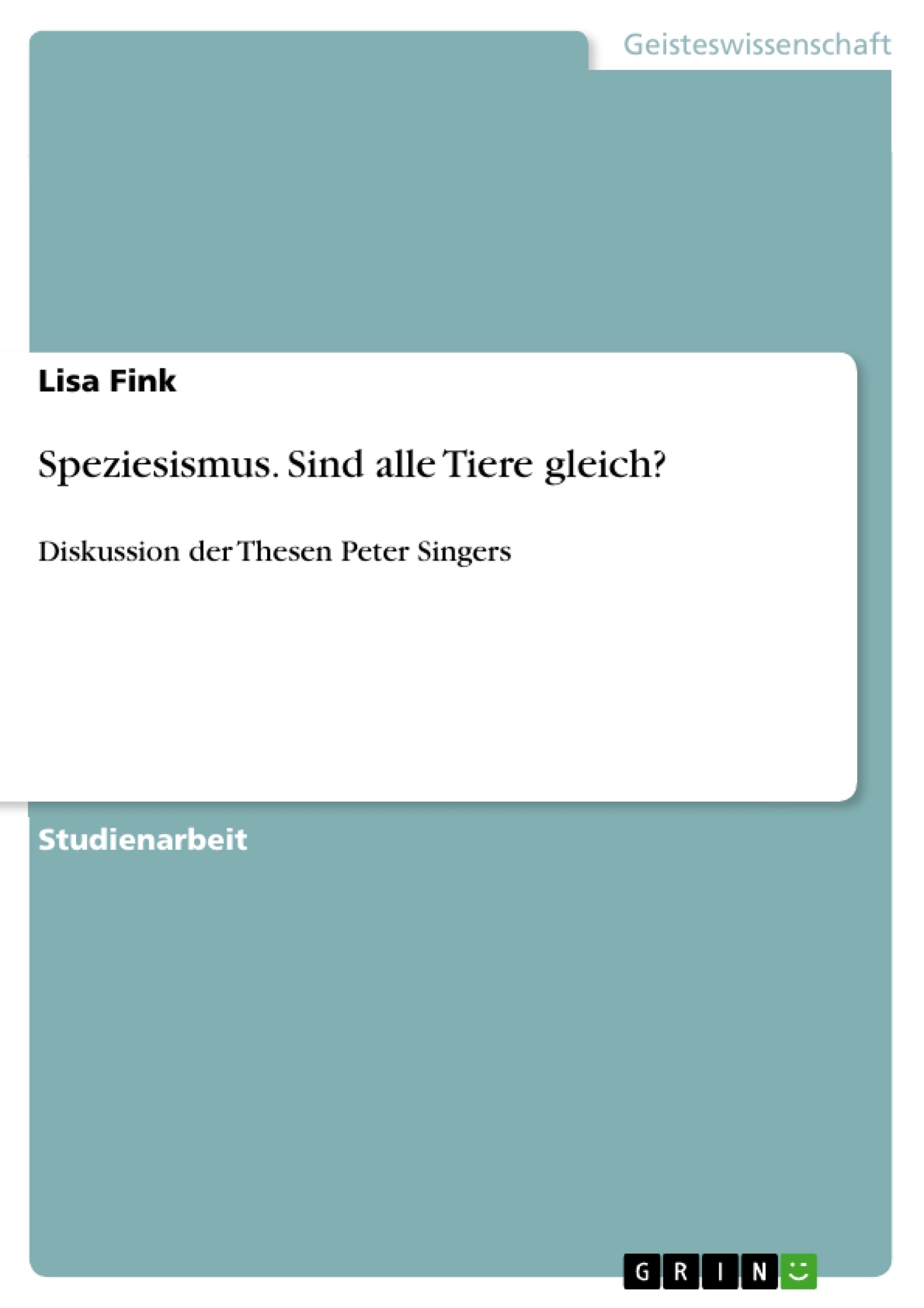Der Markt für vegetarische und vegane Lebensmittel boomt. Wer sich zum Vegetarier oder Veganer ernennt, liegt damit voll im Trend. Und tatsächlich scheint der Fleischkonsum in Europa zunehmend zu sinken. Doch trotz dieses Rückgangs wurden 2014 - laut Statistik Austria - allein in Österreich bundesweit 609.000 Rinder, 67.200 Kälber, 5.410.000 Schweine, 283.000 Schafe, 55.900 Ziegen sowie 943 Pferde und andere Einhufer geschlachtet.
Wie von Seiten der Veganer und Vegetarier angeklagt, kann sich wohl letztlich kaum ein Mensch ganz dem Vorwurf des Speziesismus entziehen. Selbst wer auf Fleischkonsum verzichtet, besitzt vermutlich den ein oder anderen Ledergürtel oder Lederhandtaschen, isst hin und wieder gelatinehaltige Gummibärchen oder verwendet - wenn auch unbewusst - Kosmetikartikel, die mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt wurden. Ebenso unbewusst ist häufig auch die Unterscheidung zwischen »Nutztier« und »Haustier«. Wer sein Haustier liebt, könnte sich in Europa vermutlich nicht vorstellen, Katzen- oder Hundefleisch zu essen, hat jedoch kein Problem damit, Schwein, Rind oder Geflügel zu konsumieren - ganz ohne schlechtes Gewissen.
Zweifellos handelt es sich bei nichtmenschlichen Tierarten insgesamt um unterdrückte Gruppen. Es sind ebendiese unterdrückten Gruppen, die der australische Philosoph und Ethiker Peter Singer in den Fokus rücken möchte, um uns den Umgang mit ihnen bewusst zu machen. Im Folgenden soll, nach einer Definition des Begriffs »Speziesismus«, zunächst genauer betrachtet werden, warum für Singer die meisten Menschen Speziesisten sind. Anhand der Argumentation seines Textes »Alle Tiere sind gleich« soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit man von einer Gleichheit aller Tiere sprechen kann, bzw. zu welcher Behandlung diese Gleichheitsannahme führen sollte. Darauf basierend kristallisiert sich die Frage nach der Leidensfähigkeit von Tieren heraus, die im Folgenden als Hauptargument für eine Gleichbehandlung aller Tierarten diskutiert werden soll. Die Bezeichnung »nichtmenschliche Tiere« entspricht der Verwendungsweise des Autors und weist darauf hin, dass der Mensch für ihn eine von vielen Tierarten darstellt.
Table of Contents
- 1. Einleitung
- 2. Speziesismus - Warum wir alle Speziesisten sind
- 2.1 Fleischkonsum
- 2.2 Tierversuche
- 3. Gleichheit und gleiche Rechte für alle?
- 4. Leidensfähigkeit als Hauptkriterium
- 6. Quellenverzeichnis
Objectives and Key Themes
Der Text befasst sich mit dem Konzept des Speziesismus und stellt die Frage, ob alle Tiere gleich sind. Der Autor, Peter Singer, argumentiert, dass die meisten Menschen Speziesisten sind, da sie die Interessen ihrer eigenen Spezies über die Interessen anderer Spezies stellen. Der Text untersucht verschiedene Aspekte dieses Problems, wie z.B. Fleischkonsum, Tierversuche und die Frage nach der Leidensfähigkeit von Tieren.
- Definition des Speziesismus und die Argumentation, dass die meisten Menschen Speziesisten sind.
- Analyse der ethischen Aspekte des Fleischkonsums und der Tierhaltung.
- Kritik an Tierversuchen und die Frage nach der moralischen Rechtfertigung.
- Die Rolle der Leidensfähigkeit von Tieren als Argument für eine gleichberechtigte Behandlung.
Chapter Summaries
- 1. Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Trend zum vegetarischen und veganen Lebensstil dar und zeigt gleichzeitig, dass trotz dieser Entwicklung der Fleischkonsum in Österreich weiterhin hoch ist. Der Autor argumentiert, dass die meisten Menschen Speziesisten sind und in ihren Lebensgewohnheiten den Interessen anderer Spezies wenig Beachtung schenken. Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein und stellt die wichtigsten Fragen, die im weiteren Verlauf des Textes behandelt werden.
- 2. Speziesismus - Warum wir alle Speziesisten sind: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Speziesismus und erklärt, warum Singer der Ansicht ist, dass die meisten Menschen Speziesisten sind. Es werden Beispiele wie Fleischkonsum und Tierversuche herangezogen, um die Argumentation zu verdeutlichen.
- 2.1 Fleischkonsum: Dieser Abschnitt untersucht die ethischen Aspekte des Fleischkonsums und argumentiert, dass die meisten Menschen Tiere lediglich als Mittel zu ihren eigenen Zwecken betrachten und ihr Leben und Wohlbefinden vernachlässigen. Singer stellt die Frage, ob der Konsum von Fleisch über den Grundbedarf nach Nahrung gerechtfertigt ist, und argumentiert, dass eine fleischreiche Ernährung unserer Gesundheit nicht unbedingt zuträglich ist. Außerdem wird kritisiert, dass das Leid, das Tieren durch nicht artgerechte Haltung zugemutet wird, in Kauf genommen wird.
- 2.2 Tierversuche: Dieser Abschnitt befasst sich mit Tierversuchen als weiteres Beispiel für Speziesismus. Singer argumentiert, dass Tiere in Tierversuchen diszipliniert werden und ihre Interessen nicht berücksichtigt werden. Er stellt die Frage, ob ein Forscher bereit wäre, ein Experiment an einem menschlichen Säugling durchzuführen, wenn dies der einzige Weg wäre, viele Leben zu retten, und betont, dass Tiere eine ebenso entwickelte Schmerzempfindlichkeit wie Säuglinge haben.
Keywords
Der Text beschäftigt sich mit den Themen Speziesismus, Tierrechte, Fleischkonsum, Tierversuche, Leidensfähigkeit, Anthropozentrismus, Gleichheit, Moral und Ethik. Die zentrale Fragestellung ist, ob alle Tiere gleich sind und ob wir uns gegenüber Tieren gegenüber ethisch verhalten. Wichtige Begriffe sind die Leidensfähigkeit von Tieren, die Unterscheidung zwischen »Nutztier« und »Haustier« und die Kritik an der anthropozentrischen Sichtweise.
- Quote paper
- Lisa Fink (Author), 2015, Speziesismus. Sind alle Tiere gleich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310256