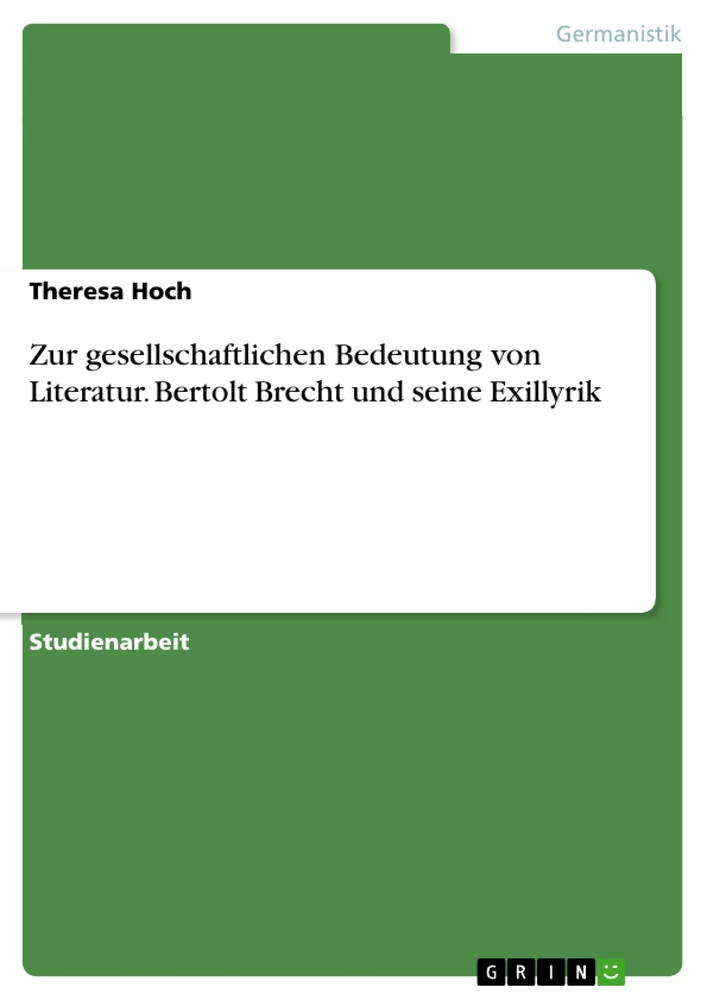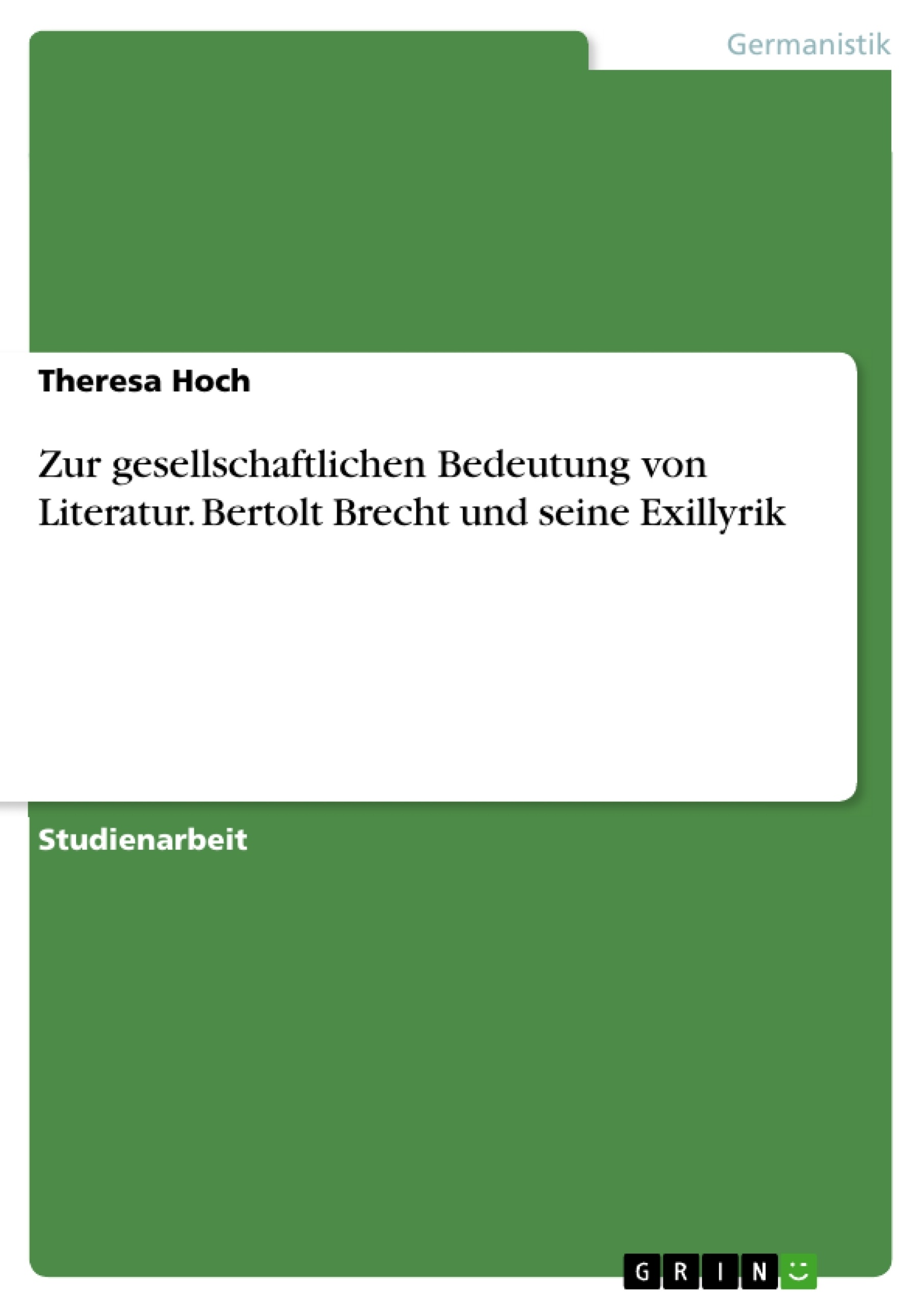Bertolt Brecht war einer von vielen deutschen Schriftstellern, die während des zweiten Weltkrieges Deutschland verlassen und im Exil weiter leben und schreiben mussten. Brecht war von Anfang an bestrebt, den aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland zu bekämpfen, was sich auch in seinen Werken widerspiegelt.
Seine Aufenthaltsorte im Exil wechselte er mehrfach; von 1933 bis 1939 hielt er sich im dänischen Küstenort Svendborg auf. Auf diesen ist der Name der „Svendborger Gedichte“ zurückzuführen, von welchen in der vorliegenden Arbeit beispielhaft zwei näher betrachtet werden sollen. Es soll außerdem, am Beispiel Brechts, die Rolle der Literatur für die Gesellschaft herausgearbeitet werden. Kann man Literatur überhaupt gesellschaftlich oder politisch betrachten, oder existiert sie unabhängig davon? Einer Antwort auf diese Frage, wie sie sich bei Brecht finden lässt, soll sich im Folgenden angenähert werden. Neben ausgewählten Werken Brechts, werden seine Sicht auf die Rolle des Exilanten, des Exils im Allgemeinen sowie Möglichkeiten des Schriftstellers im Exil der Betrachtung hinzugezogen.
Zu Brechts Meinung über die Bedeutung von Literatur in der Gesellschaft und Politik soll in der vorliegenden Arbeit eine Annäherung stattfinden. Als Beispiele sollen hier vor allem die „Svendborger Gedichte“, speziell die Gedichte „Besuch bei den verbannten Dichtern“, und „An die Nachgeborenen“ sowie seine „Kriegsfibel“ herangezogen werden. Es soll gezeigt werden, dass Brecht der Literatur eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung zuschrieb und dass er offenbar der Meinung war, Literatur könne sich zwangsläufig nicht vom gesellschaftlichen und politischen Geschehen distanzieren. Es wird dabei der Frage nachgegangen, wie Brecht mit seinem literarischen Werk, anhand einiger Beispiele aus seiner Exillyrik, Politik und Gesellschaft nicht nur kommentieren, sondern auch Anstoß zu Diskussionen geben und schließlich konkret den Faschismus bekämpfen wollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Svendborger Gedichte“
- 2.1 Zum Gedicht „Besuch bei den verbannten Dichtern“
- 2.2 Zum Gedicht „An die Nachgeborenen“
- 3. Zu Brechts „Kriegsfibel“
- 4. Zu den Wirkungsmöglichkeiten des Schriftstellers im Exil
- 5. Zu Brechts Konzept der Verfremdung
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die gesellschaftliche Bedeutung von Literatur am Beispiel Bertolt Brechts und seiner Exillyrik. Sie beleuchtet Brechts Engagement gegen den Nationalsozialismus und seine Auseinandersetzung mit der Rolle des Schriftstellers im Exil. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Gedichte und Schriften, um Brechts Auffassung von der Interdependenz von Literatur, Politik und Gesellschaft zu ergründen.
- Brechts Kampf gegen den Nationalsozialismus in seinen Werken
- Die Rolle des Schriftstellers im Exil
- Die gesellschaftliche und politische Bedeutung von Literatur
- Brechts Konzept der Verfremdung
- Analyse ausgewählter Gedichte aus den „Svendborger Gedichten“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Bertolt Brecht als einen wichtigen deutschen Schriftsteller im Exil während des Zweiten Weltkriegs vor. Sie hebt Brechts Kampf gegen den Nationalsozialismus und seine wechselnden Aufenthaltsorte im Exil hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die „Svendborger Gedichte“ und Brechts Sicht auf die Rolle der Literatur in der Gesellschaft, insbesondere die Frage nach der Unabhängigkeit von Literatur von politischen und gesellschaftlichen Kontexten. Ein Zitat aus einem Brief Brechts an Karin Michaelis unterstreicht seine Überzeugung, dass Wahrheit und Widerstand gegen Unrecht untrennbar mit dem Exil verbunden sind, was seine enge Verknüpfung von Politik und Literatur aufzeigt. Die Arbeit kündigt die Analyse ausgewählter Werke Brechts an, um seine Position zu beleuchten.
2. „Svendborger Gedichte“: Dieses Kapitel behandelt die Lyriksammlung „Svendborger Gedichte“, entstanden während Brechts Exil in Svendborg (Dänemark) zwischen 1933 und 1939. Die Sammlung, die laut Kittstein den Höhepunkt von Brechts Exillyrik darstellt, wird als Ausdruck von Brechts Anteilnahme am politischen Geschehen in Deutschland beschrieben. Die Gedichte thematisieren die schwierige Situation der Exilanten und Brechts Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als Emigrant, Vertriebenen und Verbanntem. Die Sammlung wird als durchzogen vom Bewusstsein der Bedrohung durch den Faschismus beschrieben, selbst in scheinbar unpolitischen Gedichten. Die Kapitel befasst sich mit dem Bewusstsein der Bedrohung durch den Faschismus, das auch in vermeintlich einfachen Kinderliedern spürbar ist.
2.1 Zum Gedicht „Besuch bei den verbannten Dichtern“: Die Analyse des Gedichts „Besuch bei den verbannten Dichtern“ fokussiert auf das Aufeinandertreffen eines namenlosen „Er“ (stellvertretend für den modernen Dichter) mit verbannten Dichtern aus verschiedenen Epochen. Kuhn verweist auf Anklänge an Dantes „Göttliche Komödie“. Das Gedicht zeigt die Ambivalenz des Exils als sowohl Auszeichnung als auch infernalische Erfahrung. Der Dialog zwischen den Dichtern, die auch als Lehrer fungieren, wird als positive, engagierte und kritische Debatte interpretiert. Die Ambivalenz von Selbstverleugnung und Selbstbestätigung des „Er“ und sein Schweigen am Ende des Gedichts werden als Ausdruck des Bewusstseins seiner Bedeutungslosigkeit gedeutet. Die Begegnung mit großen Dichternamen der Vergangenheit betont den Aspekt des Erinnerns und der Gefahr des Vergessens.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Analyse der Exillyrik Bertolt Brechts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die gesellschaftliche Bedeutung von Literatur anhand des Werks Bertolt Brechts und seiner Exillyrik. Der Fokus liegt auf Brechts Engagement gegen den Nationalsozialismus und seiner Auseinandersetzung mit der Rolle des Schriftstellers im Exil. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Gedichte und Schriften, um Brechts Auffassung von der Interdependenz von Literatur, Politik und Gesellschaft zu ergründen.
Welche Texte werden im Einzelnen untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem Brechts "Svendborger Gedichte", insbesondere die Gedichte "Besuch bei den verbannten Dichtern" und "An die Nachgeborenen". Darüber hinaus werden Brechts "Kriegsfibel" und sein Konzept der Verfremdung behandelt. Die Arbeit bezieht sich auch auf Briefe Brechts, um seine Überzeugungen und seine Sicht auf die Rolle der Literatur im Exil zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Brechts Kampf gegen den Nationalsozialismus in seinen Werken; die Rolle des Schriftstellers im Exil; die gesellschaftliche und politische Bedeutung von Literatur; Brechts Konzept der Verfremdung; und die Analyse ausgewählter Gedichte aus den „Svendborger Gedichten“. Es wird die Ambivalenz des Exils als Auszeichnung und infernalische Erfahrung beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, "Svendborger Gedichte" (mit Unterkapiteln zu einzelnen Gedichten), Brechts "Kriegsfibel", die Wirkungsmöglichkeiten des Schriftstellers im Exil, Brechts Konzept der Verfremdung und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung und Analyse der relevanten Aspekte.
Welche Bedeutung haben die "Svendborger Gedichte" für die Arbeit?
Die "Svendborger Gedichte" bilden den zentralen Gegenstand der Analyse. Sie werden als Ausdruck von Brechts Anteilnahme am politischen Geschehen in Deutschland und als Reflexion seiner eigenen Situation als Emigrant und Verbanntem interpretiert. Die Arbeit untersucht, wie in diesen Gedichten Brechts Auseinandersetzung mit dem Faschismus und seine Sicht auf die Rolle der Literatur zum Ausdruck kommen.
Wie wird das Gedicht "Besuch bei den verbannten Dichtern" interpretiert?
Die Analyse des Gedichts "Besuch bei den verbannten Dichtern" konzentriert sich auf das Aufeinandertreffen eines namenlosen "Er" mit verbannten Dichtern verschiedener Epochen. Es wird die Ambivalenz des Exils als Auszeichnung und infernalische Erfahrung hervorgehoben, und der Dialog zwischen den Dichtern als positive, engagierte und kritische Debatte interpretiert. Das Schweigen des "Er" am Ende wird als Ausdruck des Bewusstseins seiner eigenen Bedeutungslosigkeit gedeutet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Brechts Exillyrik ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Rolle des Schriftstellers im Exil darstellt. Seine Werke zeigen die enge Verknüpfung von Literatur, Politik und Gesellschaft und beleuchten die Ambivalenzen und Herausforderungen des Exils. Die Analyse ausgewählter Gedichte veranschaulicht Brechts Fähigkeit, politische und gesellschaftliche Themen in künstlerisch anspruchsvoller Weise zu verarbeiten.
- Quote paper
- Theresa Hoch (Author), 2013, Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur. Bertolt Brecht und seine Exillyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310186