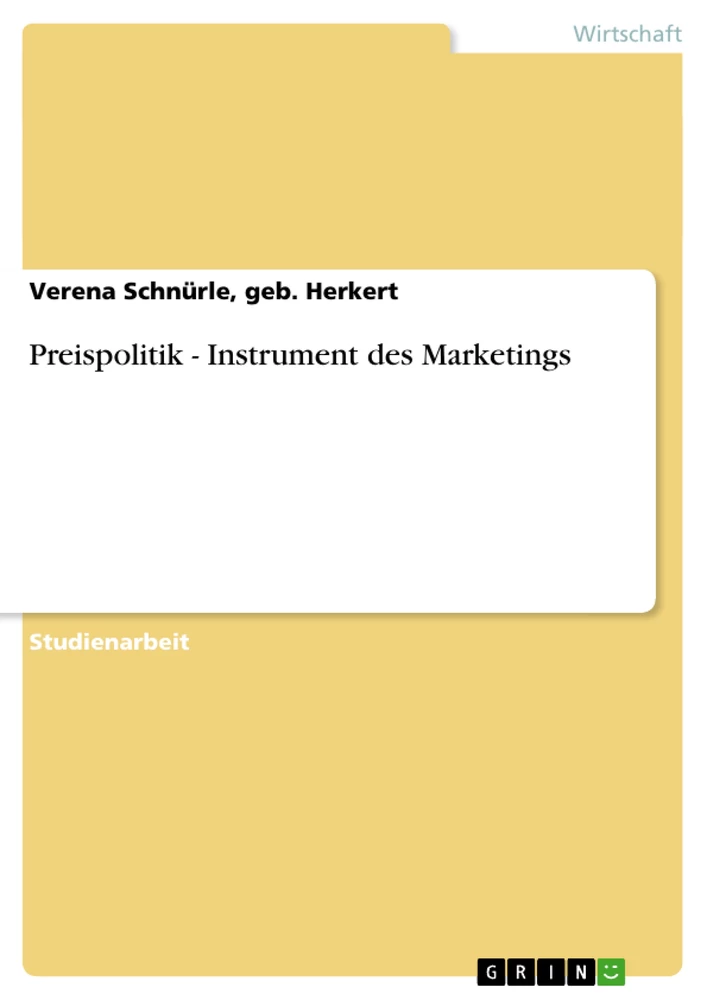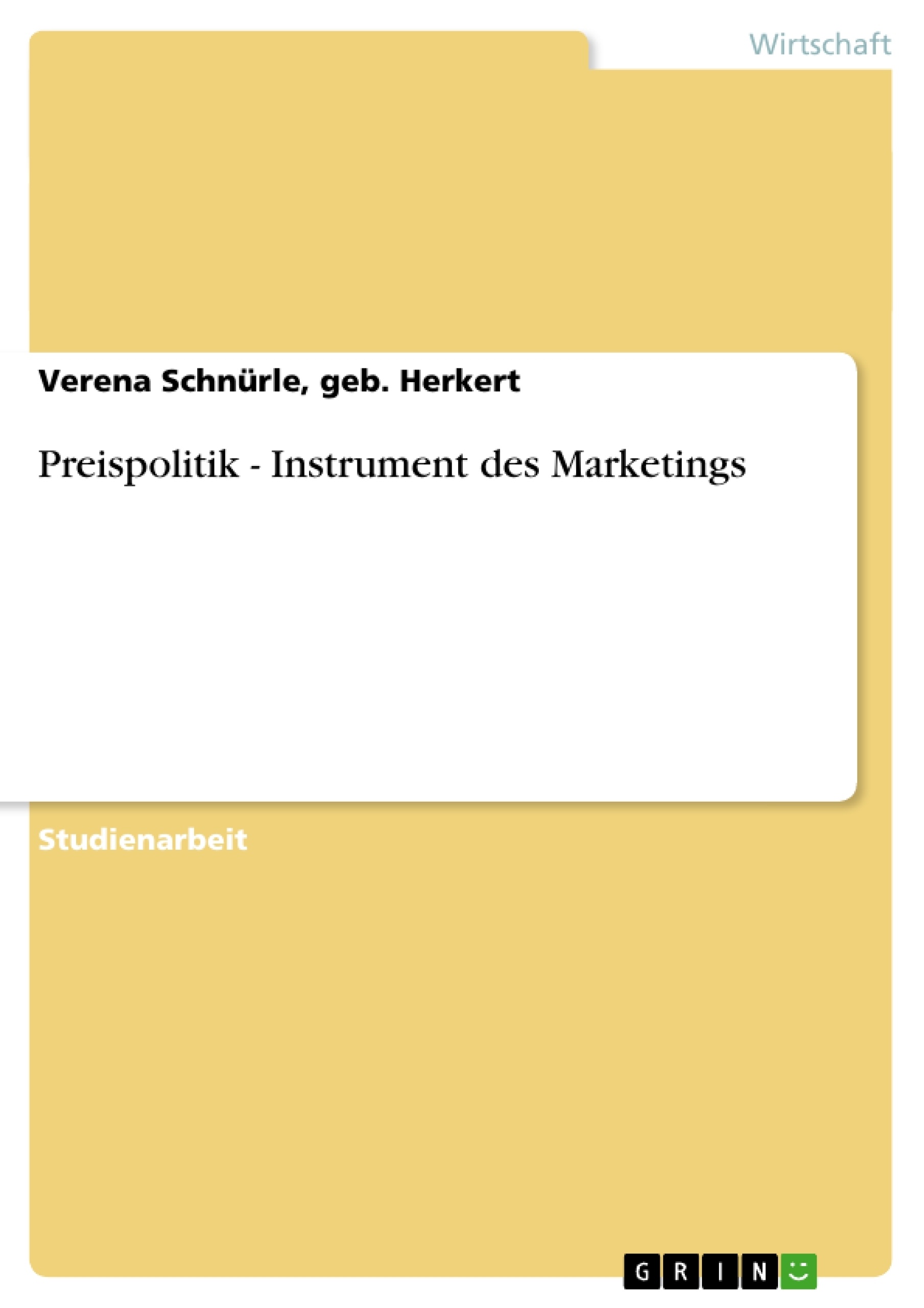Einleitung
Zwischen 1949 und 1965 lässt sich eine erste Phase der Marketing-Entwicklung erkennen. In dieser auch als Nachkriegszeit bezeichneten Periode übersteigt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen das Angebot bei weitem. Es entstand ein Verkäufermarkt, bei dem die Verkäufer die Marktmacht besaßen, d.h. die Verkäufer bestimmten die Regeln, die auf dem Markt herrschten. Marketing lässt sich in dieser Phase als Vermarktung oder Verteilung von Waren umschreiben und meint die mit dem Absatz von Gütern und Dienstleistungen verbundene technische Aufgabenerfüllung (Schaffung von Lager- und Transportkapazitäten usw.).
Die Marketingsituation änderte sich ungefähr ab Mitte der 60er Jahre als der Nachholbedarf nach dem Krieg weitgehend befriedigt war. Erfolgreiche Massenproduktion, steigende Kaufkraft, Liberalisierung der Märkte usw. führten dazu, dass sich die Märkte zu so genannten Käufermärken wandelten, die durch Überangebot, wachsende Konkurrenz und durch zunehmende Nachfragemacht der Abnehmer gekennzeichnet sind. So wurde das Marketing notwendig um sich beispielsweise von der Konkurrenz durch bestimmte marketingpolitische Maßnahmen abzusetzen und ist in einer Überflusswirtschaft, wie wir sie heute vorfinden, fast allgegenwärtig. Vom Hersteller- Marketing aus entwickelten sich eine ganze Reihe von Varianten des Marketing, u.a. auch das Handels-Marketing, Dienstleisungs-Marketing, Kultur-Marketing etc. Lange Zeit war der Handel für das Marketing des Herstellers lediglich ein „Absatzmittler“ ein „Absatzkanal“. Mit fortschreitendem Konzentrationsprozess entstand Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ein eigenständiges Handels- Marketing, das andere Schwerpunkte setzt und sich in manchen Punkten im Konflikt mit dem Hersteller- Marketing befindet. Das Handels-Marketing unterscheidet sich in wesentlichen Punkten eindeutig vom Hersteller- Marketing. Diese Unterschiede ergeben sich aus den Eigenarten des Handelsbetriebs. So hat der Standort besonders im Einzelhandel ein viel stärkeres Gewicht als bei den Herstellern, es werden Sortimente statt einzelner Produkte geführt und das Handels- Marketing ist unternehmensorientiert, das Hersteller-Marketing produktorientiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Der Begriff „Preispolitik“
- 2.2 Ziele der Preispolitik
- 3 Prinzipien der Preisbildung
- 3.1 Kostenorientierte Preisbildung
- 3.1.1 Preiskalkulation auf Vollkostenbasis
- 3.1.2 Preiskalkulation auf Teilkostenbasis
- 3.2 Nachfrageorientierte Preisbildung
- 3.2.1 Preisvorstellungen
- 3.2.2 Preisbereitschaft
- 3.2.3 Preisklassen
- 3.2.4 Psychologische Preise
- 3.3 Konkurrenzorientierte Preisbildung
- 3.3.1 Preisfestsetzung unterhalb der Konkurrenzpreise
- 3.3.2 Preisfestsetzung auf dem Niveau der Konkurrentenpreise
- 3.3.3 Preisfestsetzung oberhalb der Konkurrenzpreise
- 3.1 Kostenorientierte Preisbildung
- 4 Aspekte einer marktorientierten Preispolitik
- 4.1 Preisdifferenzierung
- 4.1.1 Räumliche Preisdifferenzierung
- 4.1.2 Zeitliche Preisdifferenzierung
- 4.1.3 Mengenmäßige Preisdifferenzierung
- 4.1.4 Personelle Preisdifferenzierung
- 4.2 Sonderangebotpolitik
- 4.3 Psychologische Preisbildung
- 4.3.1 Preisinteresse
- 4.3.2 Preiswahrnehmung
- 4.1 Preisdifferenzierung
- 5 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erläutert die Preispolitik im Handel, insbesondere im Kontext der Entwicklung vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Ziel ist es, die verschiedenen Prinzipien der Preisbildung zu beschreiben und ihre Anwendung im Handel zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Kosten-, Nachfrage- und Konkurrenzorientierung gelegt.
- Entwicklung der Preispolitik im Handel
- Prinzipien der kostenorientierten Preisbildung
- Einfluss von Nachfrage und Konkurrenz auf die Preisgestaltung
- Marktorientierte Aspekte der Preispolitik
- Psychologische Preisgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entwicklung des Marketings von der Nachkriegszeit mit Verkäufermärkten bis hin zu heutigen Käufermärkten mit Überangebot und stärkerer Konkurrenz. Es wird der Unterschied zwischen Hersteller- und Handelsmarketing herausgestellt, wobei letzteres aufgrund der zunehmenden Marktkomplexität und unterschiedlicher Zielsetzungen (z.B. Einführungspreise, Handelsspannen) immer wichtiger wird. Die Arbeit fokussiert sich auf die Preispolitik als zentrales Instrument des Handelsmarketings.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Preispolitik als die Summe aller Maßnahmen zur Bestimmung und Durchsetzung der monetären Gegenleistung für angebotene Waren und Dienstleistungen. Es werden die Ziele der Preispolitik erläutert, wobei die langfristige Gewinnmaximierung zwar im Vordergrund steht, aber auch markt- und betriebsgerichtete Ziele wie Kundenbindung, Marktanteilsgewinnung und Arbeitsplatzsicherung eine Rolle spielen. Der zeitliche Bezug der Zielsetzungen wird als entscheidender Faktor hervorgehoben.
3 Prinzipien der Preisbildung: Dieses Kapitel beschreibt die drei Hauptprinzipien der Preisbildung: die kostenorientierte, die nachfrageorientierte und die konkurrenzorientierte Preisbildung. Im Detail wird die kostenorientierte Preisbildung anhand der Vollkostenrechnung (mit Beispielrechnung) erklärt. Die nachfrageorientierte Preisbildung berücksichtigt die Preisvorstellungen und -bereitschaft der Kunden sowie die Möglichkeiten der Preisklassenbildung und psychologischer Preisgestaltung. Die konkurrenzorientierte Preisbildung betrachtet die Preisgestaltung der Konkurrenz und die möglichen Strategien (unterhalb, auf dem Niveau, oberhalb).
4 Aspekte einer marktorientierten Preispolitik: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte einer marktorientierten Preispolitik. Dazu gehört die Preisdifferenzierung (räumlich, zeitlich, mengenmäßig, personell) als Instrument zur Anpassung an unterschiedliche Marktsegmente. Die Sonderangebotpolitik und die psychologische Preisbildung mit ihren Auswirkungen auf das Preisinteresse und die Preiswahrnehmung der Kunden werden ebenfalls erläutert.
Schlüsselwörter
Preispolitik, Handelsmarketing, Kostenorientierte Preisbildung, Nachfrageorientierte Preisbildung, Konkurrenzorientierte Preisbildung, Preisdifferenzierung, Psychologische Preisgestaltung, Gewinnmaximierung, Käufermarkt, Verkäufermarkt.
Häufig gestellte Fragen zur Preispolitik im Handel
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Preispolitik im Handel. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Prinzipien der Preisbildung (kostenorientiert, nachfrageorientiert, konkurrenzorientiert) und deren Anwendung im Kontext der Entwicklung vom Verkäufer- zum Käufermarkt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Preispolitik, Prinzipien der Preisbildung, Aspekte einer marktorientierten Preispolitik und Schlusswort. Jedes Kapitel wird im Dokument detailliert zusammengefasst.
Was sind die zentralen Themen der Preispolitik, die behandelt werden?
Die zentralen Themen sind die verschiedenen Prinzipien der Preisbildung: kostenorientierte Preisbildung (Vollkosten- und Teilkostenrechnung), nachfrageorientierte Preisbildung (Preisvorstellungen, -bereitschaft, -klassen, psychologische Preise), und konkurrenzorientierte Preisbildung (Preisfestsetzung unterhalb, auf dem Niveau und oberhalb der Konkurrenzpreise). Zusätzlich werden marktorientierte Aspekte wie Preisdifferenzierung (räumlich, zeitlich, mengenmäßig, personell), Sonderangebote und psychologische Preisgestaltung behandelt.
Wie wird die kostenorientierte Preisbildung erklärt?
Die kostenorientierte Preisbildung wird anhand der Vollkostenrechnung detailliert erläutert, inklusive eines Beispiels. Es wird auch die Teilkostenrechnung erwähnt.
Wie wird die nachfrageorientierte Preisbildung beschrieben?
Die nachfrageorientierte Preisbildung berücksichtigt die Preisvorstellungen und -bereitschaft der Kunden, die Bildung von Preisklassen und die Anwendung psychologischer Preise.
Welche Aspekte der konkurrenzorientierten Preisbildung werden behandelt?
Die konkurrenzorientierte Preisbildung betrachtet die Preisgestaltung der Konkurrenz und die Strategien der Preisfestsetzung: unterhalb, auf dem Niveau oder oberhalb der Konkurrenzpreise.
Welche marktorientierten Aspekte der Preispolitik werden diskutiert?
Marktorientierte Aspekte umfassen die Preisdifferenzierung (räumlich, zeitlich, mengenmäßig, personell), Sonderangebotpolitik und psychologische Preisgestaltung (Preisinteresse und -wahrnehmung).
Welche Ziele verfolgt die Preispolitik im Handel?
Die langfristige Gewinnmaximierung steht im Vordergrund, aber auch markt- und betriebsgerichtete Ziele wie Kundenbindung, Marktanteilsgewinnung und Arbeitsplatzsicherung spielen eine Rolle. Der zeitliche Bezug der Zielsetzungen ist entscheidend.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Schlüsselwörter umfassen: Preispolitik, Handelsmarketing, Kostenorientierte Preisbildung, Nachfrageorientierte Preisbildung, Konkurrenzorientierte Preisbildung, Preisdifferenzierung, Psychologische Preisgestaltung, Gewinnmaximierung, Käufermarkt, Verkäufermarkt.
Wie entwickelt sich die Preispolitik im Kontext von Verkäufer- und Käufermärkten?
Das Dokument beschreibt die Entwicklung der Preispolitik vom Verkäufermarkt der Nachkriegszeit mit Knappheit an Gütern hin zum heutigen Käufermarkt mit Überangebot und stärkerer Konkurrenz. Die zunehmende Komplexität des Marktes und die unterschiedlichen Zielsetzungen im Hersteller- und Handelsmarketing werden hervorgehoben.
- Arbeit zitieren
- Verena Schnürle, geb. Herkert (Autor:in), 2002, Preispolitik - Instrument des Marketings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30983