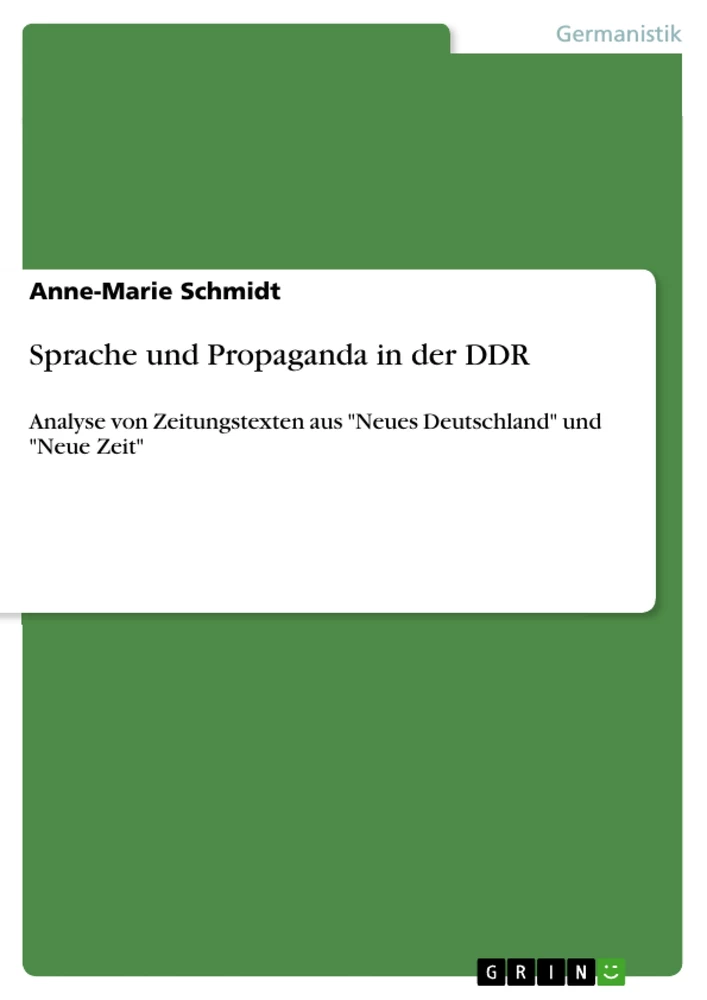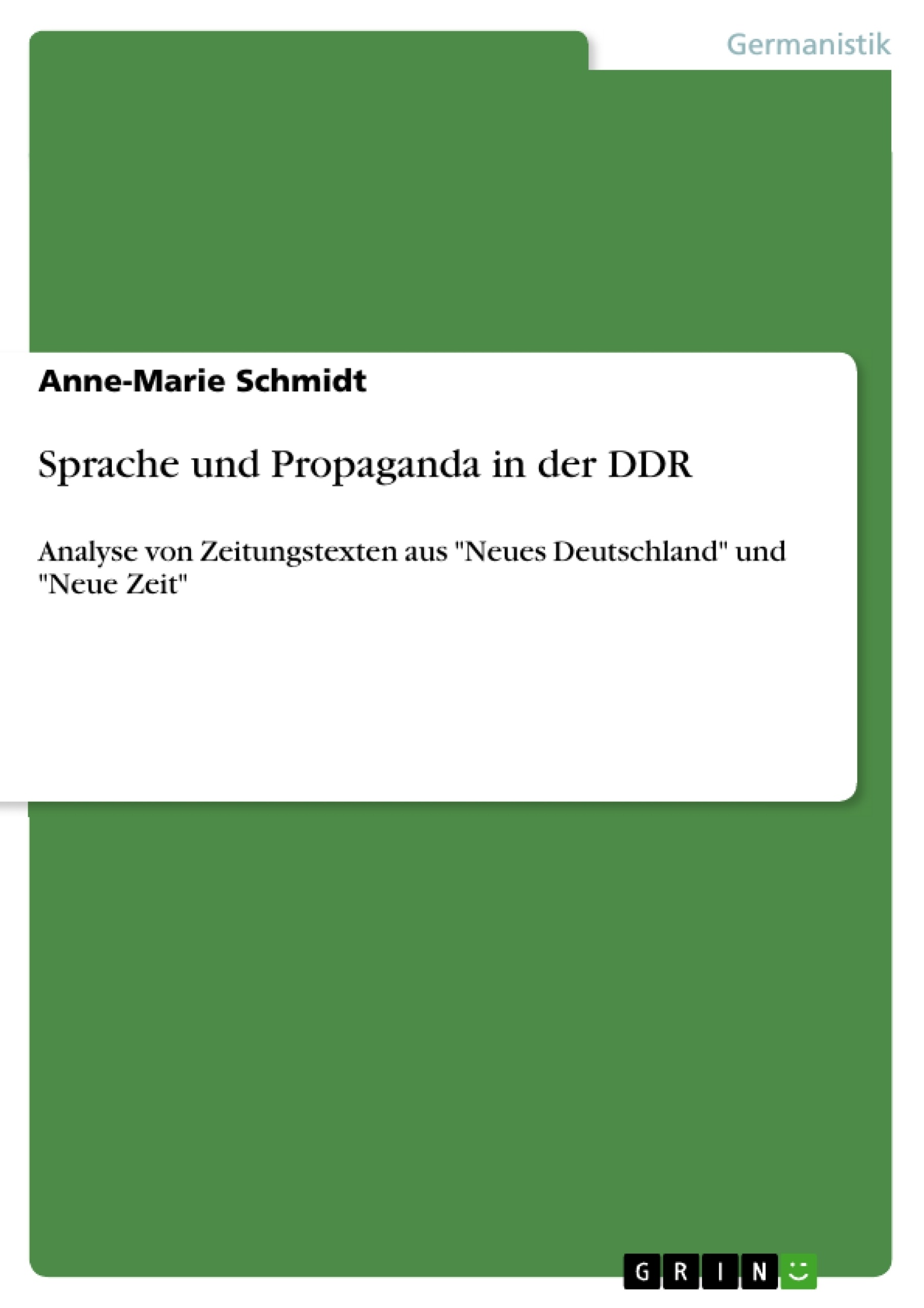Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Gesellschaften der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) aufgrund der politischen Prägung unterschiedlich voneinander entwickelten. Diese Arbeit möchte einen kleinen Beitrag zur Analyse der Mediensprache der DDR in den Tageszeitungen Neues Deutschland (ND) und Neue Zeit (NZ) liefern. Zunächst werden die Eckpunkte der Entwicklung der DDR-Sprache umrissen. Danach werden sprachliche Aspekte analysiert und mit Beispielen aus Zeitungsartikeln zum Thema des Boykotts der Olympischen Spiele 1980 in Moskau belegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklung der DDR-Sprache
- 3. Analyse der sprachlichen Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Mediensprache der DDR, insbesondere in den Tageszeitungen „Neues Deutschland“ und „Neue Zeit“. Ziel ist es, einen Beitrag zum Verständnis der sprachlichen Entwicklungen in der DDR im Vergleich zur BRD zu leisten und die Besonderheiten der DDR-Mediensprache aufzuzeigen.
- Entwicklung der DDR-Sprache im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse
- Unterschiede zwischen der Sprache der DDR und der BRD
- Analyse sprachlicher Aspekte der DDR-Mediensprache anhand von Beispielen
- Der Einfluss der Politik auf die Sprachgestaltung in den Medien
- Vergleich der gesprochenen und geschriebenen Sprache in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt die These auf, dass sich die Sprachen in der BRD und DDR aufgrund unterschiedlicher politischer Prägungen auseinanderentwickelten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Mediensprache in den Tageszeitungen „Neues Deutschland“ und „Neue Zeit“, wobei zunächst die Entwicklung der DDR-Sprache umrissen und anschließend sprachliche Aspekte analysiert werden, belegt durch Beispiele aus Zeitungsartikeln zum Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau.
2. Entwicklung der DDR-Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Sprache in der DDR und vergleicht sie mit der Entwicklung in der BRD. Es wird deutlich, dass linguistische Untersuchungen in beiden Staaten von unterschiedlichen politischen Prämissen ausgegangen sind und die Ergebnisse entsprechend beeinflusst wurden. In der DDR unterlagen linguistische Arbeiten strengen Vorgaben und wurden auf die Legitimierung des Systems ausgerichtet. Die Analyse zeigt die zunehmende Auseinanderentwicklung der Sprachen, wobei die DDR ihre Sprache als progressiv und die der BRD als rückschrittlich darstellte. Das Kapitel beschreibt die Etablierung des „Arbeiter- und Bauernstaates“ und seinen Einfluss auf die Sprache, die zunehmende Abgrenzung von der BRD und die Entwicklung einer eigenen Nationalsprache. Die gesellschaftliche Stagnation nach Helsinki 1973 und die weiterhin strengen Vorgaben für die Medien werden ebenfalls thematisiert. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Mediensprache nicht den Sprachgebrauch der gesamten Bevölkerung widerspiegelt.
Schlüsselwörter
DDR-Sprache, Mediensprache, Neues Deutschland, Neue Zeit, Propaganda, Sprachvergleich, BRD, politische Einflussnahme, Linguistik, Sprachentwicklung, Lexik, Syntax, Stilistik.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der DDR-Mediensprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Mediensprache der DDR, insbesondere in den Tageszeitungen „Neues Deutschland“ und „Neue Zeit“. Sie untersucht die sprachlichen Entwicklungen in der DDR im Vergleich zur BRD und zeigt die Besonderheiten der DDR-Mediensprache auf.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Ziel ist ein Beitrag zum Verständnis der sprachlichen Entwicklungen in der DDR im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Es werden die Unterschiede zur Sprache der BRD untersucht, der Einfluss der Politik auf die Sprachgestaltung analysiert und gesprochene und geschriebene Sprache verglichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der DDR-Sprache im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die Unterschiede zwischen der Sprache der DDR und der BRD, sprachliche Aspekte der DDR-Mediensprache anhand von Beispielen, den Einfluss der Politik auf die Sprachgestaltung in den Medien und den Vergleich der gesprochenen und geschriebenen Sprache in der DDR.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung der DDR-Sprache, ein Kapitel zur Analyse sprachlicher Aspekte und eine Zusammenfassung der Kapitel. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter genannt.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Zielsetzung und stellt die These auf, dass sich die Sprachen in der BRD und DDR aufgrund unterschiedlicher politischer Prägungen auseinanderentwickelten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Mediensprache in „Neues Deutschland“ und „Neue Zeit“.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Entwicklung der DDR-Sprache?
Dieses Kapitel vergleicht die Sprachentwicklung in der DDR und BRD, beleuchtet den Einfluss unterschiedlicher politischer Prämissen auf linguistische Untersuchungen und zeigt die zunehmende Auseinanderentwicklung der Sprachen auf. Es beschreibt die Etablierung des „Arbeiter- und Bauernstaates“ und seinen Einfluss auf die Sprache, die Abgrenzung von der BRD und die Entwicklung einer eigenen Nationalsprache. Die gesellschaftliche Stagnation nach Helsinki 1973 und die strengen Vorgaben für die Medien werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: DDR-Sprache, Mediensprache, Neues Deutschland, Neue Zeit, Propaganda, Sprachvergleich, BRD, politische Einflussnahme, Linguistik, Sprachentwicklung, Lexik, Syntax, Stilistik.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Analyse verwendet Beispiele aus Zeitungsartikeln zum Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau.
Spiegelt die Mediensprache den Sprachgebrauch der gesamten Bevölkerung wider?
Nein, die Arbeit betont, dass die Mediensprache nicht den Sprachgebrauch der gesamten Bevölkerung widerspiegelt.
Welche These wird aufgestellt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass sich die Sprachen in der BRD und DDR aufgrund unterschiedlicher politischer Prägungen auseinanderentwickelten.
- Quote paper
- B.A. Anne-Marie Schmidt (Author), 2015, Sprache und Propaganda in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309719