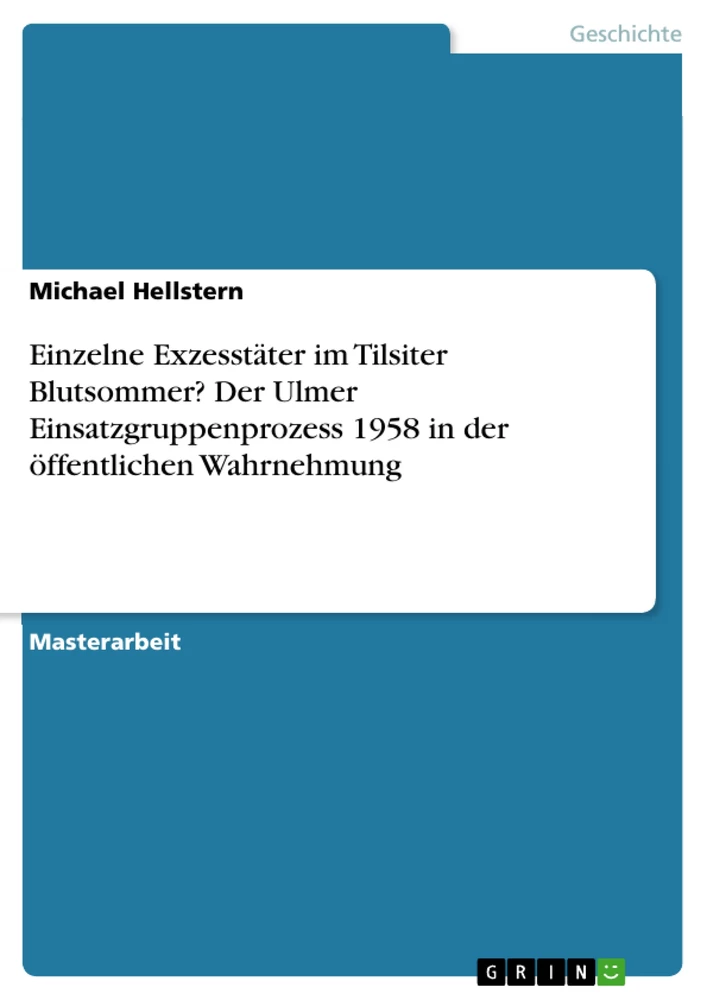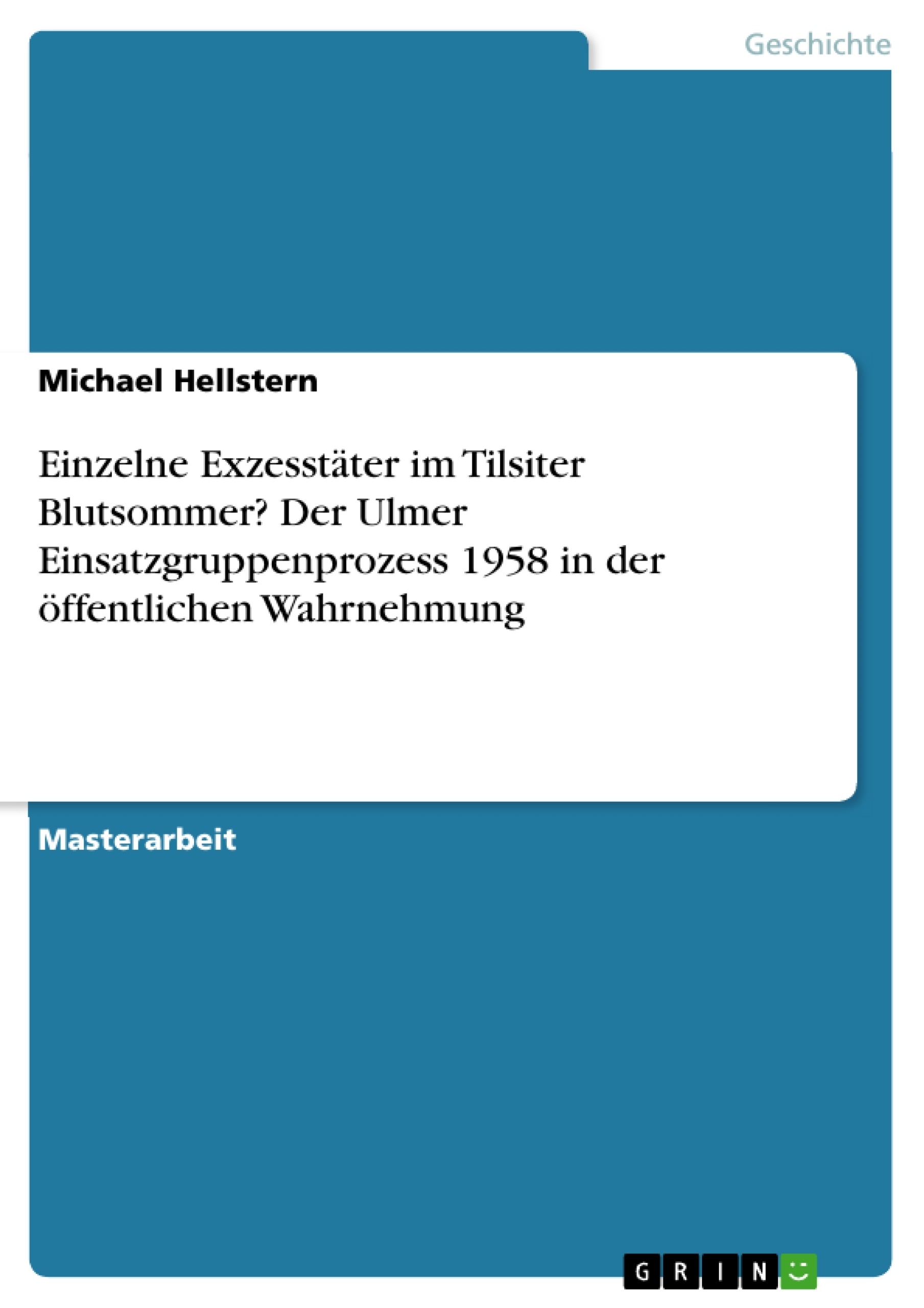Während des Zweiten Weltkrieges ermordete das sogenannte „Einsatzkommando Tilsit“ Tausende von Juden im Grenzgebiet zwischen dem Deutschen Reich und Litauen. 1958 wurden zehn Mitglieder des Kommandos im Ulmer Einsatzgruppenprozess wegen ihrer Teilnahme vor Gericht gestellt. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess war der erste derartige Prozess vor einem deutschen Gericht. Obwohl er zu einem Wandel im Umgang mit NS-Gewaltverbrechen in der Bundesrepublik beitrug, bleibt er im Vergleich zum Auschwitz-Prozess (1964-65) relativ unerforscht. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Monographie zum Thema.
Gegenstand der Masterarbeit ist die Wahrnehmung des Prozesses in der deutschen Öffentlichkeit. Die Arbeit basiert auf Archivakten im Staatsarchiv Ludwigsburg, auf einer Auswertung von zeitgenössischen Artikeln aus mehreren Zeitungen, auf Meinungsumfragen aus der Zeit des Prozesses, sowie auf Sekundärliteratur. Besonders wichtig für die Arbeit ist eine Sammlung von etwa 100 Briefen von Bundesbürgern an das Ulmer Schwurgericht.
Obwohl die Mehrheit der Westdeutschen die justizielle Aufarbeitung der Verbrechen unterstützte, war die Minderheit, die einen „Schlussstrich“ verlangte, beträchtlich. Vor diesem Hintergrund bietet die Arbeit eine detailreiche Analyse der Briefe von Bürgern an das Ulmer Schwurgericht gegen Ende der 50er Jahre. 60 Prozent der Briefschreiber waren dem Prozess gegenüber positiv eingestellt, während 37 Prozent den Prozess verurteilten. Die Briefe sind nicht mit einer wissenschaftlichen Stichprobe gleichzusetzen, bieten aber trotzdem Einsicht in das Denken der Menschen.
Die Befürworter des Prozesses gingen davon aus, dass Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ihrer Ansicht nach waren solche Verfahren wichtig, um den Ruf der Bundesrepublik zu retten. In den prozesskritischen Briefen zeigte sich hingegen die Hartnäckigkeit von NS-Gedankengängen und von Antisemitismus sowie das Ausmaß der Selbststilisierung zu Opfern unter den Deutschen. Die Schriftstücke verdeutlichten deren Überzeugung, dass solche Prozesse Störfaktoren beim Wiederaufbau des Landes waren. Durch seine sorgfältige Analyse der Briefe ist es dem Verfasser gelungen, die Denkweise hinter den aus Meinungsumfragen des Allensbacher Instituts stammenden Zahlen zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Forschungsüberblick
- 2. Quellenüberblick
- II. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess
- 1. Justizielle Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der BRD
- 2. Die deutsche Gesellschaft 1958 – Zeitgeschehen während des Prozesses
- a. „Blutrichter-Kampagne“ der DDR ab Mai 1957
- b. Bayreuther Prozess gegen KZ-Arrestverwalter Martin Sommer
- c. Prozess gegen KZ-Arzt Hanns Eisele
- 3. Tätigkeiten der Einsatzgruppe A im Dritten Reich
- a. Einsatzgruppe A
- b. Durchführung der ersten Erschießung durch das Einsatzkommando Tilsit
- 4. Ermittlungen gegen Bernhard Fischer-Schweder
- a. Fischer-Schweders Untertauchen nach dem Krieg
- b. Die Enttarnung Fischer-Schweders
- c. Ausweitung der Ermittlungen
- d. Anklageerhebung
- 5. Der Prozessverlauf
- a. Die Ankläger
- b. Zeugenprobleme
- c. Verteidigungsstrategie
- d. Urteilsverkündung
- III. Der Prozess im Spiegel der Medien
- 1. Medienberichterstattung über NS-Verbrechen
- 2. Berichterstattung über die Verfahrenseröffnung am 28. April 1958
- 3. August 1958: Verteidiger und Staatsanwälte halten ihre Plädoyers
- 4. Berichterstattung über das Urteil
- 5. NS-Verbrecher als kriminelle Einzeltäter
- 6. Wandel in der Presseberichterstattung 1958
- IV. Die öffentliche Wahrnehmung - Briefe von Außenstehenden an das Gericht
- 1. Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach
- 2. Quellenbasis: Briefe an das Gericht
- 3. Negative Reaktionen auf den Prozess
- 4. Positive Reaktionen auf den Prozess
- 5. Unentschiedene Reaktionen
- 6. Die Rolle des Ulmer Einsatzgruppenprozesses und seine Auswirkungen
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Wahrnehmung des Ulmer Einsatzgruppenprozesses von 1958 in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, zu ergründen, wie die breite Bevölkerung auf den Prozess reagierte und ob dieser einen Wandel im Umgang mit der NS-Vergangenheit bewirkte. Die Analyse stützt sich auf Medienberichte und Briefe an das Gericht.
- Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der frühen BRD
- Die Rolle der Medien in der Berichterstattung über den Prozess
- Die öffentliche Meinung zum Prozess und die Frage nach einem möglichen gesellschaftlichen Umbruch
- Die Darstellung der Angeklagten als Einzeltäter im Kontext der NS-Verbrechen
- Der Vergleich der öffentlichen Meinung mit Umfrageergebnissen des Allensbacher Instituts
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Ulmer Einsatzgruppenprozesses ein, der als Wendepunkt im Umgang der bundesdeutschen Justiz und Öffentlichkeit mit nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gilt. Sie skizziert den Forschungsstand, der als spärlich beschrieben wird, und benennt die zentrale Forschungsfrage nach der zeitgenössischen öffentlichen Wahrnehmung des Prozesses und einem möglichen gesellschaftlichen Wandel. Die methodische Vorgehensweise wird umrissen, die sich auf die Analyse von Medienberichten und Briefen an das Gericht konzentriert, um ein differenziertes Bild der öffentlichen Meinung zu zeichnen, unter Berücksichtigung der Limitationen rein pressebasierter Analysen.
II. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess detailliert, beginnend mit der justiziellen Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der BRD und dem Kontext des Zeitgeschehens 1958 (einschließlich der "Blutrichter-Kampagne" der DDR). Es beleuchtet die Tätigkeiten der Einsatzgruppe A und die Ermittlungen gegen Bernhard Fischer-Schweder, deren Verlauf vom Untertauchen des Hauptverdächtigen bis zur Anklageerhebung detailliert dargestellt wird. Der Prozessverlauf selbst wird im Hinblick auf Ankläger, Zeugenprobleme, die Verteidigungsstrategie und die Urteilsverkündung analysiert. Der Fokus liegt auf der Gesamtbetrachtung des Prozesses, nicht auf den Einzelheiten der Unterkapitel.
III. Der Prozess im Spiegel der Medien: Dieses Kapitel analysiert die Medienberichterstattung über den Ulmer Einsatzgruppenprozess. Es untersucht, wie die Presse über den Prozess berichtete, ob die Angeklagten als Einzeltäter dargestellt wurden und ob eine kritische Öffentlichkeit existierte. Die Entwicklung der Berichterstattung im Laufe des Prozesses und der darauffolgende Wandel in der Presseberichterstattung werden untersucht, in ihrer Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung.
IV. Die öffentliche Wahrnehmung - Briefe von Außenstehenden an das Gericht: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Untersuchung der öffentlichen Meinung anhand von Briefen, die an das Ulmer Gericht geschrieben wurden. Diese werden mit Umfrageergebnissen des Allensbacher Instituts verglichen, um ein umfassendes Bild der öffentlichen Reaktion auf den Prozess zu erstellen. Die Analyse untersucht sowohl positive als auch negative Reaktionen und bewertet deren Bedeutung für die Einschätzung des gesellschaftlichen Einflusses des Prozesses.
Schlüsselwörter
Ulmer Einsatzgruppenprozess, NS-Verbrechen, öffentliche Wahrnehmung, Medienberichterstattung, Bundesrepublik Deutschland, 1958, Zeitgeschichte, kollektive Schuld, Einzeltäterthese, Justiz, öffentliche Meinung, Allensbacher Institut, Vergangenheitsbewältigung, Fischer-Schweder, Einsatzkommando Tilsit.
Häufig gestellte Fragen zum Ulmer Einsatzgruppenprozess (1958)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die öffentliche Wahrnehmung des Ulmer Einsatzgruppenprozesses von 1958 in der Bundesrepublik Deutschland. Im Fokus steht die Reaktion der Bevölkerung auf den Prozess und die Frage, ob dieser einen Wandel im Umgang mit der NS-Vergangenheit bewirkte.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Analyse basiert auf Medienberichten und Briefen von Außenstehenden an das Gericht. Zusätzlich werden Umfrageergebnisse des Allensbacher Instituts herangezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der frühen BRD, die Rolle der Medien in der Berichterstattung, die öffentliche Meinung zum Prozess, die Darstellung der Angeklagten als Einzeltäter und den Vergleich der öffentlichen Meinung mit Umfrageergebnissen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Ulmer Einsatzgruppenprozess, Der Prozess im Spiegel der Medien, Die öffentliche Wahrnehmung - Briefe von Außenstehenden an das Gericht und Schluss. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt den Ulmer Einsatzgruppenprozess vor, skizziert den Forschungsstand und benennt die zentrale Forschungsfrage nach der zeitgenössischen öffentlichen Wahrnehmung des Prozesses und einem möglichen gesellschaftlichen Wandel. Die methodische Vorgehensweise wird ebenfalls umrissen.
Was wird im Kapitel "Der Ulmer Einsatzgruppenprozess" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Prozess detailliert, einschließlich der justiziellen Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der BRD, der Tätigkeiten der Einsatzgruppe A, der Ermittlungen gegen Bernhard Fischer-Schweder und dem Prozessverlauf selbst (Ankläger, Zeugen, Verteidigung, Urteil).
Was wird im Kapitel "Der Prozess im Spiegel der Medien" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Medienberichterstattung über den Prozess, die Darstellung der Angeklagten und die Entwicklung der Berichterstattung im Laufe des Prozesses. Der Wandel in der Presseberichterstattung und ihre Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung werden untersucht.
Was wird im Kapitel "Die öffentliche Wahrnehmung - Briefe von Außenstehenden an das Gericht" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die öffentliche Meinung anhand von Briefen an das Gericht und vergleicht diese mit Umfrageergebnissen des Allensbacher Instituts. Es analysiert positive und negative Reaktionen und bewertet deren Bedeutung für den gesellschaftlichen Einfluss des Prozesses.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die Zusammenfassung enthält keine expliziten Schlussfolgerungen. Diese müssten aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Ulmer Einsatzgruppenprozess, NS-Verbrechen, öffentliche Wahrnehmung, Medienberichterstattung, Bundesrepublik Deutschland, 1958, Zeitgeschichte, kollektive Schuld, Einzeltäterthese, Justiz, öffentliche Meinung, Allensbacher Institut, Vergangenheitsbewältigung, Fischer-Schweder, Einsatzkommando Tilsit.
Welche Limitationen der verwendeten Methoden werden angesprochen?
Die Zusammenfassung erwähnt die Limitationen rein pressebasierter Analysen, jedoch ohne konkrete Details.
- Quote paper
- Michael Hellstern (Author), 2014, Einzelne Exzesstäter im Tilsiter Blutsommer? Der Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958 in der öffentlichen Wahrnehmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309444