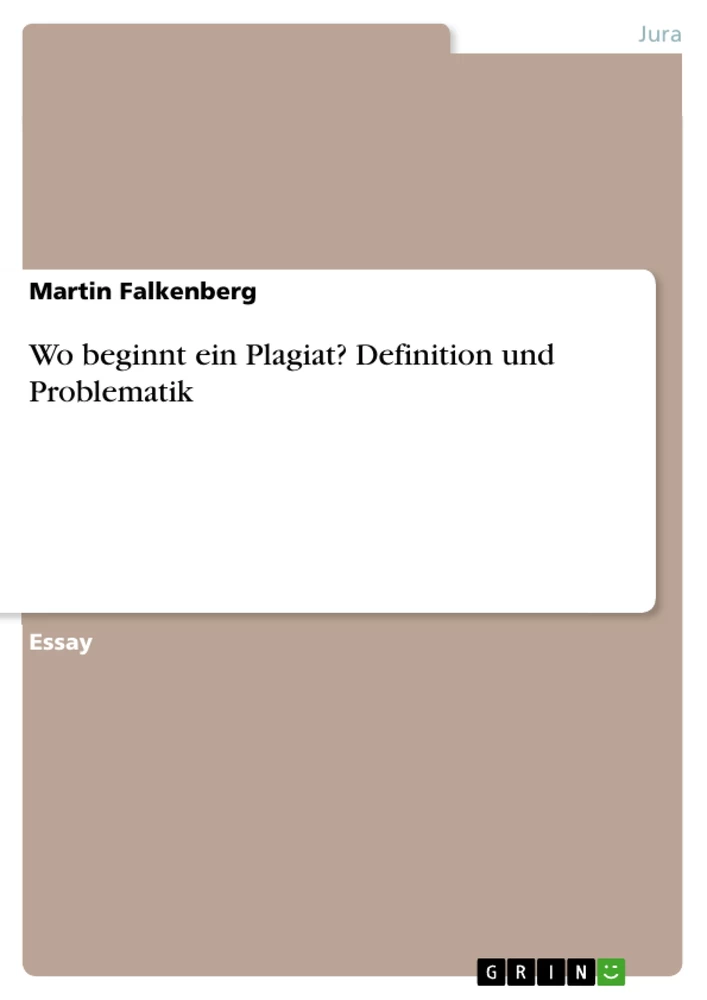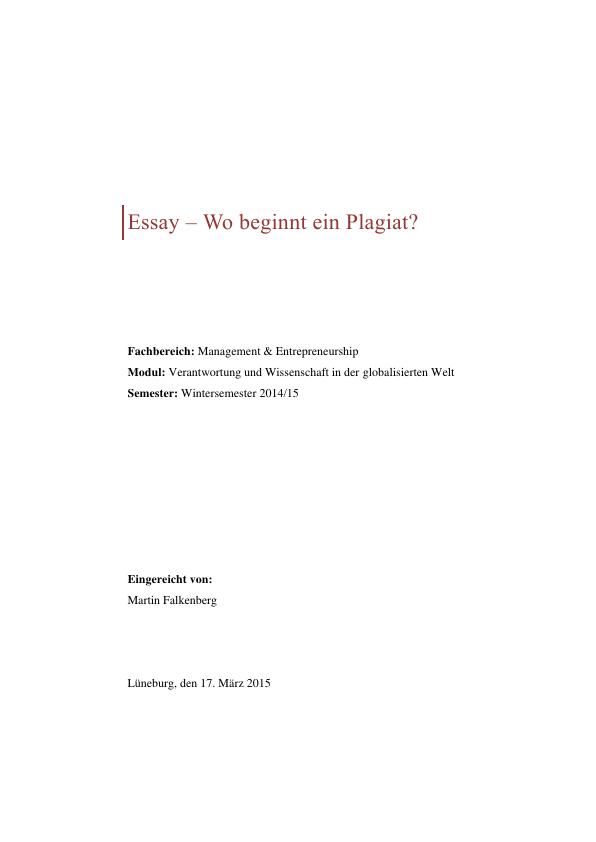Die nachfolgende Ausarbeitung beschäftigt sich daher mit der Frage: Wo beginnt ein Plagiat? Dabei ist wichtig festzuhalten, dass hierbei nur Ausarbeitungen im wissenschaftlichen Kontext gemeint sind und nicht etwa literarische oder künstlerische Plagiate. Weiterhin soll nur das Textplagiat Gegenstand der Untersuchung sein.
Durch das vermehrte Auftreten von Plagiatsfällen in wissenschaftlichen Publikationen, wie zum Beispiel der Fall der Aberkennung des Doktortitels von Karl-Theodor zu Guttenberg im Februar des Jahres 2011 ist das Thema Plagiat verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Eine wissenschaftliche Arbeit kann durch die moderne Vernetzung des Internets heutzutage in kürzester Zeit von der ganzen Welt aus geprüft werden und es finden sich auch mitunter genügend Freiwillige, die ein verstärktes Interesse daran haben einen möglichen Plagiatsfall aufzudecken. Problematisch ist dabei aber anzusehen, dass oftmals zwischen den Teilnehmern des Diskurses keine Einigkeit darüber herrscht, wann überhaupt ein Plagiat beginnt und wie ein Plagiat definiert werden kann.
Um die Frage nach dem Beginn eines Plagiats klären zu können, müssen zunächst wichtige Schlüsselbegriffe dieses Themenbereichs definiert werden, um auf dieser Basis weiter argumentieren zu können. Außerdem werden verschiedene Formen des Plagiats vorgestellt und ein Vergleich zwischen Urheberrecht und Plagiat gezogen. Daraufhin wird mit Hilfe von Ansichten aus der Wissenschaftstheorie und verschiedenen ethischen Grundprinzipien, wie beispielsweise dem kategorischen Imperativ nach Kant die Hauptfrage des Essays "Wo beginnt ein Plagiat?" näher beleuchtet und argumentativ beantwortet. Die Arbeit schließt mit einem zusammenfassenden Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Plagiatsformen
- 2.3 Unterschied Urheberrecht-Plagiat
- 2.4 Das Plagiat aus wissenschaftstheoretischer Sicht
- 2.5 Das Plagiat aus wissenschaftsethischer Sicht
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, wo die Grenze zum Plagiat in wissenschaftlichen Arbeiten liegt. Ziel ist es, ein Verständnis für die Definition von Plagiat zu schaffen und verschiedene Aspekte zu beleuchten, um präventive Maßnahmen gegen Plagiate zu fördern.
- Definition von Plagiat und Urheberrecht
- Unterschiede zwischen Plagiat und zulässiger Zitation
- Wissenschaftstheoretische Betrachtung von Plagiaten
- Wissenschaftsethische Aspekte des Plagiats
- Prävention von Plagiaten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigende Relevanz des Themas Plagiat aufgrund von öffentlichkeitswirksamen Fällen wie dem Guttenberg-Skandal. Sie betont die Notwendigkeit, klare Definitionen zu etablieren und präventive Maßnahmen zu entwickeln, anstatt lediglich repressiv vorzugehen. Die Arbeit fokussiert sich auf Textplagiate im wissenschaftlichen Kontext und kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an, die Definitionen, Plagiatsformen, den Vergleich zum Urheberrecht, wissenschaftstheoretische und -ethische Perspektiven umfassen.
2 Hauptteil: Dieser Teil bildet das Herzstück der Arbeit. Zunächst werden zentrale Begriffe wie „Plagiat“, „Urheberrecht“ und „Zitat“ präzise definiert, wobei verschiedene Definitionen aus dem Duden, dem Gabler Wirtschaftslexikon und von Experten wie Teddi Fishman herangezogen werden. Der Abschnitt zu Plagiatsformen klassifiziert verschiedene Arten des geistigen Diebstahls. Der Vergleich von Urheberrecht und Plagiat verdeutlicht die rechtlichen Implikationen. Schließlich wird das Thema Plagiat aus wissenschaftstheoretischer und -ethischer Sicht beleuchtet, wobei ethische Prinzipien wie der Kantsche kategorische Imperativ diskutiert werden, um die moralischen und ethischen Dimensionen des Problems zu verdeutlichen und eine fundierte Antwort auf die Forschungsfrage zu liefern.
Schlüsselwörter
Plagiat, Urheberrecht, Zitat, Wissenschaftsethik, Wissenschaftstheorie, Prävention, geistiges Eigentum, Guttenberg-Skandal, Definition, ethische Prinzipien, wissenschaftliche Integrität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Plagiate in wissenschaftlichen Arbeiten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Grenze zum Plagiat in wissenschaftlichen Arbeiten. Sie zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Definition von Plagiat zu schaffen und verschiedene Aspekte des Themas zu beleuchten, um präventive Maßnahmen gegen Plagiate zu fördern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Plagiat und Urheberrecht, die Unterschiede zwischen Plagiat und zulässiger Zitation, wissenschaftstheoretische und -ethische Betrachtungen von Plagiaten, sowie die Prävention von Plagiaten. Es werden verschiedene Plagiatsformen klassifiziert und der Guttenberg-Skandal als ein Beispiel für die Relevanz des Themas genannt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil beinhaltet Definitionen zentraler Begriffe (Plagiat, Urheberrecht, Zitat), eine Klassifizierung von Plagiatsformen, einen Vergleich von Urheberrecht und Plagiat, sowie wissenschaftstheoretische und -ethische Perspektiven auf das Thema. Die Einleitung betont die steigende Relevanz des Themas und die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Definitionen von Plagiat werden verwendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene Definitionen von Plagiat aus dem Duden, dem Gabler Wirtschaftslexikon und von Experten wie Teddi Fishman. Es wird eine präzise Definition von "Plagiat", "Urheberrecht" und "Zitat" angestrebt.
Welche wissenschaftstheoretischen und -ethischen Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit beleuchtet das Thema Plagiat aus wissenschaftstheoretischer und -ethischer Sicht. Ethische Prinzipien wie der Kantsche kategorische Imperativ werden diskutiert, um die moralischen und ethischen Dimensionen des Problems zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Plagiat, Urheberrecht, Zitat, Wissenschaftsethik, Wissenschaftstheorie, Prävention, geistiges Eigentum, Guttenberg-Skandal, Definition, ethische Prinzipien, wissenschaftliche Integrität.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein klares Verständnis von Plagiaten in wissenschaftlichen Arbeiten zu schaffen und Strategien zur Prävention zu entwickeln. Sie möchte dazu beitragen, die wissenschaftliche Integrität zu stärken.
- Quote paper
- Bachelor of Science Martin Falkenberg (Author), 2015, Wo beginnt ein Plagiat? Definition und Problematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309372