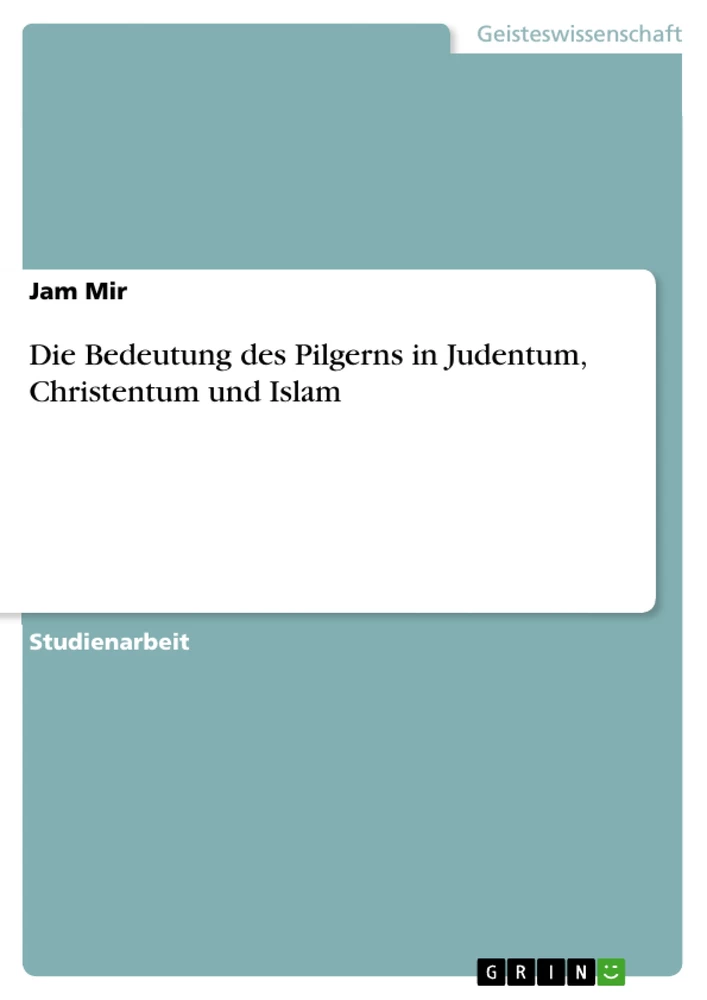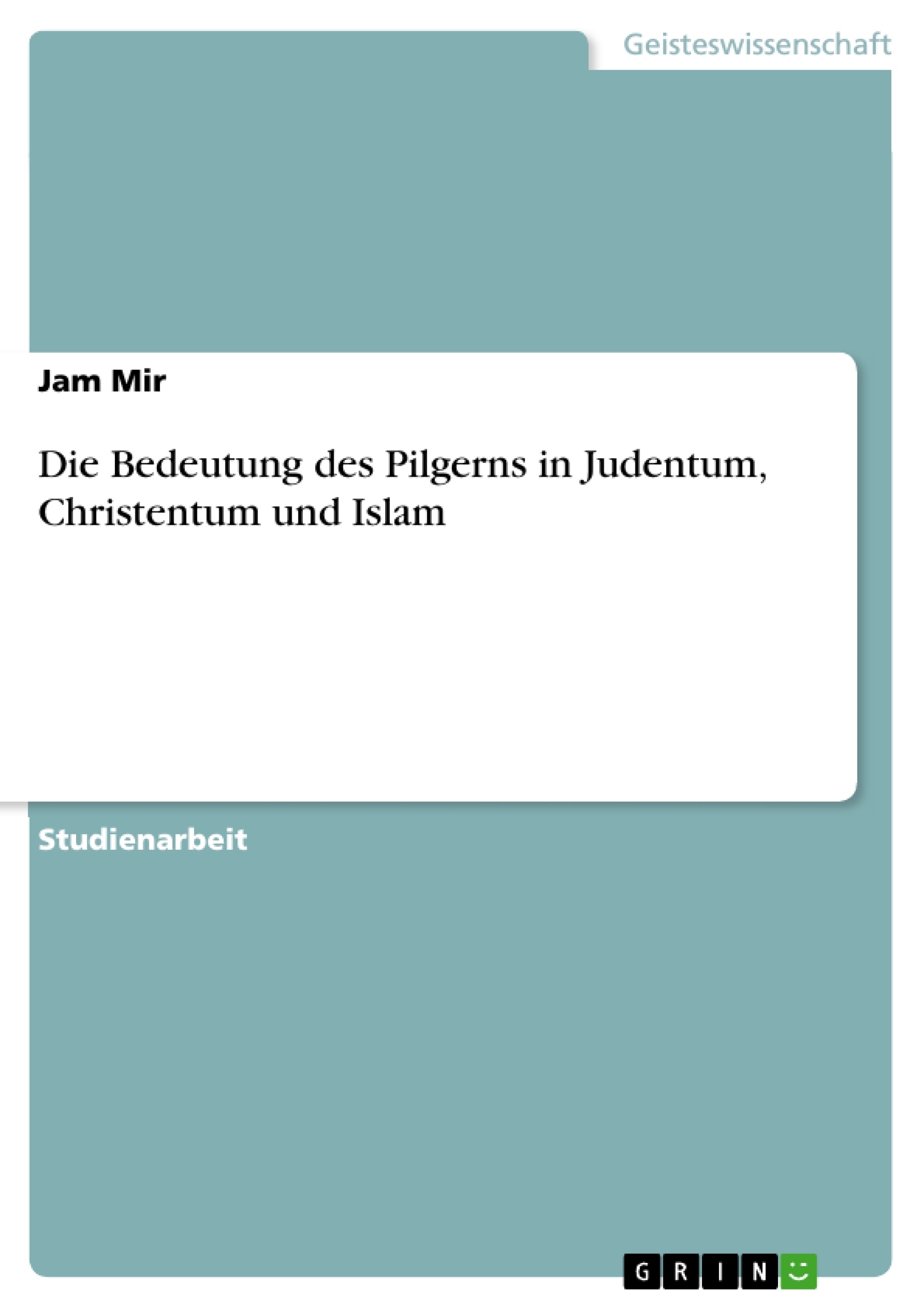Der Ursprung des Wortes Pilgern liegt im Lateinischen und bedeutet »fremd« und »in der Fremde sein, Heil suchen« (Gesellschaft zur Förderung des Jakobswesens, 2014). Pilgern ist eine Form des Unterwegssein, die sich auf verschiedene Weise vergegenwärtigt. Es ist eine ungewisse Zeit in der Fremde, die oft mit körperlicher Anstrengung, sowie mit physischen und psychischen Grenzerfahrungen verbunden ist, in der individuellen Auseinandersetzung mit sich selbst (Gerland 2009). Im Prinzip pilgern Menschen einen Weg, um Gott oder einem Heiligen näher zu sein und um sich von Sünden zu befreien (Gesellschaft zur Förderung des Jakobswesens 2014).
Pilgern ist nicht an eine bestimmte Religion gebunden. Jeder Pilger besitzt seinen eigenen Beweggrund, weshalb er sich auf den Weg macht, wie z.B. ein fremdes Land zu erkunden, dem Alltag zu entfliehen, seinen Glauben zu stärken oder neue Kraft zugewinnen (Bunse 2011). Grundsätzlich muss zwischen Wallfahrt und Pilgern unterschieden werden. Oft werden die Begriffe synonym gebraucht aber vor allem im Christentum sind diese klar zu trennen. Vor allem wird die Bedeutung des Pilgerns und der Wallfahrt in der Einzelbetrachtungen deutlich gemacht.
Ich konzentriere mich in dieser Hausarbeit auf die Frage: Welche Bedeutung hat das Pilgern in den Religionen: Judentum, Christentum und Islam? Im ersten Kapitel führe ich zum einen die Definition des Pilgerns aus, wobei auf die historische Entwicklung sowie auf die Beweggründe des Pilgerns eingehen werde. Zum Anderen werde ich auf die Bedeutung des Unterwegsseins in den abrahamitischen Religionen eingehen. Im zweiten Kapitel wird auf das Pilgern in den drei Religionen eingegangen. Dabei werden geschichtliche Entstehungsfakten sowie Aspekte ritueller Handlungen und der Pilgerorte beschrieben. Gleichfalls wird die Verbindung der drei Religionen zu Jerusalem geschildert. Der letzte Abschnitt befasst sich mit einer Schlussbetrachtung der Fragestellung sowie der Gesamtthematik des Pilgerns.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 2. Das Pilgern
- 2.1 Was ist Pilgern?
- 2.2 Der Unterschied zwischen der Pilgerreise und der Wallfahrt
- 2.3 Zur Entstehung des Pilgerns
- 3. Das Pilgern im Judentum, Christentum und dem Islam
- 3.1 Die Klagemauer als Wirkungsstätte der Juden
- 3.2 Das Pilgern im Christentum am Beispiel des Jakobsweges
- 3.3 Die Pilgerreise Hadsch im Islam
- 3.4 Die Bedeutung Jerusalems für die drei Weltreligionen
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Pilgerns in den drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam. Ziel ist es, die religionsspezifischen Pilgerstätten und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Fragestellung: Welche Bedeutung hat das Pilgern in den Religionen Judentum, Christentum und Islam?
- Definition und historische Entwicklung des Pilgerns
- Unterschiede zwischen Pilgerreise und Wallfahrt
- Das Pilgern im Judentum (Klagemauer)
- Das Pilgern im Christentum (Jakobsweg)
- Das Pilgern im Islam (Hadsch)
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Pilgern auseinanderzusetzen, ausgehend von eigenen Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Sie führt den Begriff des Pilgerns sprachlich her und beschreibt es als eine Reise in die Fremde, verbunden mit körperlicher und psychischer Anstrengung und Selbstreflexion. Die Arbeit fokussiert sich auf die Bedeutung des Pilgerns in den abrahamitischen Religionen und deren Gemeinsamkeiten, die auf Abraham als gemeinsamem Urvater zurückgehen.
2. Das Pilgern: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Pilgerns. Es beleuchtet den Ursprung des Begriffs, beschreibt das Pilgern als ein kultisches Ritual mit religiösen Beweggründen und betont die Unterscheidung zwischen Pilgerreise und Wallfahrt, obwohl diese oft synonym verwendet werden. Die Kapitel verdeutlicht die weltweite und zeithistorische Verbreitung des Pilgerns als religiöses Phänomen.
2.1 Was ist Pilgern?: Dieses Unterkapitel definiert Pilgern als eine freiwillige Reise in die Fremde, aus religiösem Antrieb, die mit Verzicht und Anstrengung verbunden ist und sich von einem gewöhnlichen Urlaub unterscheidet. Es unterstreicht den Aspekt der Selbstfindung und der Suche nach dem Göttlichen oder dem Heiligen.
3. Das Pilgern im Judentum, Christentum und dem Islam: Dieses Kapitel analysiert das Pilgern in den drei abrahamitischen Religionen im Detail. Es beschreibt die jeweilige Bedeutung der Pilgerstätten und Rituale, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorgehoben werden.
3.1 Die Klagemauer als Wirkungsstätte der Juden: Im Gegensatz zu den traditionellen Pilgerreisen anderer Religionen stellt die Klagemauer für Juden einen Ort der religiösen Identifizierung und des Gebets dar. Es wird der Brauch beschrieben, Anliegen auf Zettel zu schreiben und diese in die Mauer zu stecken, als Ausdruck von Trauer, Klage und Bitte.
3.2 Das Pilgern im Christentum am Beispiel des Jakobsweges: Dieses Unterkapitel schildert den Jakobsweg als ein Beispiel für christliches Pilgern. Die lange und anstrengende Reise stellt den Pilger vor persönliche Grenzen und fordert seine physischen und psychischen Ressourcen heraus, was zu einer intensiven Selbstreflexion führt. Der heilige Jakobus als Schutzpatron Spaniens macht den Jakobsweg seit dem 12. Jahrhundert zu einem beliebten Ziel, das nicht nur Christen anzieht.
3.3 Die Pilgerreise Hadsch im Islam: Die Hadsch nach Mekka, eine der fünf Säulen des Islam, wird als Pflicht für jeden Muslim beschrieben, der es sich leisten kann. Das Kapitel beschreibt die Rituale und die große Anzahl der Pilger, die gleichzeitig Mekka besuchen. Die Bedeutung der Hadsch als zentrale religiöse Handlung wird betont.
3.4 Die Bedeutung Jerusalems für die drei Weltreligionen: Dieses Unterkapitel hebt die gemeinsame Bedeutung Jerusalems für die drei Religionen hervor, indem es die verschiedenen religiösen Stätten wie den Tempelberg, den Felsendom, die Klagemauer und die biblischen Stätten Jesu beschreibt. Die gemeinsame Nutzung und die unterschiedlichen historischen und religiösen Bedeutungen werden erläutert.
Schlüsselwörter
Pilgern, Wallfahrt, Judentum, Christentum, Islam, abrahamitische Religionen, Klagemauer, Jakobsweg, Hadsch, Jerusalem, Religion, Glaube, Rituale, Selbstfindung, Reise, Tradition.
Häufig gestellte Fragen: Hausarbeit zum Thema Pilgern in den abrahamitischen Religionen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Pilgerns in den drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam. Sie beleuchtet die religionsspezifischen Pilgerstätten und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit und konzentriert sich auf die Frage nach der Bedeutung des Pilgerns in diesen Religionen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung des Pilgerns, die Unterschiede zwischen Pilgerreise und Wallfahrt, das Pilgern im Judentum (am Beispiel der Klagemauer), im Christentum (am Beispiel des Jakobswegs) und im Islam (am Beispiel der Hadsch), sowie die gemeinsame Bedeutung Jerusalems für die drei Religionen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zum Pilgern allgemein, ein Kapitel zum Pilgern in den drei abrahamitischen Religionen mit Unterkapiteln zu den jeweiligen Beispielen (Klagemauer, Jakobsweg, Hadsch und Jerusalem), und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich werden eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was wird unter "Pilgern" verstanden?
Die Hausarbeit definiert Pilgern als eine freiwillige Reise in die Fremde, aus religiösem Antrieb, die mit Verzicht und Anstrengung verbunden ist und sich von einem gewöhnlichen Urlaub unterscheidet. Es wird der Aspekt der Selbstfindung und der Suche nach dem Göttlichen oder dem Heiligen betont. Ein Unterschied zur Wallfahrt wird ebenfalls erläutert, obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden.
Welche Rolle spielt die Klagemauer im Judentum?
Die Klagemauer stellt für Juden einen Ort der religiösen Identifizierung und des Gebets dar. Der Brauch, Anliegen auf Zettel zu schreiben und diese in die Mauer zu stecken, als Ausdruck von Trauer, Klage und Bitte, wird beschrieben.
Wie wird der Jakobsweg im Christentum dargestellt?
Der Jakobsweg wird als Beispiel für christliches Pilgern geschildert. Die lange und anstrengende Reise stellt den Pilger vor persönliche Grenzen und fordert seine physischen und psychischen Ressourcen heraus, was zu einer intensiven Selbstreflexion führt. Der heilige Jakobus als Schutzpatron macht den Weg zu einem beliebten Ziel.
Welche Bedeutung hat die Hadsch im Islam?
Die Hadsch nach Mekka, eine der fünf Säulen des Islam, wird als Pflicht für jeden Muslim beschrieben, der es sich leisten kann. Die Rituale und die große Anzahl der Pilger werden beschrieben, und die Bedeutung der Hadsch als zentrale religiöse Handlung wird betont.
Welche Bedeutung hat Jerusalem für die drei Religionen?
Das Kapitel hebt die gemeinsame Bedeutung Jerusalems für Judentum, Christentum und Islam hervor, indem es die verschiedenen religiösen Stätten wie den Tempelberg, den Felsendom, die Klagemauer und die biblischen Stätten Jesu beschreibt. Die gemeinsame Nutzung und die unterschiedlichen historischen und religiösen Bedeutungen werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Pilgern, Wallfahrt, Judentum, Christentum, Islam, abrahamitische Religionen, Klagemauer, Jakobsweg, Hadsch, Jerusalem, Religion, Glaube, Rituale, Selbstfindung, Reise, Tradition.
- Quote paper
- Jam Mir (Author), 2013, Die Bedeutung des Pilgerns in Judentum, Christentum und Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309364