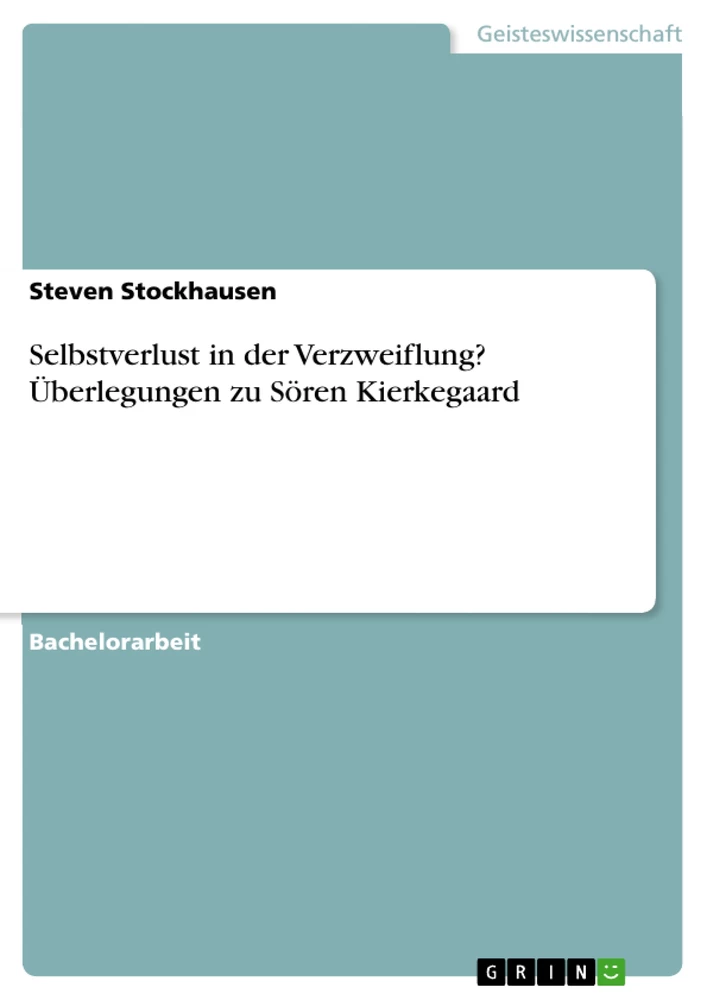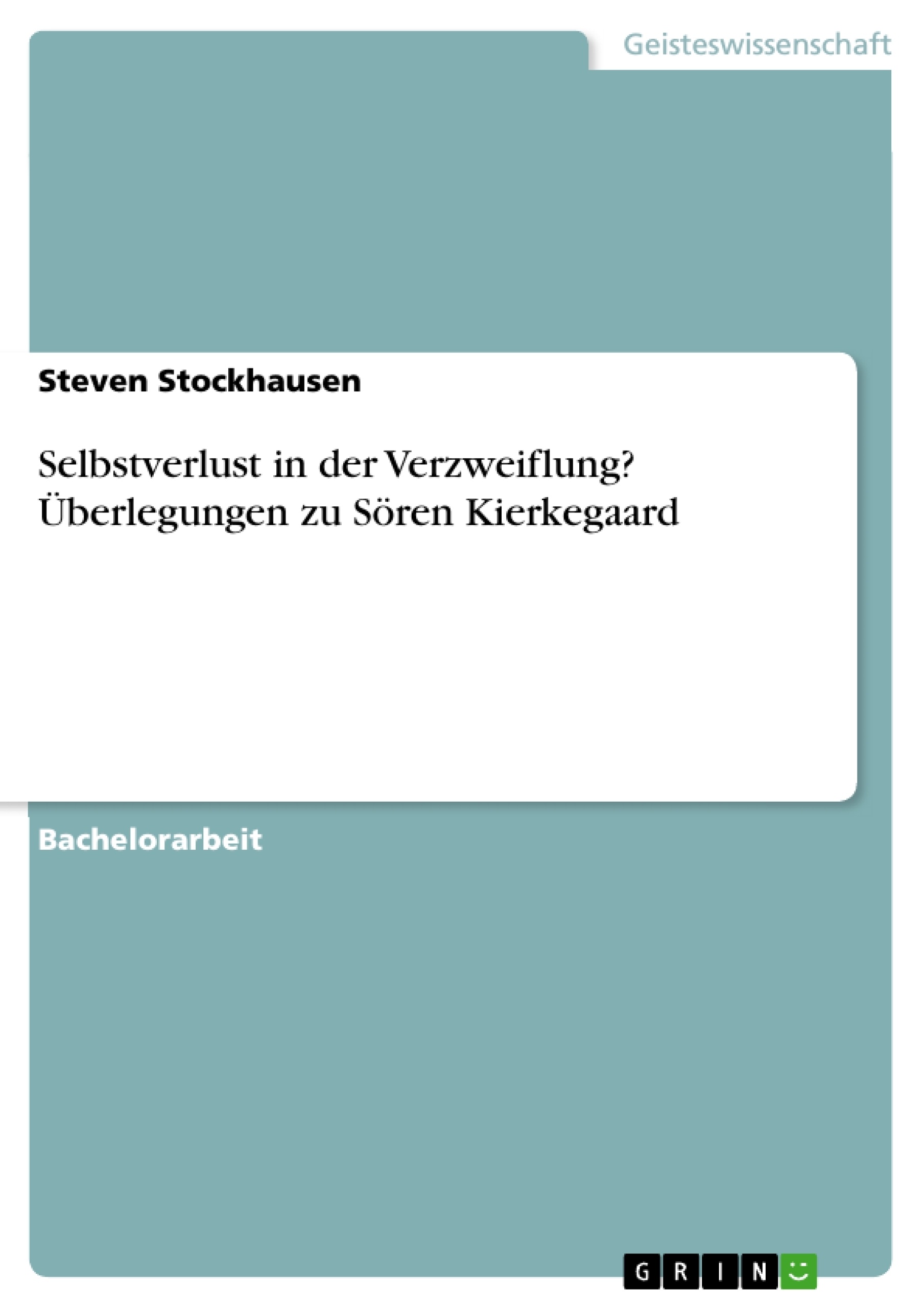Meine Bachelorarbeit ist das Ergebnis jahrelangen Suchens und ausgiebiger Lektüre sämtlicher großen Werke von Sören Kierkegaard. Die Hauptthematik ist das ewige Selbst, welches in der aktuellen Forschungsliteratur meines Erachtens wenig diskutiert und noch weniger verstanden wird.
Sören Aabye Kierkegaard war ein religiöser Schriftsteller im 19. Jahrhundert in Kopenhagen. Das primäre Anliegen seines Denkens war die „ewige Seligkeit“ und damit die Unsterblichkeit des Menschen. Er stellt sich die Frage, wie ein existierender Mensch sich solchermaßen zu sich selbst als Werdender innerhalb des existenzdialektischen Widerspruchs von Unendlichkeit und Endlichkeit, verhalten kann, dass er dadurch mit seiner Unsterblichkeit so verbunden ist, dass seine Entwicklung innerhalb dieses Werdens unsterblich sein kann. Die Frage ist also danach gestellt, wie der Existierende das Ewige in seiner Existenz so ausdrücken kann, damit er sich dadurch zu Gottes Unendlichmachung verhält. Alle diesbezüglichen Termini werden im Verlaufe dieser Arbeit dargestellt.
Die Schwierigkeit der Darstellung des Gedankengebäudes von Sören Kierkegaard ist unter anderem, dass die Erklärung des Selbst zu immer weiteren Termini führen muss, aus dem es zusammengesetzt ist. Darum möchte ich die Herleitung der Interpretation des ewigen Selbst in mehreren Kapiteln vollziehen. Diese Arbeit soll eine Rekonstruktion der wesentlichen Gedanken von Kierkegaard sein. Dies bedeutet, dass der logische Argumentationszusammenhang nur innerhalb der Voraussetzungen von Kierkegaard hergestellt werden kann. Es ist nicht Ziel der Arbeit, eine immanente Kritik zu entwickeln.
Kierkegaards anthropologische Grundvoraussetzung ist, bestimmt zu haben, was Geist ist und das der Mensch Geist ist.
Dass dieser als das Selbst des Menschen ein Verhältnis zu einer Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit ist, das sich zu sich selbst verhält, und indem es sich zu sich selbst verhält, sich zu der Macht verhält, die es gesetzt hat. Begriffe wie „Freiheit“ oder „Ewigkeit“ sind also von Kierkegaard als Existenzerfahrungen beschrieben. „Es ist wohl wahr, daß der Begriff Seele der objektiven Wissenschaft keinen Sinn liefert, aber für die Erfahrung bedeutet er eine Realität […]“ Mein primäres Anliegen einer Rekonstruktion beruht darauf, dass in der aktuellen Forschungsliteratur der Begriff der Ewigkeit des Menschen bei Kierkegaard, meines Wissens nach nicht hinreichend ausdifferenziert wurde.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Struktur des Selbst
- 3. Die unendliche Resignation
- 4. Das ewige Bewusstsein
- 5. Der absolute Anfang als Sprung...
- 6. Der Glaube ...........
- 7. Die Reue und das Allgemeinmenschliche in der Wahl ......
- 8. Die Entwicklung des ewigen Selbst....
- 9. Selbstverlust in der Verzweiflung?
- 9.1 Selbstverlust innerhalb der unbewussten Form der Verzweiflung:
- 9.2 Selbstverlust innerhalb der bewussten Form der Verzweiflung:
- 9.3 Selbstverlust innerhalb der bewussten Form der Verzweiflung:
- 10. Die Potenzierung der Verzweiflung und des Selbstverlusts
- 11. Schluss.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Selbstverlustes in der Verzweiflung aus der Perspektive Sören Kierkegaards. Sie analysiert die komplexe Beziehung zwischen Selbst, Verzweiflung und Ewigkeit im Werk des dänischen Philosophen und untersucht, wie Kierkegaard den Prozess des Werdens und der Selbstfindung im Spannungsfeld zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit begreift.
- Die Struktur des Selbst bei Kierkegaard
- Die Rolle der Verzweiflung im Bewusstwerdungsprozess
- Die Bedeutung der Unendlichkeit und des Ewigen für das Selbst
- Kierkegaards Kritik an Fichte und Hegel
- Die Dialektik von Möglichkeit und Bestimmtheit im menschlichen Dasein
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Selbstverlustes in der Verzweiflung ein und stellt Kierkegaards Hauptanliegen dar: die Frage nach der Unsterblichkeit des Menschen. Kapitel 2 untersucht die Struktur des Selbst, wobei Kierkegaards Bezug auf Fichte und Hegel hervorgehoben wird. Kapitel 3 beleuchtet das Konzept der unendlichen Resignation und Kapitel 4 das des ewigen Bewusstseins. Kapitel 5 befasst sich mit dem absoluten Anfang als Sprung und Kapitel 6 mit dem Glauben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf zentrale Begriffe wie Selbst, Verzweiflung, Ewigkeit, Unendlichkeit, Werdens, Existenz, Unsterblichkeit, Glaube, Resignation, und Bewusstsein im Kontext von Kierkegaards Philosophie.
- Quote paper
- Steven Stockhausen (Author), 2014, Selbstverlust in der Verzweiflung? Überlegungen zu Sören Kierkegaard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309228