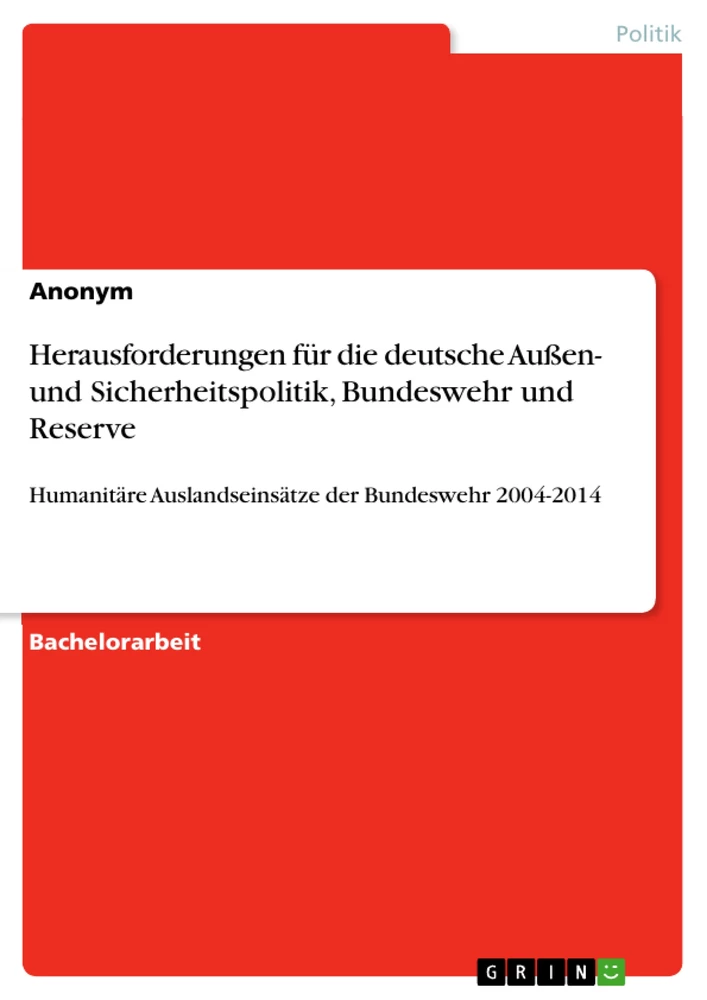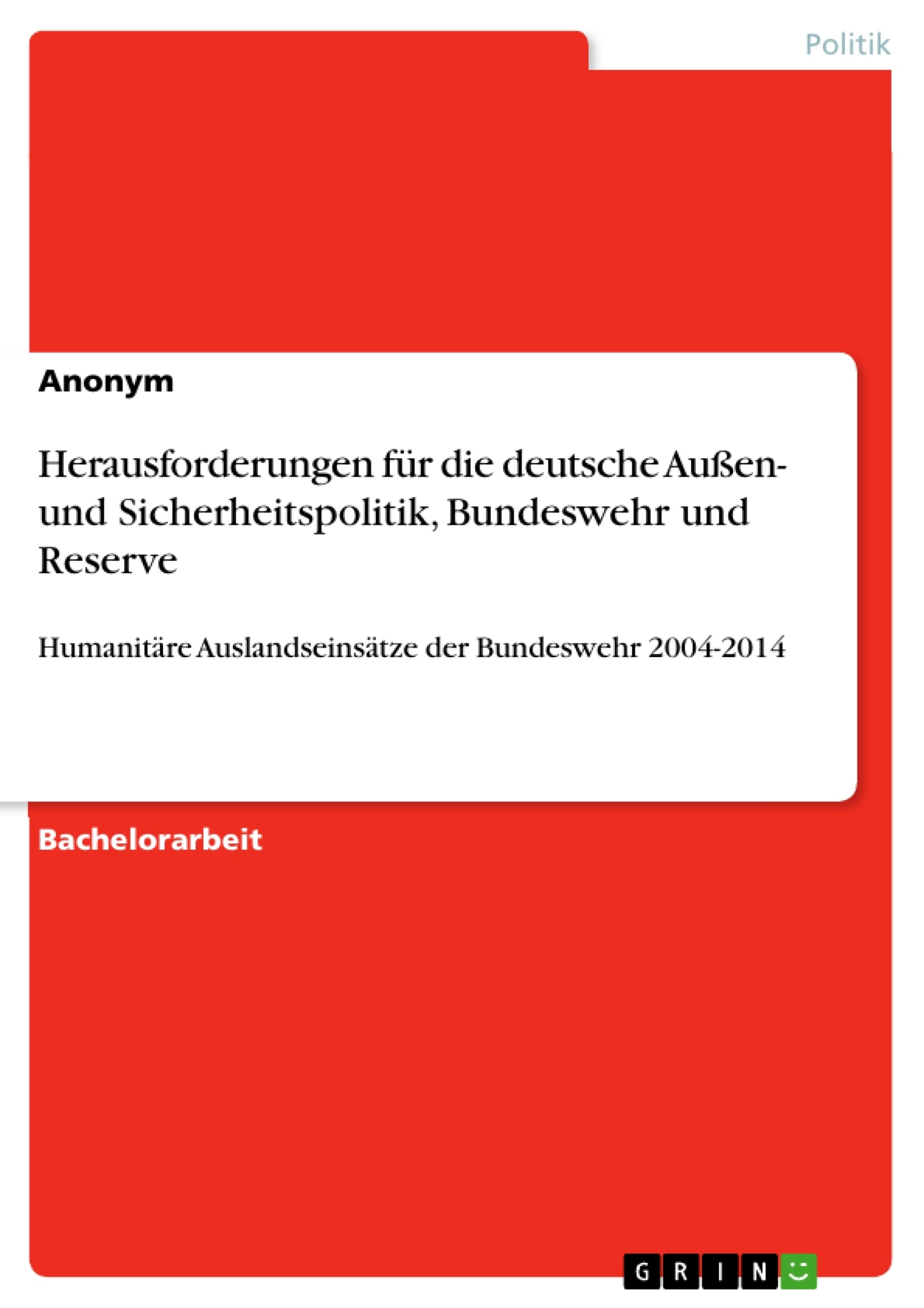Gerade für die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr bedeutet ein Wandel der Geopolitik und -strategie auch einen Wandel der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU und NATO. Bedingt durch den Mauerfall und vor allem durch die Erfahrung von Einsätzen in den 90ern, zieht die Bundeswehr Lehren, derer sie mit einem noch andauernden Reformationsprozess von einer konventionellen Streitkraft zu einer Einsatz und Interventionsarmee gerecht zu werden versucht. Da sich auch durch die Federführung der EU im Zuge gemeinsamer und vernetzter Sicherheits- und Außenpolitik eine Änderung der Einsatzspektren ergibt, soll dieser erläutert werden.
Im Folgenden soll der theoretische Ansatz der Arbeit dargestellt werden:
Hier setzt Henry Kissingers Werk „Diplomacy“ an, welches der realistischen Schule der internationalen Beziehungen zuzuordnen ist, an. Insbesondere der Part des Buches, der nach dem Kalten Krieg den Begriff der New World Order besetzt, drückt aus, wie Menschenrechte, ökonomische Stabilität und Sicherheitsbewusstsein an Bedeutung für das militärische und geostrategische Denken gewinnen. Supranationale Zusammenarbeit und Kooperation von Staaten auf humanitärer Ebene waren ebenfalls Ziele, die das genannte Werk als wichtig erachtete, dabei jedoch aufgrund der Anlehnung an die realistische Schule die Notwendigkeit von Militärkräften gegeben sieht, da es Fraktionen gibt, die ihre Interessen mit Waffengewalt durchsetzen wollen.
Es zeigen sich auch innerhalb Deutschlands verschiedene Ansätze in der akademischen Forschung. Während die Bundeswehr eher dem realistischen Ansatz folgt und das Thema Sicherheitspolitik erfolgt, zeigt die andere Strömung in Richtung Friedens- und Konfliktforschung. Diese beiden Strömungen, des ansonsten vernachlässigten Themas akademischer Leitfragen, zeigen die unterschiedlichen Denkansätze der politikwissenschaftlichen Debatte um die Ausrichtung der Bundeswehr und deren Auslandseinsätze.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Methodik, Fragestellung und Forschungsstand
- 2. Diplomacy und das Ende der Bipolarität in den internationalen Beziehungen
- 2.1 Kissinger's Diplomacy und die New World Order
- 2.2 Das Ende der Bipolarität
- 2.3 Das akademische Dilemma: Sicherheitspolitik vs. Friedens- und Konfliktforschung
- 3. Humanitäre Einsätze als außenpolitisches Instrument
- 3.1 Definition: Humanitäre Einsätze, Außenpolitik
- 3.1.1 Humanitäre Einsätze seit Gründung der Bundeswehr
- 3.1.2 Neue Humanitäre Engagements: Beobachtereinsätze
- 3.2 Abgrenzung zur militärischen Intervention
- 3.3 Mandatierung und rechtliche Grundlagen
- 3.4 Entwicklungszusammenarbeit als Konfliktprävention bei humanitären Einsätzen
- 4. Die humanitären Einsätze 2004-2014 der Bundeswehr im Detail
- 4.1 Laufende und abgeschlossene Humanitäre Einsätze 2004-2014
- 4.2 Strategiewechsel der Außenpolitik und neue Herausforderungen für die Bundeswehr
- 5. Die Bedeutung von Fachkräften: CIMIC und Reserve bei Auslandseinsätzen
- 5.1 Reserve
- 5.2 CIMIC/ZMZ
- 5.3 Konzeption der Einbindung dieser Konzepte auf dem Prüfstand
- 5.4 Perspektiven CIMIC und Reserve für Humanitäre Einsätze
- 6. Ausblick und Risiken humanitärer Einsätze im Rahmen der Transformation der BW
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung und Transformation humanitärer Auslandseinsätze der Bundeswehr im Zeitraum von 2004 bis 2014. Sie analysiert die Rolle dieser Einsätze im Kontext der veränderten internationalen Sicherheitslage nach dem Ende des Kalten Krieges und der "New World Order". Die Arbeit beleuchtet die zunehmenden Herausforderungen für die Bundeswehr in einem globalisierten Umfeld und die Bedeutung von zivil-militärischer Zusammenarbeit (CIMIC) und der Reserve im Rahmen humanitärer Einsätze.
- Die Transformation der Bundeswehr von einer konventionellen Streitkraft zu einer Einsatz- und Interventionsarmee
- Die Bedeutung von humanitären Einsätzen als außenpolitisches Instrument der Bundesrepublik Deutschland
- Die Rolle von CIMIC und Reserve bei Auslandseinsätzen
- Die Herausforderungen und Risiken humanitärer Interventionen in einem globalisierten Umfeld
- Die Bedeutung von Entwicklungszusammenarbeit als Konfliktprävention
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Methodik, Fragestellung und den Forschungsstand. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach dem Ende der Bipolarität und die Rolle von Diplomacy im Kontext der "New World Order". Kapitel 3 definiert den Begriff "Humanitäre Einsätze" im Kontext der Außenpolitik und beleuchtet die Entwicklung und Mandatierung dieser Einsätze seit Gründung der Bundeswehr. Das Kapitel beleuchtet auch die Abgrenzung zu militärischen Interventionen und die Bedeutung von Entwicklungszusammenarbeit als Konfliktprävention. Kapitel 4 analysiert die humanitären Einsätze der Bundeswehr zwischen 2004 und 2014 im Detail und beleuchtet den Strategiewechsel der deutschen Außenpolitik und die damit verbundenen Herausforderungen für die Bundeswehr. Schließlich behandelt Kapitel 5 die Bedeutung von Fachkräften, insbesondere CIMIC und Reserve, für Auslandseinsätze und analysiert die Einbindung dieser Konzepte in der Praxis.
Schlüsselwörter (Keywords)
Humanitäre Auslandseinsätze, Bundeswehr, Transformation, Internationale Beziehungen, New World Order, Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Konfliktprävention, CIMIC, Reserve, Auslandseinsätze, Strategiewechsel, Herausforderungen, Risiken.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Herausforderungen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, Bundeswehr und Reserve, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309148