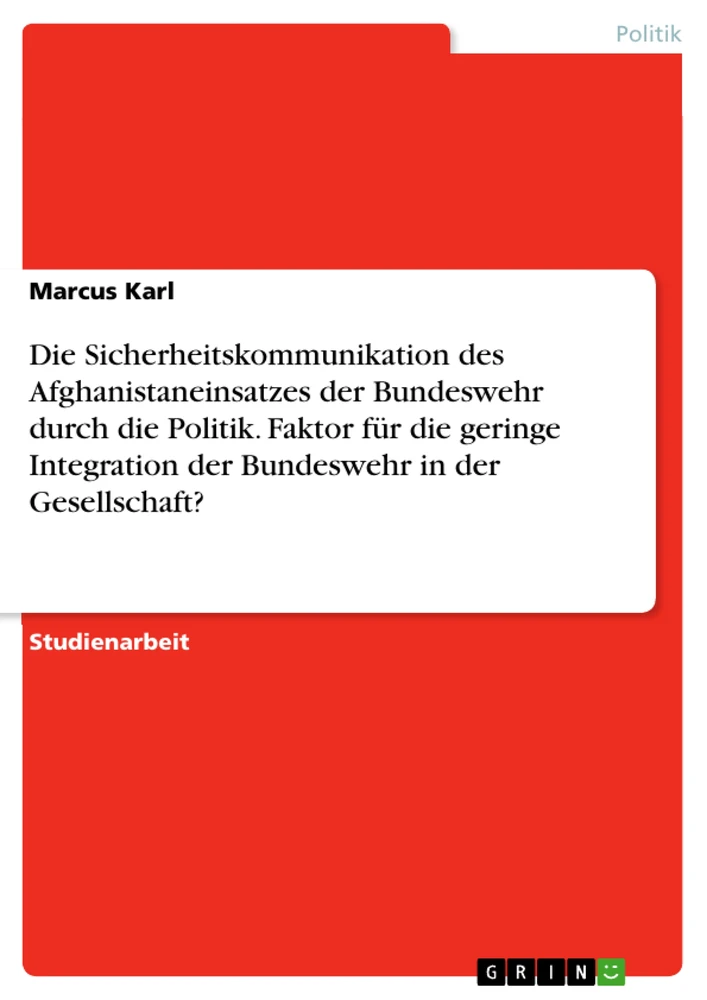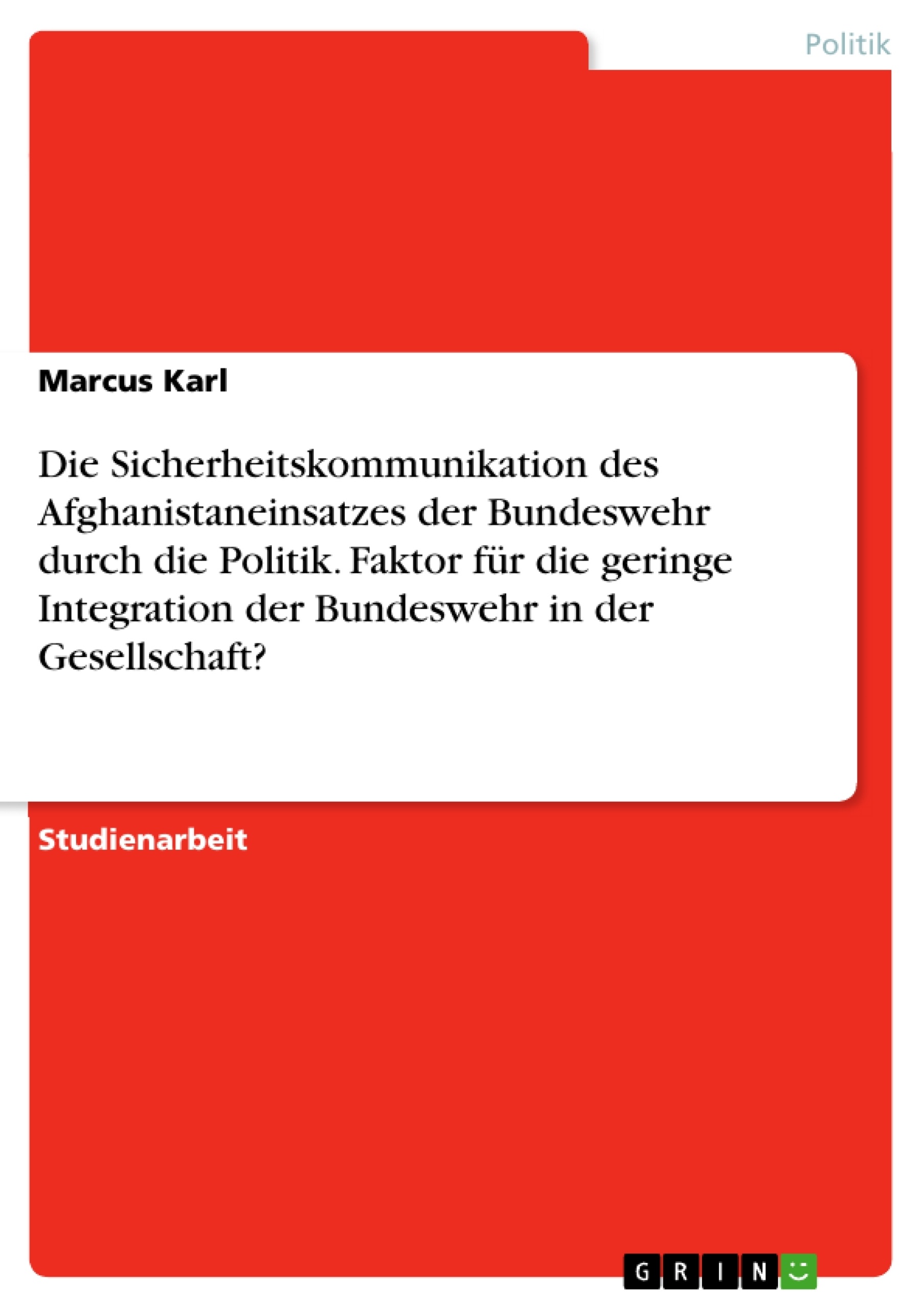Diese Arbeit möchte die These belegen, dass die politische Sicherheitskommunikation von 2002 bis 2014 über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ein Faktor für eine geringe Integration der Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft ist.
Hierfür möchte ich im zweiten Kapitel das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Gesellschaft darstellen, indem ich einen Vergleich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft ziehe. Im dritten Kapitel werde ich die politische Kommunikation über gefallene Soldaten der Bundeswehr analysieren und im 4. Kapitel die Wirkung der damaligen politischen Rhetorik bezüglich des Afghanistaneinsatzes darstellen. In meinem Fazit werde ich meine Ausführungen zusammenfassen, um meine These abschließend zu untermauern.
Die Problematik der Integration der Bundeswehr in der Gesellschaft lässt differenzierte Annäherungsweisen mit verschiedenen Schwerpunkten zu. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf die sicherheitspolitische Kommunikation über die Medien gelegt.
Der Begriff „Krieg“ wird als Synonym für einen gewaltsamen Konflikt und nicht für einen politisch erklärten Zustand genutzt. Der Begriff „Politik“ steht für alle relevanten Akteure der deutschen Politik, da zwischen 2002 und 2014 die Regierungskonstellation wechselte und dieThese keine parteispezifische Phänomenologie konstatieren will.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bundeswehr in der Gesellschaft
- Gefallene Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan
- Die politische Sicherheitskommunikation über den Einsatz in Afghanistan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Sicherheitskommunikation über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan von 2002 bis 2014 und beleuchtet deren Einfluss auf die Integration der Bundeswehr in die deutsche Gesellschaft. Die These der Arbeit lautet, dass die politische Sicherheitskommunikation ein Faktor für die geringe Integration der Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft ist.
- Verhältnis zwischen Bundeswehr und Gesellschaft
- Politische Kommunikation über gefallene Soldaten der Bundeswehr
- Wirkung der damaligen politischen Rhetorik bezüglich des Afghanistaneinsatzes
- Die Rolle der Medien in der Sicherheitskommunikation
- Das Problem der Integration der Bundeswehr in die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den Kontext des Themas und stellt die Forschungsfrage vor. Sie beleuchtet die Veränderung des Sicherheitsgefüges in Deutschland nach dem 11. September 2001 und den Beginn des Afghanistaneinsatzes. Dabei wird auch die gesellschaftliche Debatte um die Rolle der Bundeswehr im Auslandseinsatz thematisiert.
- Die Bundeswehr in der Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Integration der Bundeswehr, indem es einen Vergleich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zieht. Es untersucht die unterschiedlichen Identifikationsmöglichkeiten und Wertevorstellungen, die mit der Bundeswehr und der Nationalmannschaft verbunden sind. Darüber hinaus wird die Rolle der Medien in der Darstellung der Bundeswehr in der Gesellschaft beleuchtet.
- Gefallene Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die politische Kommunikation über gefallene Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan. Es analysiert die Rhetorik der politischen Akteure und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Bundeswehr und des Afghanistaneinsatzes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Sicherheitskommunikation, der Integration der Bundeswehr in die deutsche Gesellschaft, dem Afghanistaneinsatz, der politischen Rhetorik, den gefallenen Soldaten und den Medien. Sie untersucht die Herausforderungen der Sicherheitskommunikation in einer komplexen und vernetzten Welt und analysiert die Auswirkungen der politischen Kommunikation auf die Integration eines Sicherheitsorgans in die Gesellschaft.
- Quote paper
- Marcus Karl (Author), 2015, Die Sicherheitskommunikation des Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr durch die Politik. Faktor für die geringe Integration der Bundeswehr in der Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308855