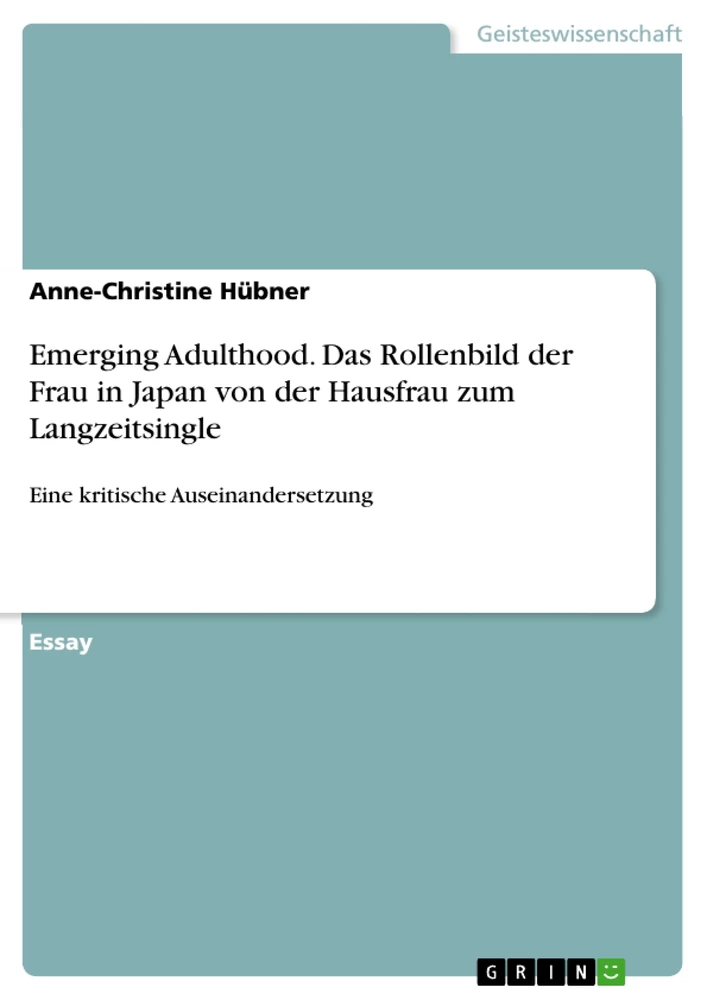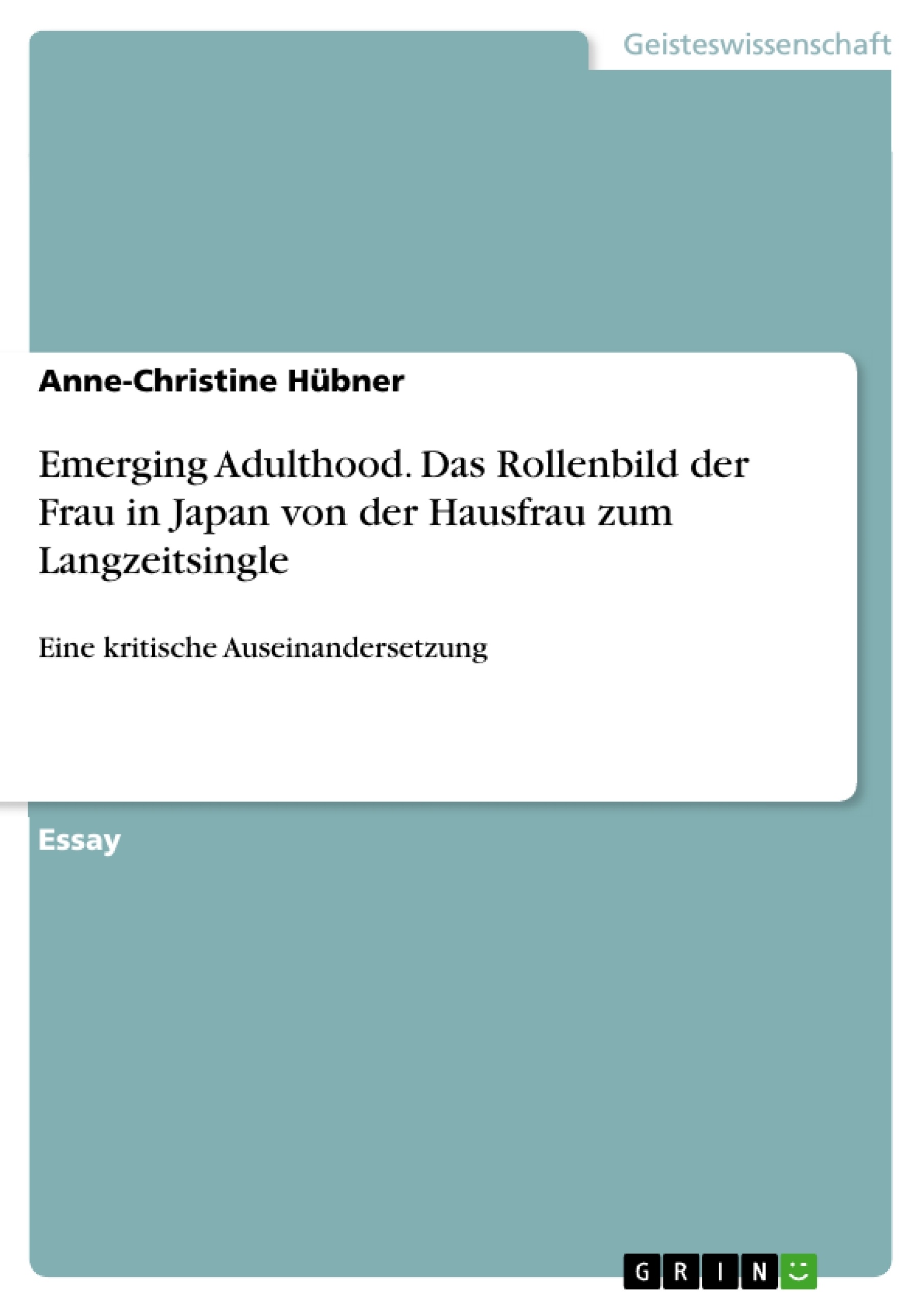Diese Arbeit untersucht das Rollenbild der Frau in ihrer Frauwerdung kritisch und geht dabei gesondert auf die Situtation in Japan ein. Emerging Adulthood, ein Begriff der durch Jeffrey Jensen Arnett begründet wurde, beschreibt eine verlängerte Übergangszeit von der Adoleszenz bis zum Erwachsenenalter. Der Term bezieht sich auf eine Altersgruppe von 18-25 Jahren, die vor allem durch Merkmale wie Unabhängigkeit, unverheiratet oder finanziell ungebunden zu sein charakterisiert ist. So lässt sich feststellen, dass heutzutage das Durchschnittsalter für die Heirat bei fast 30 Jahren liegt. Aus diesem Umstand folgert Arnett den Begriff Emerging Adulthood.
Doch wodurch lässt sich dieses Phänomen erklären? Arnett begründet die Höhe des Heiratsalters dadurch, dass verschiedene Erfahrungen gesammelt werden oder ein postsekundärer Bildungsweg angestrebt wird. Hierbei ist jedoch kritisch anzumerken, dass Arnett in seiner Statistik ausschließlich die beiden Jahre 1980 und 2000 verglichen hat, die Entwicklung vor 1980 wurde jedoch nicht beleuchtet. Darüber hinaus nimmt Arnett keine zeitlich kontinuierliche Analyse des Heiratsalters vor. Somit lassen sich besondere Tendenzen des Ehezeitpunktes zwischen 1980 und 2000 nicht feststellen (vgl. Arnett 2006, S.112).
Der Term Emerging Adulthood kann zwar als eine universelle Entwicklungsphase beschrieben werden, da sich Emerging Adulthood nicht nur auf Deutschland anwenden lässt, sondern ebenso auf Europa, Amerika, China sowie Japan. Jedoch müssen bei dieser Entwicklungsphase Ausnahmen beachtet werden, so ist der Grund für das späte Heiratsalter ja nach Land zu differenzieren. Denn so heiraten die Jugendlichen in Spanien später, weil die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind und die hohe Arbeitslosigkeit persönliche Unsicherheiten für die Existenzsicherung der Individuen erzeugt (vgl. Douglass 2005, S.188-199). In den nordeuropäischen Staaten hingegen lässt sich das Heiratsalter aber durch die immaterielle „Capital Accumulation“ (Bynner 2005, S.369), also die Anhäufung von Wissen und Erfahrung erklären. Demzufolge kann aus dem Ergebnis des späten Heiratsalters nicht allgemein auf eine Emerging Adulthood Phase geschlussfolgert werden, da die Gründe für den verzögerten Heiratsentschluss von unterschiedlichen nationalen Sturkturen bedingt werden. Im weiteren Verlauf möchte dieses Essay dies kritisch in Japan beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Untersuchungen
- Politischer und kultureller Wandel in Japan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „Emerging Adulthood“ in Japan im Kontext des politischen und kulturellen Wandels nach 1945. Sie analysiert, inwiefern die Veränderungen des Rollenbilds der Frau in Japan eine Folge dieser Entwicklungen sind. Die Arbeit hinterfragt dabei die Universalität des Konzepts des „Emerging Adulthood“ und die unterschiedlichen soziokulturellen Faktoren, die das späte Heiratsalter beeinflussen.
- Das Konzept des „Emerging Adulthood“ nach Arnett
- Der Wandel des Rollenbilds der Frau in Japan nach 1945
- Der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf die Geschlechterrollen
- Die Rolle traditioneller Familienstrukturen und Werte
- Kritische Auseinandersetzung mit der Universalität des „Emerging Adulthood“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Emerging Adulthood“ ein, definiert den Begriff nach Arnett und beleuchtet kritisch dessen Universalität. Arnetts Fokus auf die Jahre 1980 und 2000 wird als limitiert kritisiert, ebenso wie die fehlende Berücksichtigung länderspezifischer Unterschiede bei der Erklärung des späten Heiratsalters. Die Arbeit kündigt eine fokussierte Betrachtung der japanischen Gesellschaft an.
Theoretische Grundlagen und Untersuchungen: Dieses Kapitel beschreibt die fünf Hauptmerkmale von „Emerging Adulthood“ nach Arnett: „feeling in-between“, „instability“, „self-focus“, „identity exploration“ und „age of possibilities“. Es wird die Studie von Nancy Rosenberger erläutert, die den Wandel des Rollenbilds der Frau in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre beleuchtet und den Anstieg unverheirateter Frauen in Japan zwischen 1975 und 1995 hervorhebt. Die „Parasiten Singles“- Bezeichnung wird als Ausdruck gesellschaftlicher Ängste diskutiert. Die Kapitel legt den Fokus auf die Fragestellung, wie sich das veränderte Rollenbild der Frau in Japan aus kulturellen und politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen nach 1945 erklärt.
Politischer und kultureller Wandel in Japan: Dieses Kapitel analysiert den Bruch mit traditionellen japanischen Werten und Identitäten nach 1945 im Kontext der US-amerikanischen Besatzung. Die vorherrschende Gemeinschaftsorientierung und die soziale Hierarchie der Vorkriegszeit werden im Gegensatz zur nach dem Krieg eingeführten Individualität und Demokratie dargestellt. Die Rolle der Gleichstellung der Frau und die amerikanische Intervention in der Erziehung und Wertevermittlung werden als zentrale Faktoren für den Wandel des Rollenbilds der Frau beleuchtet. Die Kapitel weist auf die Diskrepanz zwischen der Verfassungsänderung und den anhaltenden traditionellen Werten innerhalb der Familie hin, die die langsame Durchsetzung der neuen Ideale erklärt.
Schlüsselwörter
Emerging Adulthood, Japan, Rollenwandel der Frau, Politischer Wandel, Kultureller Wandel, Nachkriegsjapan, US-Besatzung, Individualität, Kollektivismus, Traditionelle Familienstrukturen, Identität, Geschlechterrollen, Demokratisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Emerging Adulthood in Japan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „Emerging Adulthood“ in Japan nach 1945. Im Fokus steht der Einfluss des politischen und kulturellen Wandels auf das Rollenbild der Frau und das späte Heiratsalter. Die Arbeit hinterfragt dabei die Universalität des „Emerging Adulthood“-Konzepts und berücksichtigt soziokulturelle Besonderheiten Japans.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept des „Emerging Adulthood“ nach Arnett, den Wandel des Rollenbilds der Frau in Japan nach 1945, den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf Geschlechterrollen, die Rolle traditioneller Familienstrukturen und Werte, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Universalität des „Emerging Adulthood“-Konzepts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen und Untersuchungen, ein Kapitel zum politischen und kulturellen Wandel in Japan und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und kritisiert die Universalität des „Emerging Adulthood“-Konzepts. Das zweite Kapitel beschreibt die Merkmale des „Emerging Adulthood“ und den Wandel des Rollenbilds der Frau. Das dritte Kapitel analysiert den politischen und kulturellen Wandel in Japan nach 1945 und dessen Einfluss auf Geschlechterrollen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Wandel des Rollenbilds der Frau analysiert?
Der Wandel wird im Kontext des politischen und kulturellen Wandels nach 1945, insbesondere der US-amerikanischen Besatzung, analysiert. Die Arbeit untersucht den Bruch mit traditionellen Werten, die Einführung von Individualität und Demokratie, die Rolle der Gleichstellung der Frau und die anhaltende Bedeutung traditioneller Familienstrukturen.
Welche Kritikpunkte werden an Arnetts „Emerging Adulthood“-Konzept geäußert?
Die Arbeit kritisiert die begrenzte zeitliche Perspektive (1980er und 2000er Jahre) von Arnetts Studie und die fehlende Berücksichtigung länderspezifischer Unterschiede bei der Erklärung des späten Heiratsalters. Die Universalität des Konzepts wird grundsätzlich in Frage gestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emerging Adulthood, Japan, Rollenwandel der Frau, Politischer Wandel, Kultureller Wandel, Nachkriegsjapan, US-Besatzung, Individualität, Kollektivismus, Traditionelle Familienstrukturen, Identität, Geschlechterrollen, Demokratisierung.
- Quote paper
- Anne-Christine Hübner (Author), 2014, Emerging Adulthood. Das Rollenbild der Frau in Japan von der Hausfrau zum Langzeitsingle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308732