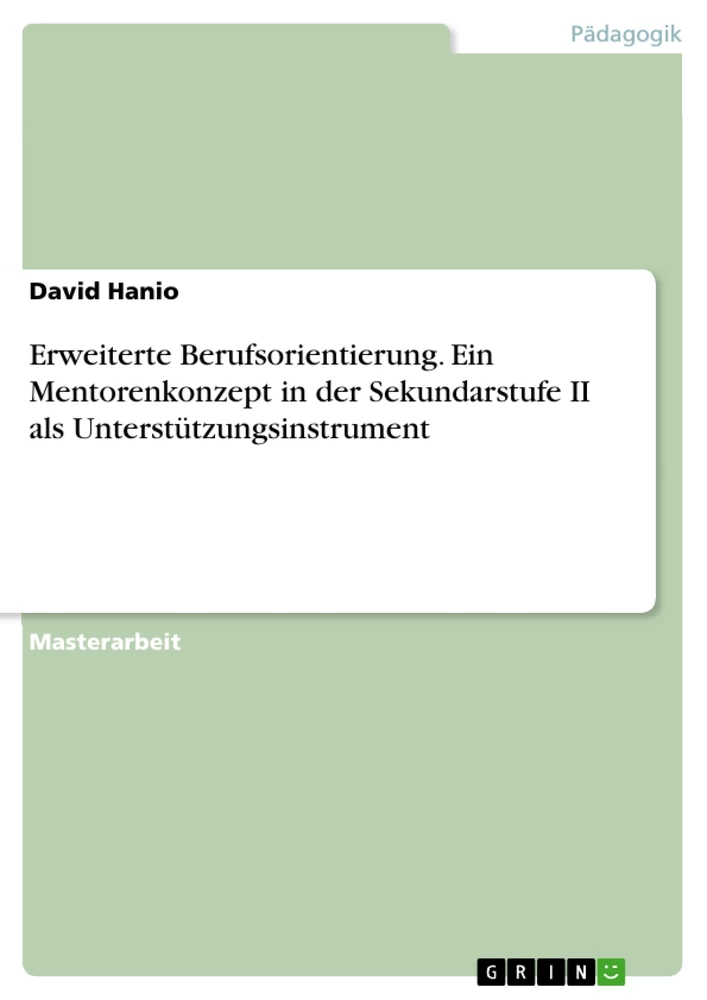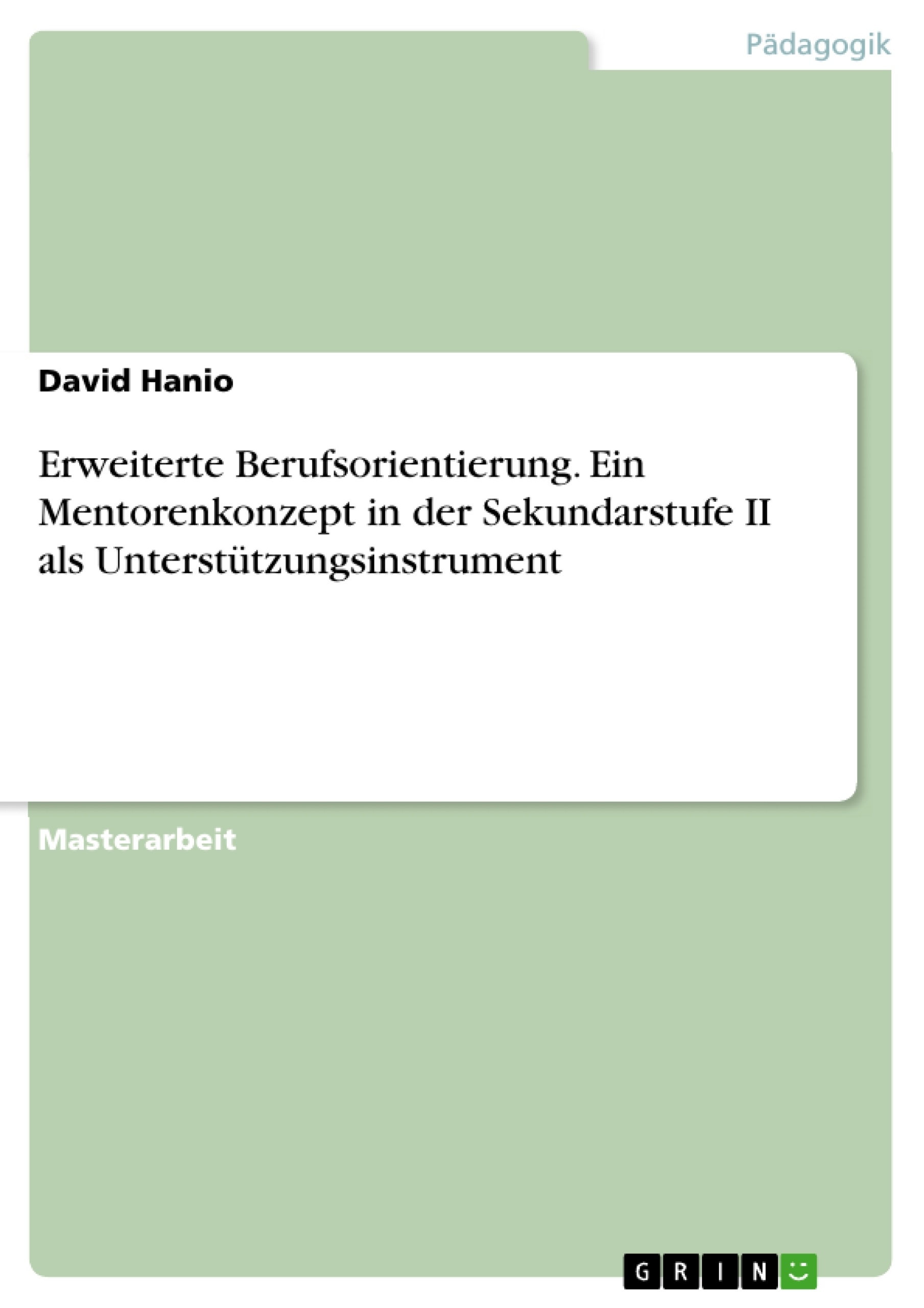Das Thema der Masterarbeit umfasst die erweiterte Berufsorientierung sowie die auf diese theoretische Auseinandersetzung aufbauende Entwicklung eines Mentorenkonzepts für die Sek II, in dem die Peers als zentrale Akteure eingebunden werden. Hierbei wird durch die theoretische Behandlung einer spezifischen Berufswahltheorie und den Grundgedanken des Mentorings ein eigenes Konzept samt praktischem Leitfaden für zukünftige Koordinatoren im Rahmen der Institution Schule konzipiert.
Die Wahl des Berufes ist der Beginn einer kontinuierlichen beruflichen Laufbahn, die durch gesellschaftliche Veränderung stets komplexer geworden ist (vgl. ALHUSSEIN 2009, S. 13). Insbesondere weist die Berufsorientierungsforschung in der Literatur einen intensiven Schwerpunkt hinsichtlich benachteiligter Jugendlichen sowie geschlechtsspezifischen Unterstützungsmaßnahmen auf. Der Berufseinstieg ist für alle eine Aufgabe, eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt (vgl. HERZOG ET AL. 2006, S. 11). Durch diese deutliche Fokussierung auf theoretischer und folgend praxisbezogener Ebene werden SuS der Sek II kaum als Personen mit Berufsorientierungsschwierigkeiten aufgefasst. Jedoch darf es sich bei der „Vorbereitung auf die Übergangssituation am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit nicht um eine reine Aufgabe der Benachteiligtenförderung“ (BRÜGGEMANN ET AL. 2013, S. 13) handeln. In der vorliegenden Arbeit wird der Schwerpunkt gelegt auf die erste berufliche Schwelle oder nach KIRSTEN (2007) die erste berufliche Orientierung anvisiert.
Zu Beginn erfolgen eine Auseinandersetzung mit dem Terminus Berufsorientierung und eine Einordnung in die gesellschaftlichen und rechtlich-politischen Rahmenbedingungen. Schließlich wird ein Überblick über die zentralen Einflüsse auf die Jugendlichen während ihrer Selbstkonzeptentwicklungsphase dargestellt und zwei zentrale Akteure, die Eltern sowie die Peergroups, explizit thematisiert. Der Schwerpunkt der Arbeit fokussiert die Akteure Peers, wobei der Peeransatz nach TINDALL als Rahmentheorie die Grundlage bildet.
Im Problemaufriss des Übergangs Schule-Beruf wird durch zahlreiche aktuelle Abbruchsdaten die gesellschaftliche und individuelle Relevanz untermauert. Durch eine gebündelte Darstellung der Förderungszielgruppe in der Sek I kann der Unterschied zur Sek II dargestellt und zentrale Erkenntnisse transferiert werden. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Berufsorientierung.
- 2.1 Das Verständnis vom Terminus Berufsorientierung ...
- 2.2 Gesellschaftliche und rechtliche Grundlagen.
- 2.3 Einfluss der sozialen Herkunft und des Geschlechts
- 2.4 Eltern und Peergroups als zentrale Akteure......
- 2.4.1 Eltern im Berufsorientierungsprozess.
- 2.4.2 Peergroup im Berufsorientierungsprozess .
- 2.4.3 Peeransatz nach TINDALL (1995)............
- 2.5 Zwischenfazit..
- 3. Berufsorientierung im Kontext in der Sek II
- 3.1 Darstellung des Übergangsprozesses Schule-Beruf.
- 3.1.1 Ausbildungsabbrüche......
- 3.1.2 Studienabbrüche..\li>
- 3.2 Die Berufsorientierung in der Sek I.......
- 3.3 Die Sek II als Zielgruppe..\li>
- 3.4 Informationsbeschaffung als Studienwahlfaktor..\li>
- 3.5 Zwischenfazit........
- 4. Die Bandbreite der Berufsorientierungsmaßnahmen
- 5. Theoretische Grundlagen – Berufswahltheorien.........
- 5.1 Überblick über die Berufswahltheorienlandschaft ..
- 5.2 Die sozial-kognitive Theorie (LENT, BROWN u. HACKETT)
- 5.2.1 Theoretische Rahmenstruktur.
- 5.2.2 Die Begründung für die Wahl der Theorie
- 6. Instrument Mentoring...
- 6.1 Was ist Mentoring?..\li>
- I6.1.1 Ziele
- 6.1.2 Modelle des Mentorings
- 6.1.3 Abgrenzung zu Coaching.
- 6.2 Theoretische Rahmenbedingungen des Mentorings als Lernprozess.
- 6.2.1 Dyade MentorIn-Mentee....
- 6.2.2 Die Lerntriade.
- 6.2.3 Big Four .
- 6.2.4 Aktiotop-Modell
- 6.2.5 Zwischenfazit ……......
- 6.3 Mentoring in der schulischen Berufsorientierung
- 6.4 Begründung für ein Mentorenkonzept.........
- 6.5 Notwendige Rahmenbedingungen.....
- 7. Das Mentorenkonzept in der Sek II....
- 7.1 Die Grundannahmen
- 7.2 Der Matching Prozess
- 7.3 Grundlagen zur Gestaltung des Mentorenkonzepts..\li>
- 7.3.1 Das Phasen- und Orientierungsmodell (KRAM u. JUNG).........
- 7.3.2 Die fünf Basisbausteine der Gestaltung.
- 7.4 Ablaufmodell in der Praxis - Handlungsempfehlung
- 7.4.1 Implementierungsphase
- 7.4.2 Bedingungen
- 7.4.3 Durchführung ...
- 7.4.4 Evaluationsphase.........
- 7.5 Kritische Reflexion...
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutung erweiterter Berufsorientierung in der Sekundarstufe II. Ziel ist es, ein Mentorenkonzept zu entwickeln, das Schülerinnen und Schülern bei der Berufswahl und der Vorbereitung auf den Übergang von der Schule in den Beruf unterstützt. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Berufsorientierung in der heutigen Gesellschaft und beleuchtet die Herausforderungen, denen Jugendliche im Berufsorientierungsprozess begegnen.
- Bedeutung der Berufsorientierung in der Sekundarstufe II
- Analyse des Übergangsprozesses Schule-Beruf
- Entwicklung und Implementierung eines Mentorenkonzepts
- Rolle von Eltern und Peergroups im Berufsorientierungsprozess
- Theoretische Grundlagen der Berufswahl und des Mentorings
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema der Masterarbeit und skizziert den Forschungsstand. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Berufsorientierung definiert und die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Der Einfluss der sozialen Herkunft und des Geschlechts auf den Berufsorientierungsprozess wird ebenfalls analysiert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Berufsorientierung in der Sekundarstufe II und beleuchtet den Übergangsprozess Schule-Beruf. Die Herausforderungen der Berufswahl und die Bedeutung von Informationsbeschaffung werden in diesem Kapitel diskutiert. Im vierten Kapitel wird ein Überblick über die verschiedenen Berufsorientierungsmaßnahmen gegeben. Das fünfte Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der Berufswahl und stellt verschiedene Berufswahltheorien vor. Das sechste Kapitel beleuchtet das Instrument Mentoring und erläutert die theoretischen Rahmenbedingungen des Mentorings als Lernprozess. Das siebte Kapitel präsentiert das im Rahmen der Masterarbeit entwickelte Mentorenkonzept für die Sekundarstufe II. Das Konzept beinhaltet die Grundannahmen, den Matching-Prozess, die Gestaltung des Mentorings und ein Ablaufmodell in der Praxis. Im achten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten gegeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Berufsorientierung, Sekundarstufe II, Übergang Schule-Beruf, Mentorenkonzept, Berufswahltheorien, sozial-kognitive Theorie, Mentoring, Peergroups, Eltern, Studienabbruch, Ausbildungsabbruch, Handlungsempfehlung, Implementierung, Evaluation
- Quote paper
- David Hanio (Author), 2015, Erweiterte Berufsorientierung. Ein Mentorenkonzept in der Sekundarstufe II als Unterstützungsinstrument, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308572