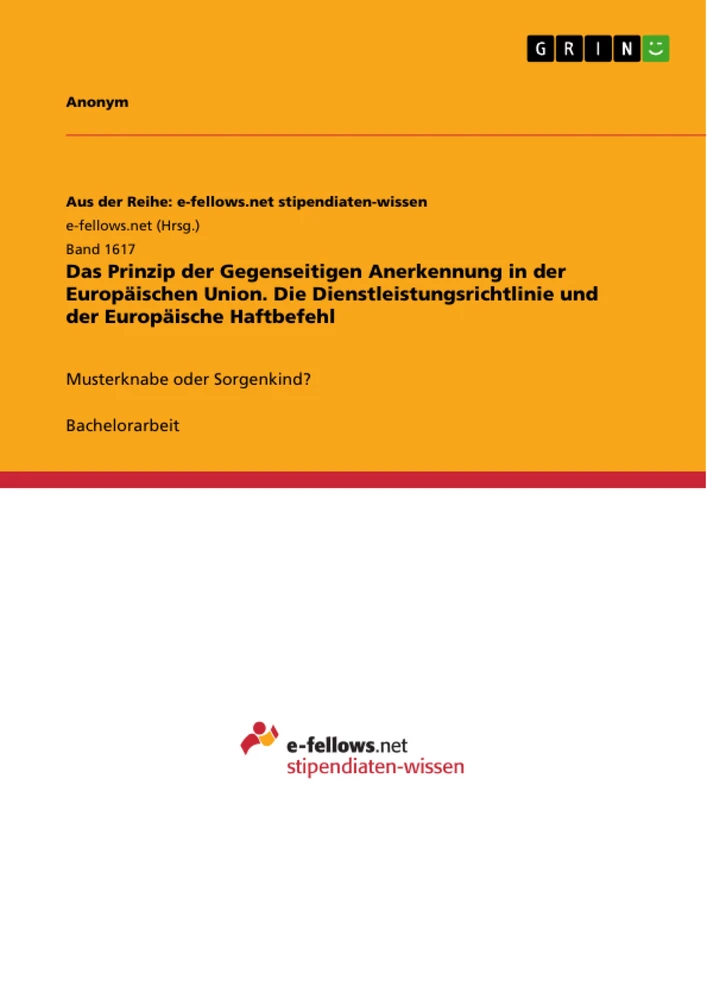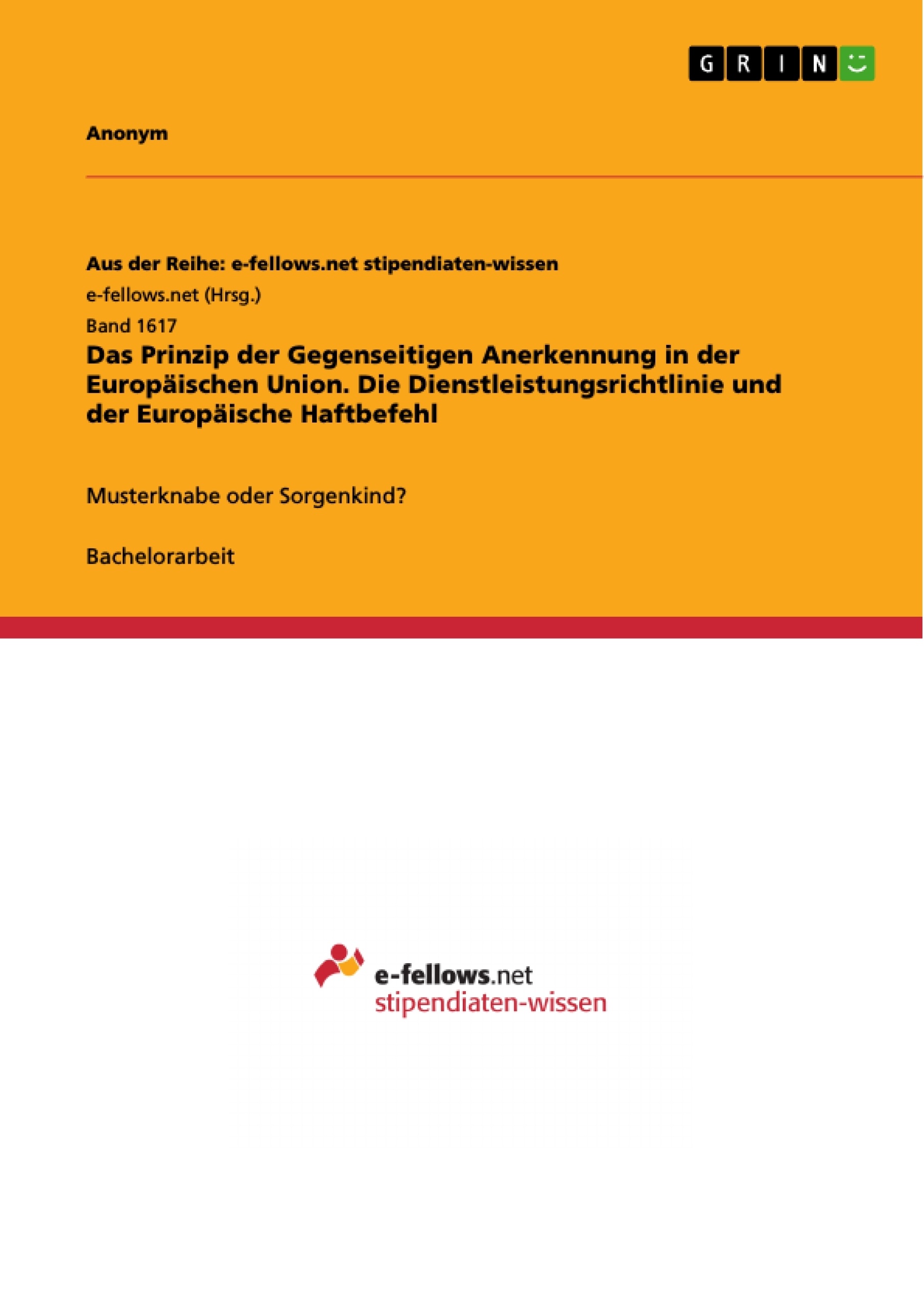Die Arbeit untersucht, welche Bedingungen einen Integrationsschritt in der Europäischen Union auf Grundlage des Prinzips der Gegenseitigen Anerkennung begünstigen. Mit dem Europäischen Haftbefehl und der Dienstleistungsrichtlinie kontrastiert die Arbeit zwei Bereiche, in denen die Anwendung des Prinzips erfolgte bzw. scheiterte. Die Arbeit hat den Anspruch eine Forschungslücke zu schließen, da der Frage, unter welchen Bedingungen das Prinzip Anwendung findet, bis dato wenig Aufmerksamkeit zugekommen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung nationaler Präferenzen für die europäische Gesetzgebung
- Die Gegenüberstellung der Dienstleistungsrichtlinie und des Europäischen Haftbefehls
- Interdependenz und Nutzenmaximierung initiieren Integration
- Die Bedeutung nationaler Interessengruppen für die Präferenzbildung der Mitgliedstaaten
- Die Unterstützung des Grundsatzes durch den mächtigsten Akteur ist entscheidend
- Abschließende Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedingungen, die einen Integrationsschritt in der Europäischen Union auf Grundlage des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung begünstigen. Dazu wird der Erfolg und Misserfolg des Prinzips am Beispiel des Europäischen Haftbefehls und der Dienstleistungsrichtlinie analysiert.
- Die Bedeutung nationaler Präferenzen für die europäische Gesetzgebung
- Die Rolle von Interdependenz und Nutzenmaximierung bei der Integration
- Der Einfluss nationaler Interessengruppen auf die Präferenzbildung der Mitgliedstaaten
- Die Bedeutung der Unterstützung des Prinzips durch den mächtigsten Akteur
- Die Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung in verschiedenen Politikfeldern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung wird vorgestellt und seine Bedeutung für die europäische Integration erläutert. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise dar.
- Die Bedeutung nationaler Präferenzen für die europäische Gesetzgebung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung nationaler Präferenzen für die europäische Gesetzgebung. Es analysiert, wie nationale Interessen und Präferenzen die Integration beeinflussen.
- Die Gegenüberstellung der Dienstleistungsrichtlinie und des Europäischen Haftbefehls: Dieses Kapitel vergleicht zwei wichtige Beispiele für die Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung: die Dienstleistungsrichtlinie und den Europäischen Haftbefehl. Es untersucht, wie nationale Interessen und Präferenzen die Integration in diesen beiden Fällen beeinflusst haben.
- Interdependenz und Nutzenmaximierung initiieren Integration: Dieses Unterkapitel analysiert die Rolle von Interdependenz und Nutzenmaximierung bei der Integration.
- Die Bedeutung nationaler Interessengruppen für die Präferenzbildung der Mitgliedstaaten: Dieses Unterkapitel untersucht den Einfluss nationaler Interessengruppen auf die Präferenzbildung der Mitgliedstaaten.
- Die Unterstützung des Grundsatzes durch den mächtigsten Akteur ist entscheidend: Dieses Unterkapitel beleuchtet die Bedeutung der Unterstützung des Prinzips durch den mächtigsten Akteur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung in der Europäischen Union, mit Schwerpunkt auf nationalen Präferenzen, Interdependenz, Nutzenmaximierung, Interessengruppen, und den Politikfeldern Dienstleistungsverkehr und europäische Justiz- und Innenpolitik. Die Arbeit analysiert die Anwendung des Prinzips am Beispiel des Europäischen Haftbefehls und der Dienstleistungsrichtlinie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Das Prinzip der Gegenseitigen Anerkennung in der Europäischen Union. Die Dienstleistungsrichtlinie und der Europäische Haftbefehl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308187