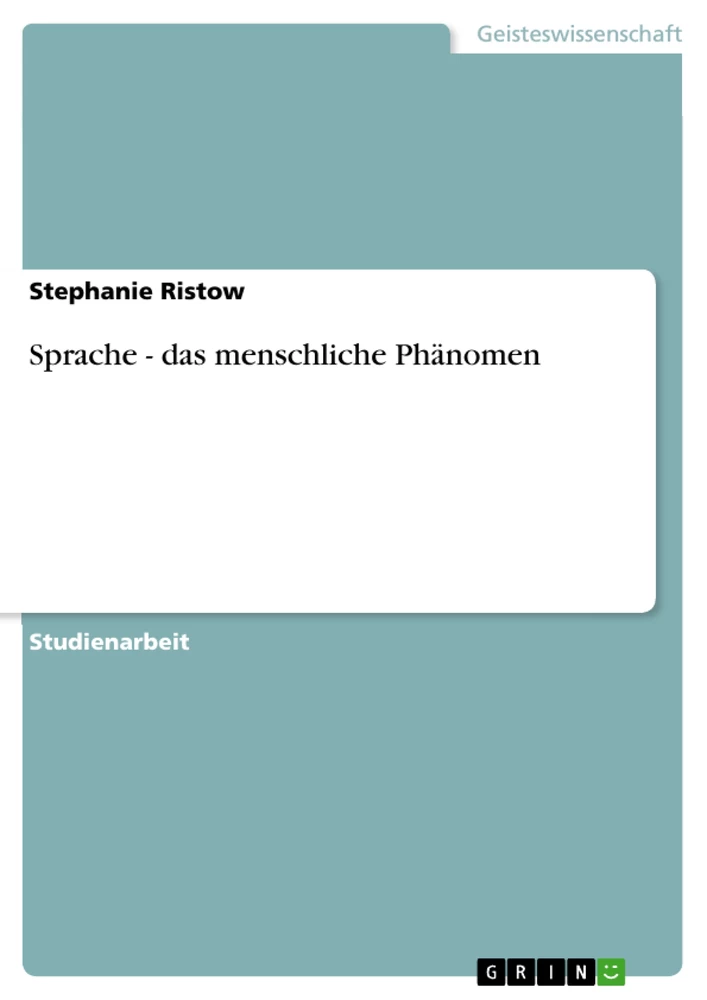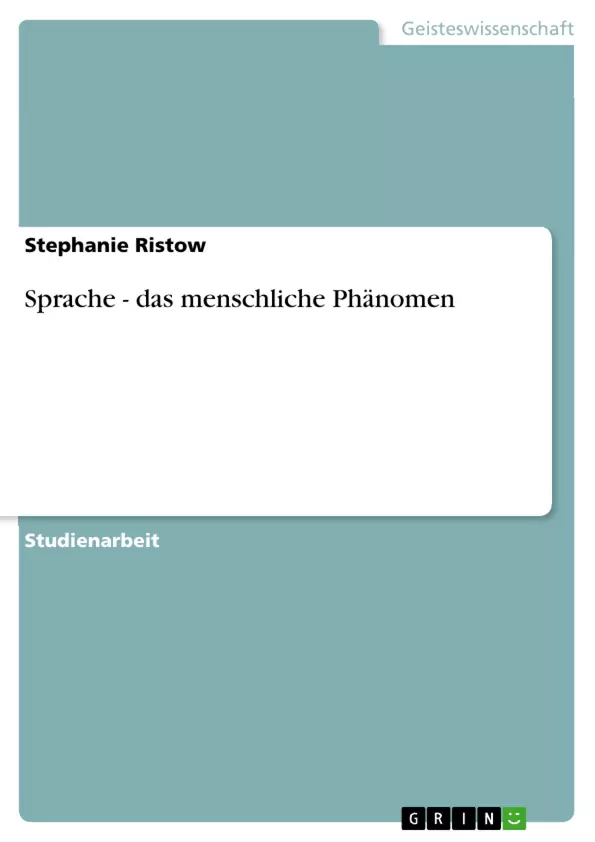I. Einleitung
Reden, Zuhören und Lesen sind essentieller Bestandteil unseres Lebens. Die Auswirkungen des Verlustes der Sprache auf das alltägliche Leben sind unvorstellbar. Obwohl Sprache vom Menschen als etwas selbstverständliches hingenommen wird, ist hinreichend bekannt, daß sie zu einer der „komplexesten kognitiven und motorischen Fähigkeiten“ zu zählen ist.
Forschern stellt sich immer wieder die Frage, was Sprache eigentlich ist. Dennoch gibt es bis heute keine exakte Definition.
Die erste Überlegung besteht schon darin, wo die Grenze zwischen einfachen Kommunikationsformen (zum Beispiel Tierlauten) und der menschlichen Sprache zu ziehen ist. Mit dem Wunsch, die Einzigartigkeit unserer Sprache zu betonen, tendiert man dazu, die Unterschiede zur Tierkommunikation hervorzuheben. In einer Definition werden daher in der Regel Worte als „Referenzen für Dinge oder Vorstellungen und das Ordnen von Worten auf verschiedene Weisen, um die Bedeutung zu verändern“ erwähnt. Für gewöhnlich werden Worte als Basis der Sprache verstanden. Linguisten nehmen jedoch eine andere Gliederung vor.
Danach setzt sich Sprache aus Grundbausteinen zusammen. Die grundlegenden Einheiten unterscheiden sie für Gesprochenes und Geschriebenes. Für die verbale Sprache sind dies Phoneme; für das Geschriebene bilden Grapheme diese Grundlage. Werden die Phoneme in einer bestimmten Reihenfolge zusammengesetzt, so ergeben sich Morpheme (die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten eines Wortes). Morpheme sind entweder selbst Worte oder werden zu Worten kombiniert (Morpheme als Stammform, Affix oder Flexionsform). Die Syntax wird auch als Grammatik bezeichnet und definiert, welche Kombinationen von Worten zu Phrasen und Sätzen zulässig sind. Eine Schlüsselrolle hierbei spielen Verben und der richtige Gebrauch des Tempus.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Spracherwerb
- II. Sprache im Bezug auf ihre Entstehung
- II.1. Sprache und ihre Ursprünge
- II.2. Die Weiterentwicklung der Zeichensprache
- II.3. Die sprachähnliche Kommunikation beim Menschenaffen
- III. Das Kategoriensystem
- IV. Sprache als motorisches Verhalten
- V. Die Lokalisation der Sprache
- V.1. Reiz- und Ablationsexperimente
- V.1.1. Elektrische Reizung
- V.1.2. Subcortikale Sprachkomponenten
- V.2. Identifikation von Sprachzonen durch Hirnblutungsmessungen
- VI. Neurologische Modellvorstellungen
- VIII. Sprachstörungen
- VIII.1. Neurologische Schäden und Aphasien
- VIII.2. Klassifikation von Aphasien
- IX. Die Erfassung von Aphasien
- X. Die Erfassung von Dyslexien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Sprache und untersucht die komplexen kognitiven und motorischen Prozesse, die mit dem Sprechen, Verstehen und Erlernen von Sprache verbunden sind. Ziel ist es, die einzigartigen Merkmale der menschlichen Sprache zu erforschen und deren evolutionäre Entwicklung zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung der menschlichen Sprache
- Die Struktur und Organisation der Sprache, einschließlich Phoneme, Morpheme und Syntax
- Die neurologischen Grundlagen des Sprachverständnisses und der Sprachproduktion
- Die Lokalisation von Sprachzonen im Gehirn und deren Funktion
- Sprachstörungen wie Aphasien und Dyslexien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und betont die Bedeutung der Sprache für das menschliche Leben. Sie beleuchtet die Schwierigkeit, Sprache exakt zu definieren und hebt die Unterschiede zur Tierkommunikation hervor. Die Einleitung stellt grundlegende sprachliche Einheiten wie Phoneme, Morpheme und Syntax vor und erläutert den Zusammenhang zwischen Sprache und dem Gedächtnis. Das erste Kapitel befasst sich mit dem Spracherwerb und beleuchtet die erstaunliche Fähigkeit von Kindern, die Sprache in den ersten Lebensjahren zu erlernen.
Schlüsselwörter
Sprache, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Phoneme, Morpheme, Syntax, Semantik, Sprachverständnis, Sprachproduktion, Lokalisation der Sprache, Aphasie, Dyslexie, Neurologie, Kognition, Evolution.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet menschliche Sprache von der Tierkommunikation?
Menschliche Sprache nutzt Worte als Referenzen für abstrakte Vorstellungen und ordnet sie nach komplexen syntaktischen Regeln, um Bedeutungen präzise zu verändern.
Was sind Phoneme und Morpheme?
Phoneme sind die kleinsten lautlichen Einheiten der gesprochenen Sprache. Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten eines Wortes.
Was ist eine Aphasie?
Eine Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die durch neurologische Schäden (z.B. Hirnblutungen) in den Sprachzentren des Gehirns verursacht wird.
Wo im Gehirn wird Sprache verarbeitet?
Die Sprachverarbeitung findet in spezifischen Sprachzonen der Großhirnrinde statt, wobei auch subcortikale Komponenten eine Rolle spielen.
Wie lernen Kinder ihre Muttersprache?
Der Spracherwerb ist eine erstaunliche kognitive Leistung, bei der Kinder in den ersten Lebensjahren intuitiv die Regeln der Syntax und Semantik ihrer Umgebung übernehmen.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Ristow (Autor:in), 1999, Sprache - das menschliche Phänomen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308