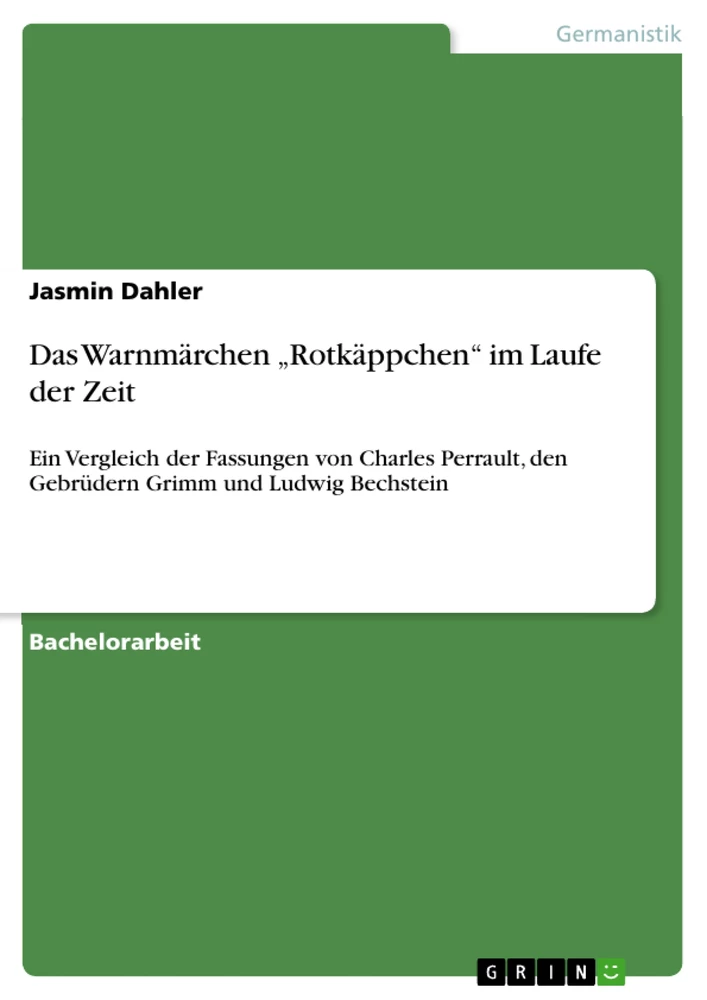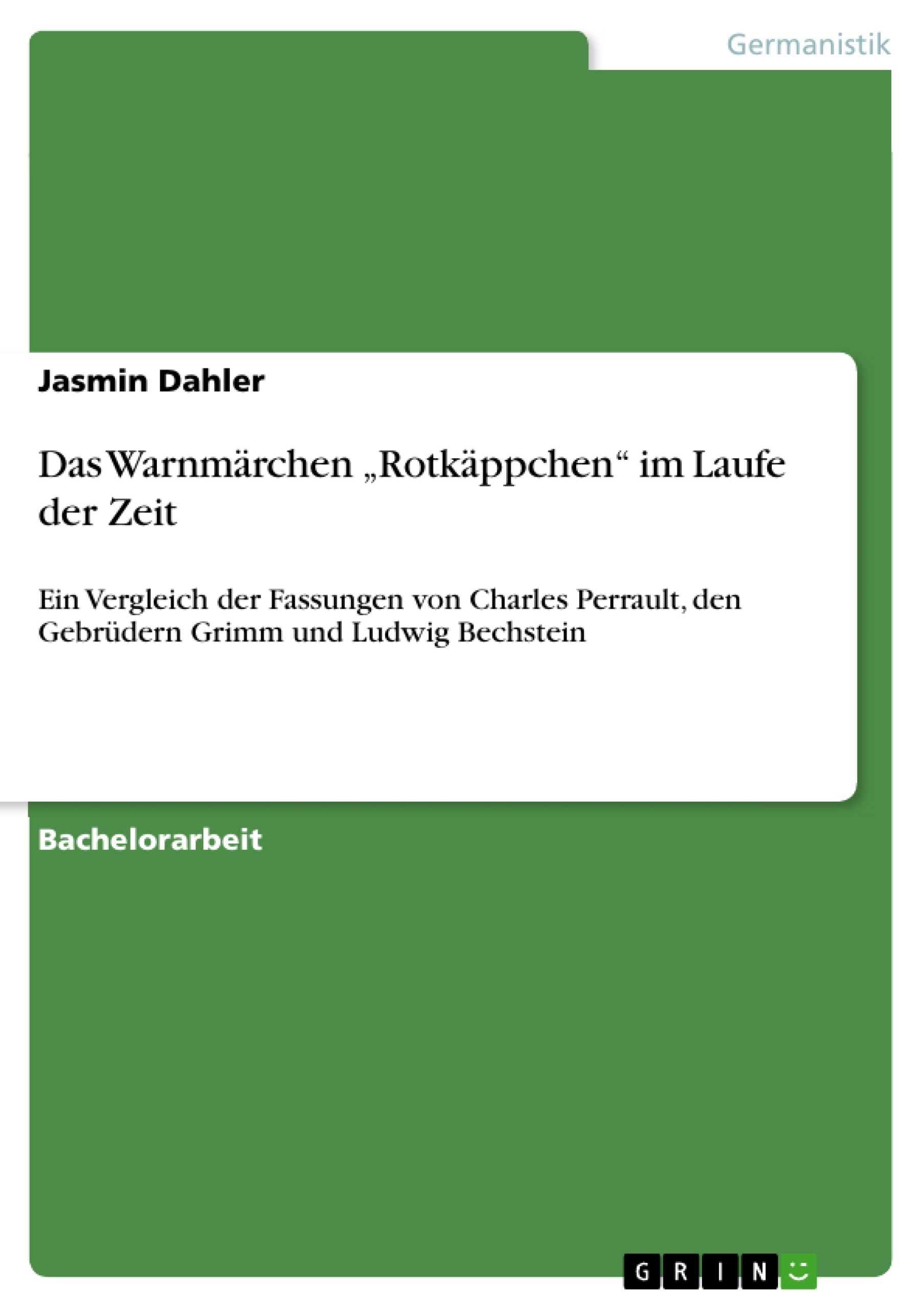Das Ziel der Arbeit ist es, anhand des Märchens „Rotkäppchen“ ein zusammenhängendes Bild davon zu zeichnen, wie sich das Märchen im Lauf der Zeit verändert hat und welche inhaltlichen und erzähltechnischen Merkmale dafür kennzeichnend sind.
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit beschränkt sich die Arbeit auf drei Fassungen von Rotkäppchen. Es handelt sich dabei um die französische Fassung von Charles Perrault, die der Gebrüder Grimm und die Version Ludwig Bechsteins.
Vor der Analyse der drei Fassungen wird der Begriff des Märchens, insbesondere des Volksmärchens, beleuchtet. Danach wird geklärt, was genau ein Warn- bzw. Schreckmärchen ist und welche Handlungselemente dieses enthalten muss. Der letzte theoretische Aspekt soll sich mit dem Wolfsmotiv beschäftigen. Nachdem die theoretischen Aspekte geklärt wurden, wird jeder der drei Texte analysiert.. Dabei wird an einigen Stellen auf Interpretationsansätze von Bruno Bettelheim, Hans-Wolf Jäger, Jack Zipes und Hans Ritz eingegangen.
Nach dem jeder Text für sich alleine betrachtet wurde, werden die drei Fassungen verglichen. Dabei werden Anfangsszene, Verführungsszene, die Szene im Haus der Großmutter und das Ende untersucht. Im letzten Schritt wird die Entwicklung des Wolfsmotivs innerhalb der drei Fassungen betrachtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Theoretische Aspekte
- 1.1. Das Volksmärchen
- 1.2. Warn- und Schreckmärchen
- 1.3. Der Wolf als Schreckgestalt
- 2. Charles Perrault – Ein Warnmärchen für die französische Oberschicht
- 3. Gebrüder Grimm – Das idealtypische Märchen
- 4. Ludwig Bechstein – Das Märchen als humoristische Unterhaltungsliteratur
- 5. Vergleich der Fassungen von Perrault, Grimm und Bechstein
- 5.1. Unterschiede am Anfang der Geschichte
- 5.2. Unterschiede im Gespräch mit dem Wolf
- 5.3. Unterschiede im Verhalten des Wolfes im Haus der Großmutter
- 5.4. Unterschiede am Ende
- 5.5 Unterschiede bei der Schreckgestalt des Wolfes
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Märchens „Rotkäppchen" anhand von drei verschiedenen Fassungen: Charles Perraults, der Gebrüder Grimm und Ludwig Bechsteins. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Veränderungen des Märchens, sowohl inhaltlich als auch erzähltechnisch, zu zeichnen und die jeweiligen Zeitgeister und Intentionen der Autoren aufzuzeigen.
- Das Volksmärchen als Genre und seine Merkmale
- Der Wandel des Warnmärchens im Kontext der drei Fassungen
- Die Entwicklung des Wolfsmotivs und seine Symbolik
- Unterschiede in der Darstellung des Wolfes und der Moral der Geschichten
- Der Einfluss von Zeit und Gesellschaft auf die Gestaltung des Märchens
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Märchen in der Kultur. Sie erläutert die Intention der Arbeit und die Auswahl der drei Fassungen von Rotkäppchen.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit theoretischen Aspekten des Märchens, insbesondere mit dem Volksmärchen und seinen Merkmalen. Es analysiert die Funktion des Warn- und Schreckmärchens und untersucht das Motiv des Wolfes als Schreckgestalt.
Das zweite Kapitel analysiert die Fassung von Charles Perrault und betrachtet die Geschichte als Warnmärchen für die französische Oberschicht. Es untersucht die spezifischen Merkmale und Botschaften der Fassung im Kontext ihrer Entstehungszeit.
Das dritte Kapitel widmet sich der Fassung der Brüder Grimm und interpretiert sie als idealtypisches Märchen. Es analysiert die spezifischen Eigenschaften des Märchens im Kontext der Romantik und die Bedeutung der moralischen Botschaft.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Ludwig Bechsteins Fassung und untersucht die Geschichte als humoristische Unterhaltungsliteratur. Es analysiert die Unterschiede zu den vorherigen Fassungen und die spezifischen Merkmale von Bechsteins Bearbeitung.
Das fünfte Kapitel vergleicht die drei Fassungen von Rotkäppchen und untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Anfangsszene, im Gespräch mit dem Wolf, im Verhalten des Wolfes im Haus der Großmutter und am Ende der Geschichte. Es betrachtet die Entwicklung des Wolfsmotivs innerhalb der drei Fassungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Volksmärchen, Warnmärchen, Schreckmärchen, Rotkäppchen, Charles Perrault, Gebrüder Grimm, Ludwig Bechstein, Wolfsmotiv, Moral, Symbolik, Zeitgeist, Gesellschaft, Literaturanalyse, Interpretation.
- Quote paper
- Jasmin Dahler (Author), 2015, Das Warnmärchen „Rotkäppchen“ im Laufe der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307894