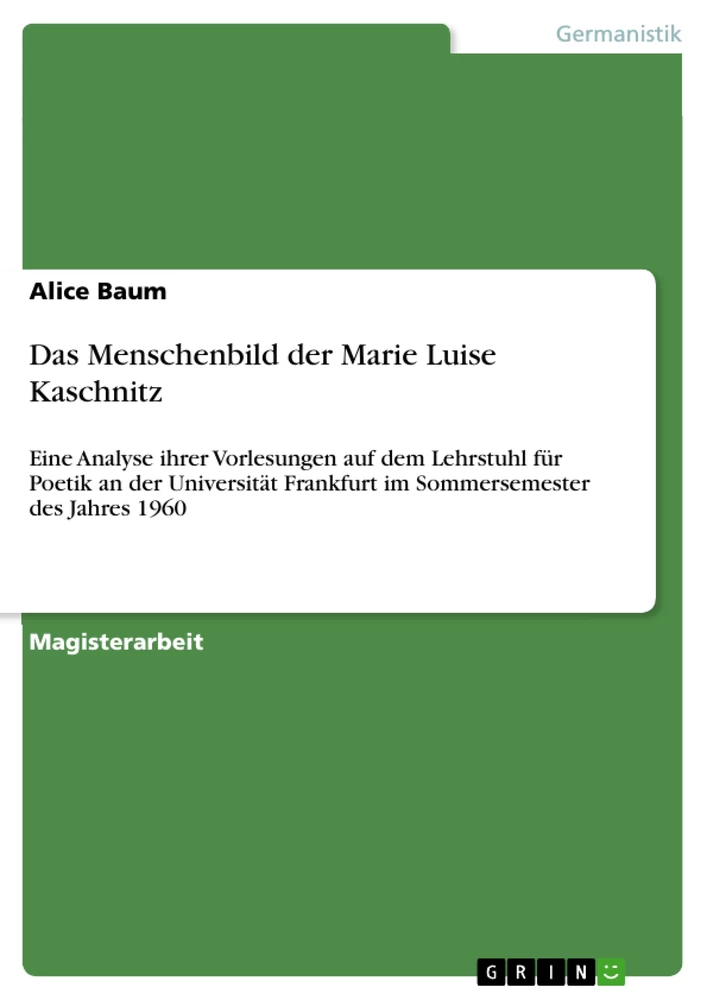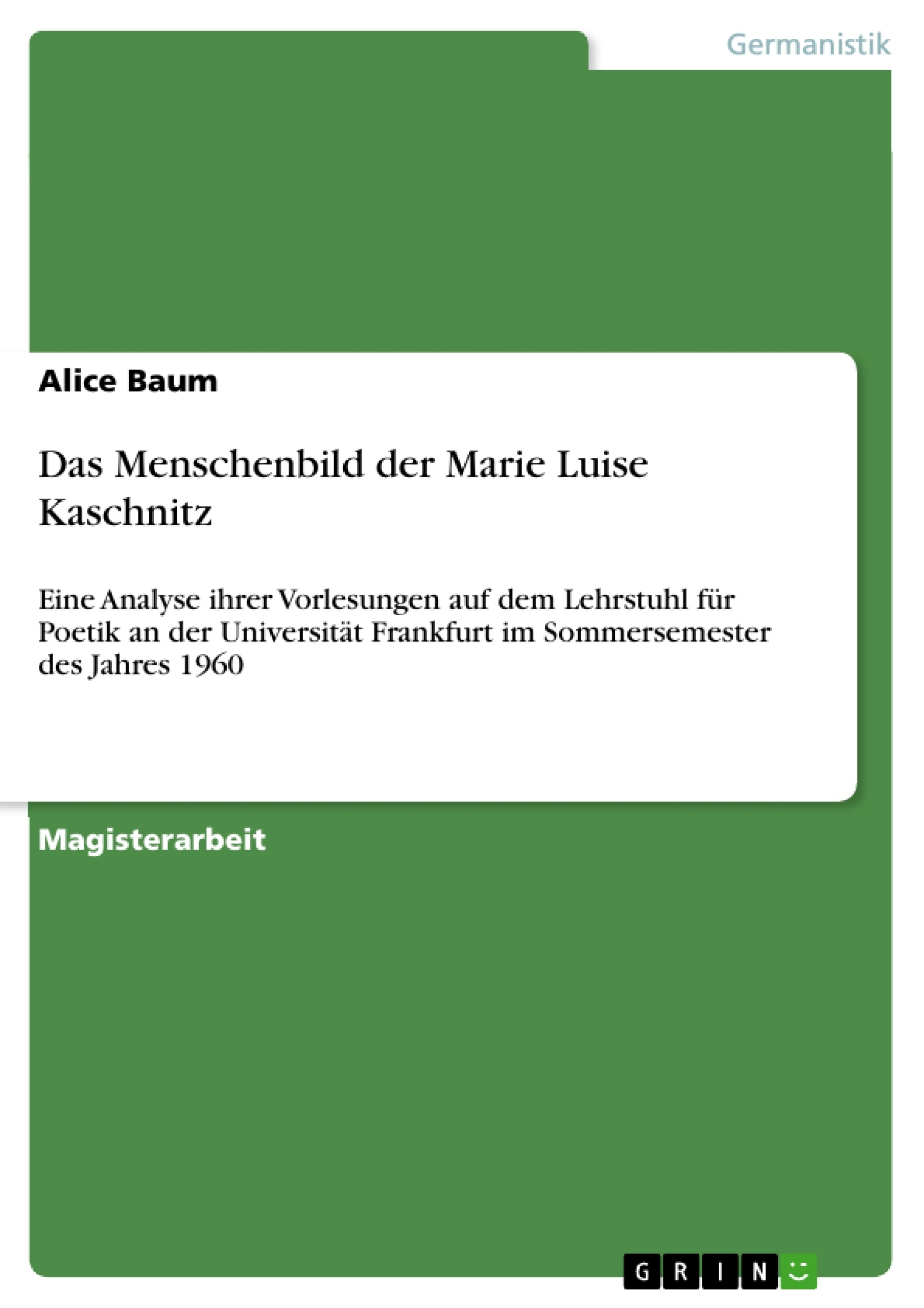Im Sommersemester des Jahres 1960 übernahm Marie Luise Kaschnitz als zweite Dichterin – nach Ingeborg Bachmann – die auf Initiative Professor Viebrocks vom S. Fischer-Verlag gestiftete Poetik-Dozentur an der Frankfurter Universität. Ihre Vorlesungen über Gestalten europäischer Dichtung von Shakespeare bis Beckett bilden den Kern ihres elf Jahre später erschienenen Sammelbandes "Zwischen Immer und Nie" – ein Titel, der dem Gedicht Nachts des von der Dichterin hoch verehrten Paul Celan entliehen ist.
In seinem Artikel Poetik im Hörsaal verweist Andreas Razumorsky auf die Tatsache, daß „Frau von Kaschnitz die Willkürlichkeit (betonte), mit der sie ihre Auswahlliste zusammengestellt habe: es handele sich um Gestalten der Weltliteratur, denen lediglich ihre Unsterblichkeit gemeinsam ist, ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Parnaß; gefiltert aus dem Leben und der Erfahrung unzählbarer, anonymer Einzelleben, seien sie, der Phantasie der Dichter entsprungen, lebendiger und in ihrer fortdauernden Wirkung realer als so mancher Lebender.“
Dieser Hinweis ist insofern interessant, als er, auf den ersten Blick zumindest, nicht nur das Thema der vorliegenden Arbeit in Frage zu stellen scheint, sondern in Wirklichkeit auch die Antwort bereits implizit bereithält: Wie nämlich – mag man fragen – kann die Analyse einer Vorlesungsreihe, die der Darstellung recht willkürlich ausgewählter „Gestalten der europäischen Literatur“ gewidmet ist, die Möglichkeit geben, das Menschenbild zu ergründen, das von Marie Luise Kaschnitz vertreten wird?
Die Antwort auf diese Frage und damit die Begründung der Möglichkeit der thematischen Analyse liegt in jener Willkür selbst, die ja Ausdruck des von der Dichterin – zumindest in dieser Phase ihres Schaffens – eingenommenen Standpunktes ist. Sie hält offensichtlich genau jene Gestalten – Romeo und Julia, Prospero, Mignon und Werther, Wozzek und Carmen, Anna Karenina und die „Frau ohne Schatten“, Ekdal und Fuhrmann Henschel, Merseault und die Endzeitgestalten Becketts – für Verkörperungen des ewig Menschlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Marie Luise Kaschnitz' Auswahl der thematischen Gestalten ihrer Vorlesungen
- Die Hypothese der nicht rein willkürlichen Auswahl
- Die sechs Vorlesungen
- Die Hypothese des in den Vorlesungen vertretenen tragischen Menschenbildes
- Kapitel 2: Verifikation der Hypothese des tragischen Menschenbildes der Frankfurter Vorlesungen
- Die konstitutiven Elemente des tragischen Menschenbildes allgemein
- Die Konkretisierung und Spezifizierung der konstitutiven Elemente des tragischen Menschenbildes in den Gestalten der Frankfurter Vorlesungen
- Der tragische Mensch in den Vorlesungen der Marie Luise Kaschnitz: Versuch einer synoptischen Rekonstruktion
- Kapitel 3: Das tragische Menschenbild der Marie Luise Kaschnitz
- Leben und Werk der Marie Luise Kaschnitz: Ursachen des tragischen Menschenbildes
- Die zentralen Themen des literarischen Gesamtwerkes von Marie Luise Kaschnitz: Ausdruck des tragischen Menschenbildes
- Kritik und Selbstkritik: das tragische Menschenbild im Leben und literarischen Schaffen der Marie Luise Kaschnitz
- Das Urteil der Kritiker
- Die Selbstkritik der Marie Luise Kaschnitz
- Kritische Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Menschenbild der Marie Luise Kaschnitz anhand ihrer Frankfurter Poetik-Vorlesungen aus dem Sommersemester 1960, die später in dem Sammelband „Zwischen Immer und Nie“ veröffentlicht wurden. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswahl der literarischen Figuren und deren Interpretation durch Kaschnitz.
- Das tragische Menschenbild in Kaschnitz' Vorlesungen
- Die Auswahlkriterien der von Kaschnitz behandelten literarischen Figuren
- Der Zusammenhang zwischen Kaschnitz' Leben, Werk und ihrem Menschenbild
- Die Relevanz des in den Vorlesungen präsentierten Menschenbildes für die heutige Zeit
- Die kritische Rezeption von Kaschnitz' Werk und ihrer Selbstwahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Marie Luise Kaschnitz' Auswahl der thematischen Gestalten ihrer Vorlesungen: Dieses Kapitel untersucht die Auswahl der literarischen Figuren (Romeo und Julia, Prospero, Mignon und Werther, Wozzeck und Carmen, Anna Karenina, die „Frau ohne Schatten“, Ekdal und Fuhrmann Henschel, Mersault und Becketts Endzeitgestalten), die Kaschnitz in ihren Frankfurter Vorlesungen behandelt. Es hinterfragt die scheinbare Willkürlichkeit dieser Auswahl und stellt die Hypothese auf, dass diese Figuren ein tragisch geprägtes Menschenbild repräsentieren, das zentral für Kaschnitz' Denken ist. Die Analyse konzentriert sich auf die Begründung dieser Annahme und legt den Grundstein für die weitere Untersuchung des tragischen Menschenbildes in Kaschnitz' Werk.
Kapitel 2: Verifikation der Hypothese des tragischen Menschenbildes der Frankfurter Vorlesungen: Kapitel 2 verifiziert die im ersten Kapitel aufgestellte Hypothese. Es definiert zunächst die konstitutiven Elemente eines tragischen Menschenbildes im Allgemeinen und analysiert dann, wie diese Elemente in den von Kaschnitz behandelten Figuren konkretisiert und spezifiziert werden. Durch eine synoptische Rekonstruktion der Figuren wird gezeigt, wie sie die zentralen Aspekte des tragischen Menschenbildes verkörpern und wie Kaschnitz diese Aspekte in ihren Interpretationen hervorhebt. Die Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der von Kaschnitz ausgewählten literarischen Figuren und ihrer Bedeutung im Kontext ihres tragischen Menschenbildes.
Kapitel 3: Das tragische Menschenbild der Marie Luise Kaschnitz: In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Kaschnitz' Leben, ihrem Werk und ihrem tragischen Menschenbild untersucht. Es werden biographische Aspekte ihres Lebens beleuchtet, die möglicherweise die Entstehung ihres Menschenbildes beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Analyse der zentralen Themen in Kaschnitz' gesamtem literarischen Werk und wie diese das tragische Menschenbild widerspiegeln. Schließlich werden kritische Rezensionen von Kaschnitz' Werk und ihre eigene Selbstkritik in die Analyse eingebunden, um ein umfassendes Bild ihres Menschenbildes zu zeichnen und dessen Komplexität zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Marie Luise Kaschnitz, Poetik-Vorlesungen, Frankfurt, Tragisches Menschenbild, Literarische Figuren, Europäische Literatur, „Zwischen Immer und Nie“, Lebenswerk, Literaturkritik, Selbstkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Marie Luise Kaschnitz' Frankfurter Poetik-Vorlesungen: Ein tragisch geprägtes Menschenbild"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Menschenbild der Dichterin Marie Luise Kaschnitz anhand ihrer Frankfurter Poetik-Vorlesungen aus dem Sommersemester 1960, die im Sammelband „Zwischen Immer und Nie“ veröffentlicht wurden. Der Fokus liegt auf der Auswahl der literarischen Figuren und deren Interpretation durch Kaschnitz.
Welche literarischen Figuren werden in den Vorlesungen behandelt?
Kaschnitz behandelt in ihren Vorlesungen Figuren wie Romeo und Julia, Prospero, Mignon und Werther, Wozzeck und Carmen, Anna Karenina, die „Frau ohne Schatten“, Ekdal und Fuhrmann Henschel sowie Mersault und Becketts Endzeitgestalten. Die Auswahl dieser Figuren ist ein zentraler Punkt der Analyse.
Welche zentrale Hypothese wird in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass die von Kaschnitz ausgewählten literarischen Figuren ein tragisch geprägtes Menschenbild repräsentieren, das für ihr Denken zentral ist. Diese Hypothese wird im Laufe der Arbeit verifiziert.
Wie wird die Hypothese des tragischen Menschenbildes verifiziert?
Die Verifikation der Hypothese erfolgt durch die Definition der konstitutiven Elemente eines tragischen Menschenbildes im Allgemeinen. Anschließend wird analysiert, wie diese Elemente in den von Kaschnitz behandelten Figuren konkretisiert und spezifiziert werden. Eine synoptische Rekonstruktion der Figuren verdeutlicht, wie sie zentrale Aspekte des tragischen Menschenbildes verkörpern.
Welchen Zusammenhang untersucht die Arbeit zwischen Kaschnitz' Leben und Werk?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kaschnitz' Leben, ihrem Werk und ihrem tragischen Menschenbild. Biographische Aspekte werden beleuchtet, um die Entstehung ihres Menschenbildes zu verstehen. Die Analyse der zentralen Themen in ihrem gesamten literarischen Werk zeigt, wie diese das tragische Menschenbild widerspiegeln.
Welche Rolle spielen Kritik und Selbstkritik in der Analyse?
Kritische Rezensionen von Kaschnitz' Werk und ihre eigene Selbstkritik werden in die Analyse einbezogen, um ein umfassendes Bild ihres Menschenbildes zu zeichnen und dessen Komplexität zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 untersucht die Auswahl der literarischen Figuren durch Kaschnitz. Kapitel 2 verifiziert die Hypothese des tragischen Menschenbildes. Kapitel 3 untersucht den Zusammenhang zwischen Kaschnitz' Leben, Werk und ihrem tragischen Menschenbild, inklusive Kritik und Selbstkritik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Marie Luise Kaschnitz, Poetik-Vorlesungen, Frankfurt, Tragisches Menschenbild, Literarische Figuren, Europäische Literatur, „Zwischen Immer und Nie“, Lebenswerk, Literaturkritik, Selbstkritik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Menschenbild von Marie Luise Kaschnitz anhand ihrer Frankfurter Vorlesungen. Sie untersucht die Auswahlkriterien der behandelten Figuren, den Zusammenhang zwischen Leben, Werk und Menschenbild, die Relevanz des Menschenbildes für die heutige Zeit und die kritische Rezeption von Kaschnitz' Werk.
- Quote paper
- Alice Baum (Author), 1983, Das Menschenbild der Marie Luise Kaschnitz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307687