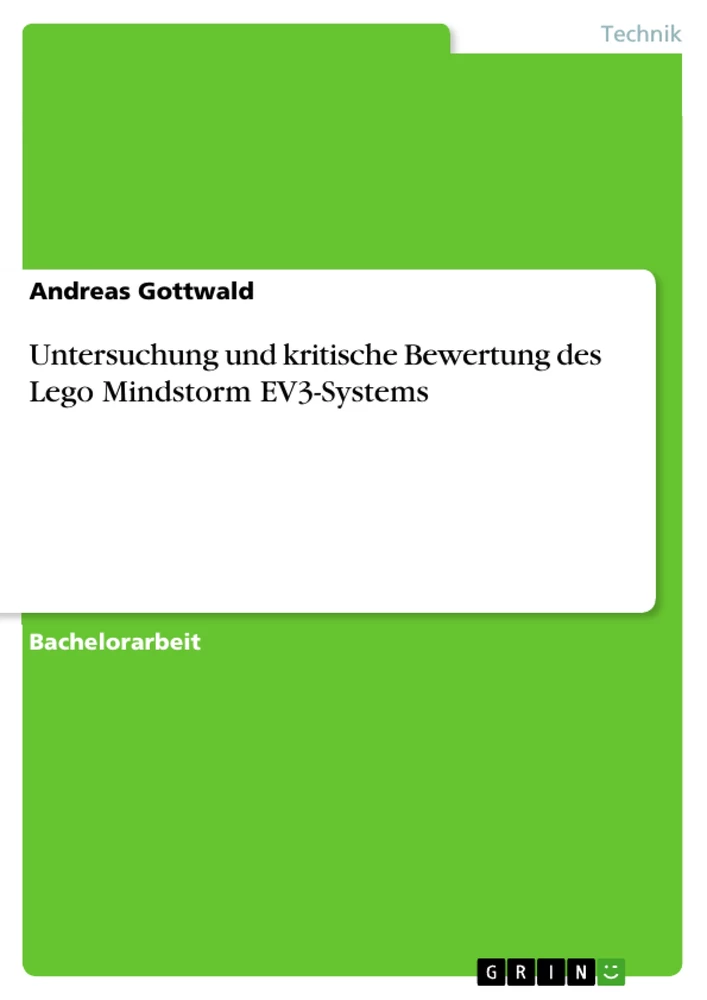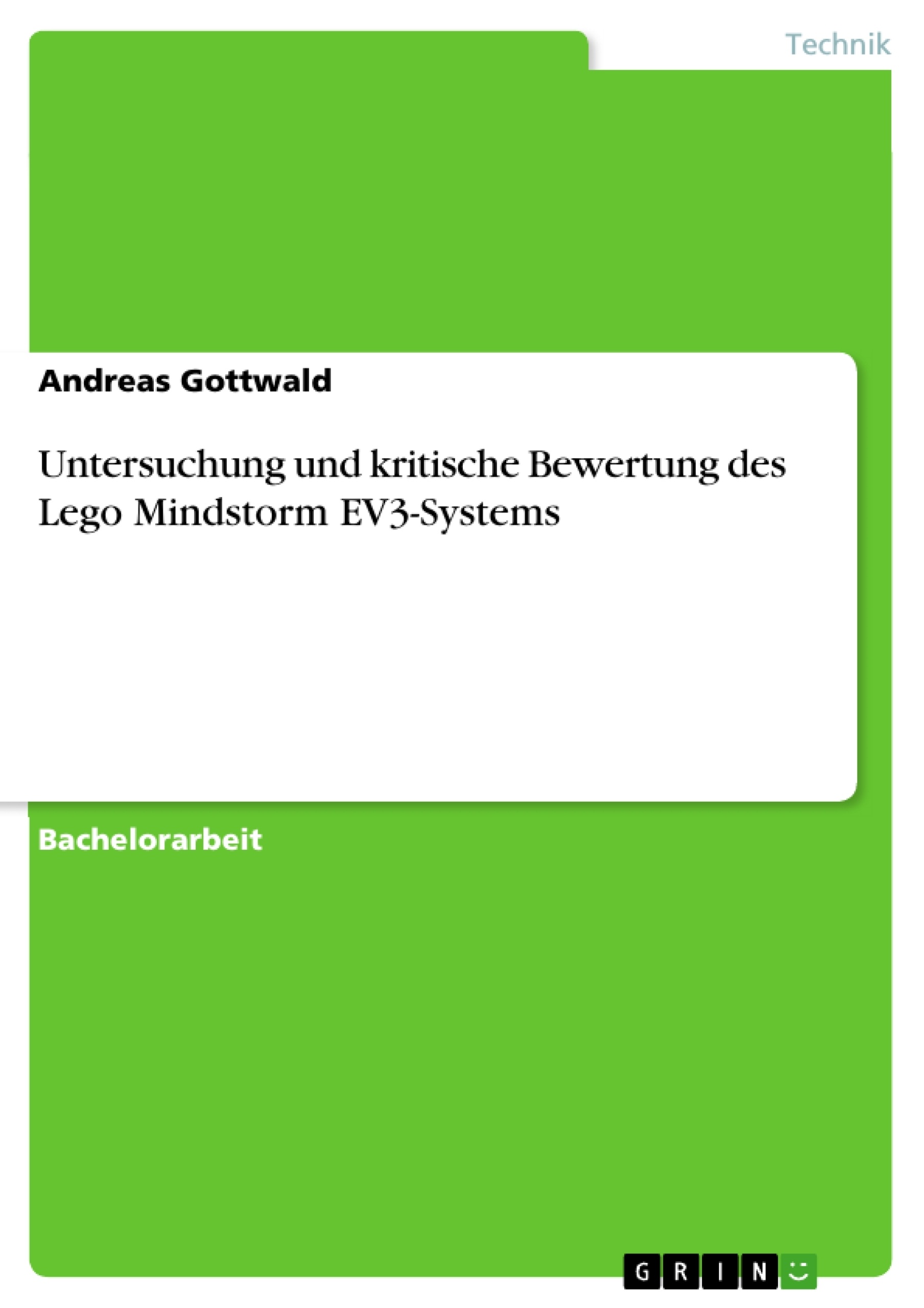In dieser Arbeit wird das Lego Mindstorm System untersucht und kritisch bewertet. Ich habe mich entschlossen, in meiner Ausarbeitung den Schwerpunkt auf die Sensorik und Aktorik des Mindstorm Systems zu legen und die Programmierbarkeit nur in einem kleinen Umfang zu betrachten. Dennoch werde ich auch der Programmierbarkeit ein kleine Einheit widmen und kurz auf die Möglichkeiten der Programmierung eingehen.
Das Grundlagenset bietet eine solide Basis für den Einsatz im Schulunterricht, auf welche in den folgenden Kapiteln immer wieder Bezug genommen wird. Auch ist diese Arbeit nicht nur geeignet für Berufliche Schulen, sondern auch für andere Schulzweige, wie zum Beispiel für die Fachoberschule Fachrichtung Elektrotechnik, oder auch für eine Realschule zum Beispiel in den Fächern Physik oder Informatik.
In den beruflichen Schulen, meinem späteren Wirkungsfeld, sind die Einsatzmöglichkeiten fast unbegrenzt. Das Set bietet diverse Nutzungsmöglichkeiten. Es könnte dazu genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern die graphische Programmierung von Steuerungen näher zu bringen. Auch haben die Lernenden hier die Möglichkeit, ihr programmiertes Programm direkt auf den Baustein zu laden und auf mögliche Fehler zu testen. Das System kann auch zur Vernetzung des Systems per LAN, Wireless LAN oder Bluetooth eingesetzt werden. Dies könnte dann fortgeführt werden in eine Unterrichtseinheit zum Thema „Kommunikation im modernen Haushalt beziehungsweise in der Industrie“. Auch kann das Set zur Einführung in die Theorie der Sensoren und Aktoren genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Grundlegendes
- 1.1. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden?
- 1.2. Was ist ein Lego® EV3 Mindstorm?
- 1.3. Beschreibung des Lieferumfanges
- 2.) Über welche Sensoren verfügt der Bausatz?
- 2.1. Farbsensor
- 2.2. Ultraschallsensor
- 2.3. Berührungssensor / Tastsensor
- 2.4 Kreiselsensor
- 3.) Über welche Aktoren verfügt der Baukasten?
- 3.1. Die großen Motoren
- 3.2. Der mittlere Motor
- 3.3. Lautsprecher
- 3.4. Tastatur
- 3.5. Bildschirm
- 4.) Programmierbarkeit des Bausteins
- 4.1. Direkte Programmierung über das Bausteininterface
- 4.2. Direkte Programmierung per Computer
- 4.3. Die Lego Software
- 4.4. Andere Programmieroberflächen
- 4.4.1. RobotC
- 4.4.2. LeJos
- 4.4.3. Open Roberta / NEPO
- 5.) Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es im Unterricht?
- 5.1.1. Testung der Genauigkeit des Ultraschallsensors
- 5.1.2. Testung der Berührungs-/ Tastsensoren
- 5.1.3. Testung des Farbsensors
- 5.1.4. Testung des Kreiselsensors
- 5.2. Aufwand und Probleme
- 6.) Einsatz an den Schulen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht und bewertet kritisch das Lego Mindstorm EV3-System, mit dem Schwerpunkt auf Sensorik und Aktorik. Die Arbeit zielt darauf ab, eine praxisnahe Handreichung für Lehrende zu erstellen, um den Einsatz des EV3 im Unterricht zu erleichtern und zu fördern. Die Programmierbarkeit wird ebenfalls kurz behandelt.
- Analyse der Sensorik und Aktorik des Lego Mindstorm EV3-Systems
- Bewertung der Genauigkeit und der Grenzen verschiedener Sensoren
- Untersuchung der verschiedenen Programmiermöglichkeiten
- Evaluierung des didaktischen Potentials für den Schulunterricht
- Auswertung von Erfahrungen mit dem EV3-System an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Grundlegendes: Dieses Kapitel erläutert die Motivation des Autors für die Wahl des Themas und gibt eine Einführung in das Lego Mindstorm EV3-System. Es beschreibt den Lieferumfang und hebt die Unterschiede zwischen der Home- und der Education-Version hervor. Der Fokus liegt auf dem Potential des Systems für den Einsatz im Schulunterricht verschiedener Schulformen und Fächer, z.B. die Vermittlung grafischer Programmierung, die Analyse von Sensoren und Aktoren sowie die Realisierung von Projektarbeiten.
2.) Über welche Sensoren verfügt der Bausatz?: Dieses Kapitel detailliert die verschiedenen Sensoren des EV3-Sets (Farb-, Ultraschall-, Berührungs- und Kreiselsensor). Für jeden Sensor werden die Funktionsweise, die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und mögliche Probleme bei der Verwendung, wie z.B. Messfehler oder die Notwendigkeit der Kalibrierung, erläutert. Es werden Beispiele für die Anwendung der Sensoren in Programmen gegeben.
3.) Über welche Aktoren verfügt der Baukasten?: Hier werden die Aktoren des EV3-Systems vorgestellt: große Motoren, mittlerer Motor, Lautsprecher, Tastatur und Bildschirm. Für jeden Aktor werden die Funktionsweise, die Steuerungsmöglichkeiten mittels der Software und Beispiele für den Einsatz im Unterricht erklärt. Es werden verschiedene Steuerungsmethoden (Gradzahl, Umdrehungen, Zeit, Dauerbetrieb) und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
4.) Programmierbarkeit des Bausteins: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten zur Programmierung des EV3-Bausteins: die direkte Programmierung über das Bausteininterface, die Programmierung per Computer mit der Lego-Software und die Verwendung anderer Programmieroberflächen wie RobotC, LeJos und Open Roberta/NEPO. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze im Hinblick auf Komplexität, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität verglichen.
5.) Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es im Unterricht?: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Experimente zur Testung der Genauigkeit der Sensoren (Ultraschall, Berührung, Farbe und Kreiselsensor). Es werden die Vorgehensweisen bei den Experimenten, die erzielten Ergebnisse, die Messfehler und deren Ursachen detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden tabellarisch dargestellt und grafisch visualisiert. Der Zeitaufwand und die Probleme bei der Durchführung der Experimente werden ebenfalls diskutiert.
6.) Einsatz an den Schulen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage an Schulen zum Einsatz des Lego Mindstorm EV3-Systems und seiner Vorgänger. Es werden die positiven Erfahrungen der Lehrkräfte, der Einsatz in verschiedenen Schulformen und Fächern sowie die Finanzierung der Sets hervorgehoben. Gleichzeitig werden auch Probleme wie der Mangel an Kleinteilen, defekte Einheiten und die Notwendigkeit von Ersatzteilen angesprochen. Die positive Berichterstattung in der Lokalpresse unterstreicht die Bedeutung des Systems für den Unterricht.
Schlüsselwörter
Lego Mindstorms EV3, Sensorik, Aktorik, Programmierung, Schulunterricht, didaktisches Potential, Ultraschallsensor, Farbsensor, Berührungssensor, Kreiselsensor, RobotC, LeJos, Open Roberta, Messgenauigkeit, Messfehler, praktischer Unterricht.
Lego Mindstorms EV3: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit bietet eine umfassende Übersicht über das Lego Mindstorms EV3-System. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Sensorik, Aktorik und Programmierbarkeit des EV3 sowie dessen didaktischem Potential im Schulunterricht. Die Arbeit analysiert die Genauigkeit der Sensoren, untersucht verschiedene Programmiermethoden und evaluiert den praktischen Einsatz an Schulen.
Welche Sensoren werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten folgender Sensoren: Farbsensor, Ultraschallsensor, Berührungssensor/Tastsensor und Kreiselsensor. Für jeden Sensor werden mögliche Probleme wie Messfehler und die Notwendigkeit der Kalibrierung erläutert. Es werden auch Beispiele für die Anwendung der Sensoren in Programmen gegeben.
Welche Aktoren werden behandelt?
Die Arbeit erklärt die Funktionsweise und Steuerungsmöglichkeiten der folgenden Aktoren: große Motoren, mittlerer Motor, Lautsprecher, Tastatur und Bildschirm. Verschiedene Steuerungsmethoden (Gradzahl, Umdrehungen, Zeit, Dauerbetrieb) und deren Vor- und Nachteile werden diskutiert, mit Beispielen für den Einsatz im Unterricht.
Welche Programmiermöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Programmiermethoden für den EV3: direkte Programmierung über das Bausteininterface, Programmierung per Computer mit der Lego-Software und die Nutzung weiterer Oberflächen wie RobotC, LeJos und Open Roberta/NEPO. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze bezüglich Komplexität, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität werden verglichen.
Wie wird das didaktische Potential des EV3 im Unterricht bewertet?
Die Arbeit präsentiert Experimente zur Testung der Sensorggenauigkeit (Ultraschall, Berührung, Farbe, Kreisel). Die Vorgehensweisen, Ergebnisse, Messfehler und deren Ursachen werden detailliert beschrieben und grafisch dargestellt. Der Zeitaufwand und Probleme bei der Durchführung werden ebenfalls diskutiert. Es werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Unterricht verschiedener Fächer und Schulformen vorgeschlagen, wie z.B. die Vermittlung grafischer Programmierung, die Analyse von Sensoren und Aktoren sowie die Realisierung von Projektarbeiten.
Welche Erfahrungen mit dem EV3 an Schulen werden präsentiert?
Die Arbeit beinhaltet Ergebnisse einer Umfrage an Schulen zum Einsatz des Lego Mindstorms EV3-Systems. Positive Erfahrungen der Lehrkräfte, der Einsatz in verschiedenen Schulformen und Fächern und die Finanzierung werden hervorgehoben. Probleme wie der Mangel an Kleinteilen, defekte Einheiten und die Notwendigkeit von Ersatzteilen werden ebenfalls angesprochen. Die positive Berichterstattung in der Lokalpresse wird ebenfalls erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lego Mindstorms EV3, Sensorik, Aktorik, Programmierung, Schulunterricht, didaktisches Potential, Ultraschallsensor, Farbsensor, Berührungssensor, Kreiselsensor, RobotC, LeJos, Open Roberta, Messgenauigkeit, Messfehler, praktischer Unterricht.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich hauptsächlich an Lehrende, die das Lego Mindstorms EV3-System im Unterricht einsetzen möchten. Sie dient als praxisnahe Handreichung zur Erleichterung und Förderung des Einsatzes des EV3.
- Quote paper
- Andreas Gottwald (Author), 2015, Untersuchung und kritische Bewertung des Lego Mindstorm EV3-Systems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307363