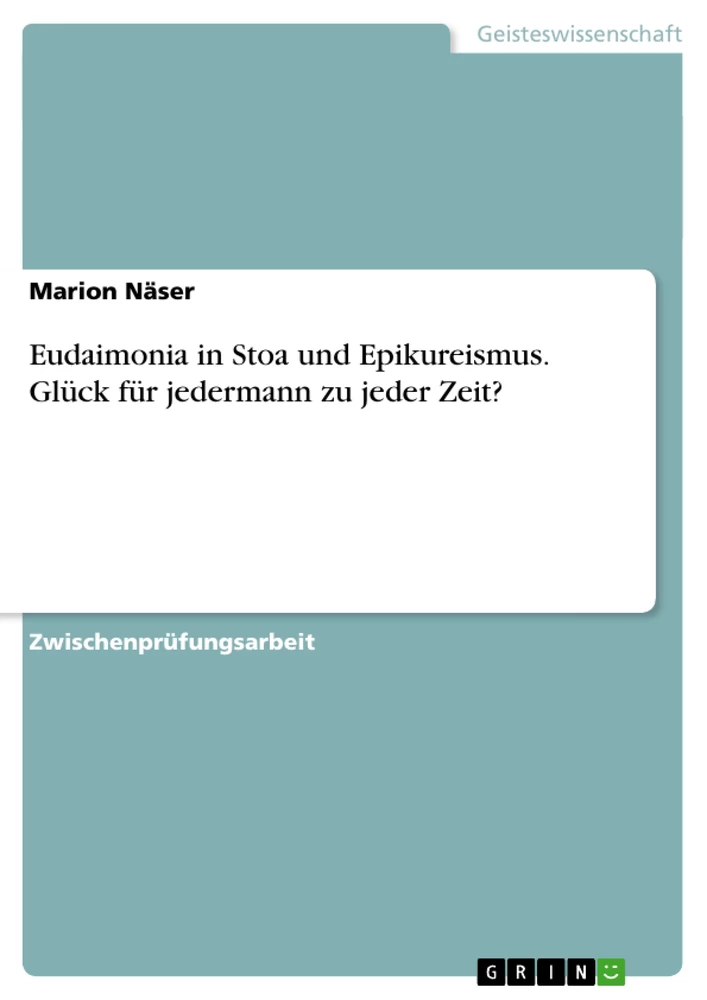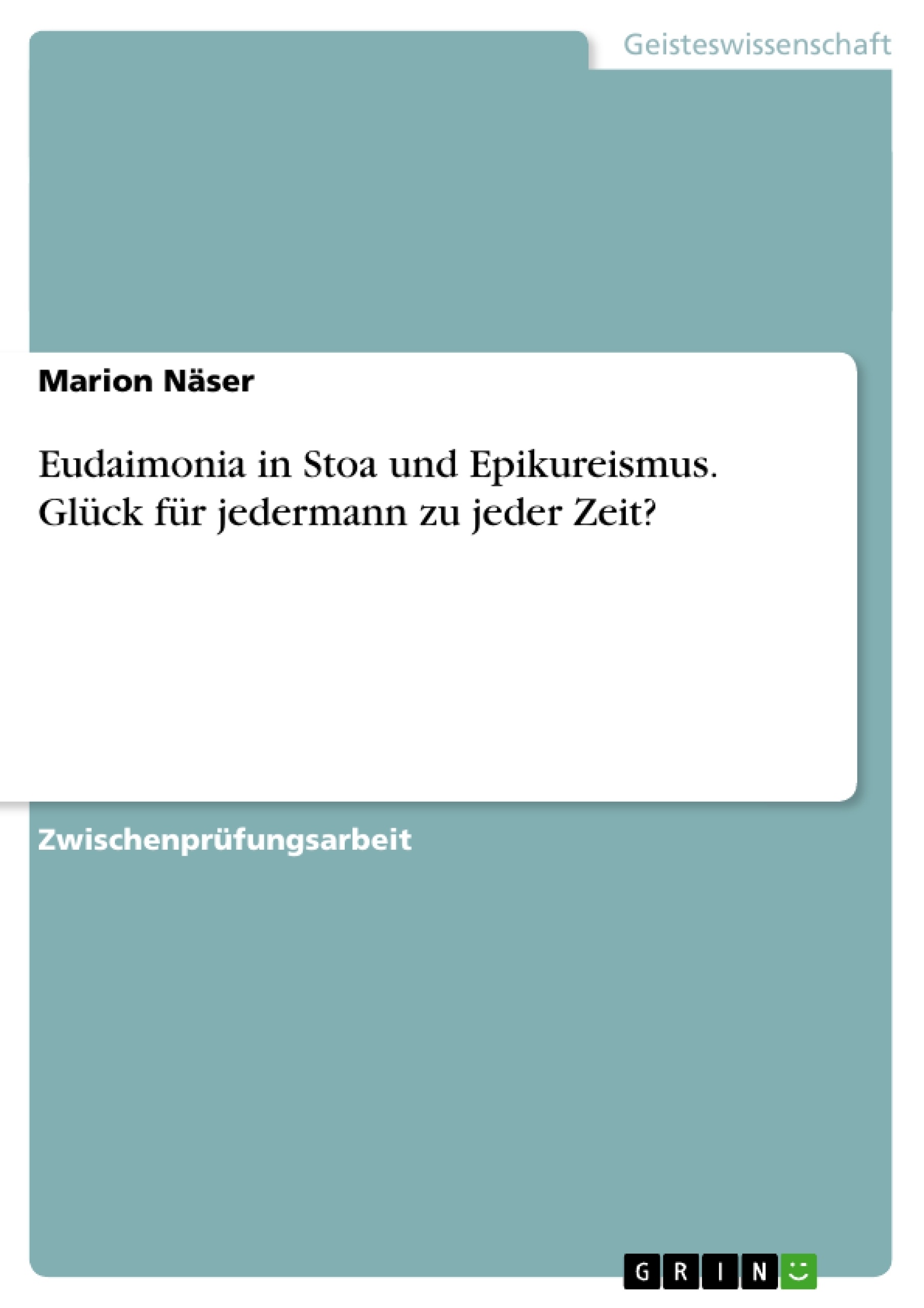In Stoa und Epikureismus ist das Glück des Menschen ein zentrales Thema: Die hellenistischen Ethiken versuchen, den Begriff des Glücks so zu bestimmen, dass seine Realisierung unter allen äußeren Umständen für jeden Menschen möglich erscheint. Daher wird das Glück verinnerlicht und bei beiden philosophischen Richtungen mit Bedürfnisreduktion und Autarkie verbunden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Vergleich der Glücksphilosophien der Stoa und des Epikureismus sowie eine Konfrontation mit den Theorien der Emotionspsychologie. Dieser interdisziplinäre Ansatz dient der Beantwortung der Frage, inwieweit der jeweilige Glückszustand und die Strategien zu seiner Erreichung psychologisch möglich und also praktisch durchführbar bzw. den natürlichen Voraussetzungen und emotionalen Bedürfnissen von Individuen angemessen sind.
Das Fazit dieser Überprüfung von Philosophie an der psychischen Realität ist, dass ein permanenter Zustand der Zufriedenheit, ein „Ruhen in sich selbst“ nicht ständig als Glück empfunden werden kann: Gelassenheit kann nur als allgemeine Geisteshaltung zu starke Unglücksempfindungen z.T. verhindern, aber aktives, intensives Glücksempfinden vermag sie nicht zu vermitteln, da der Mensch nur den Kontrast intensiv genießen kann; gewöhnt er sich an einen Zustand, so empfindet er diesen nicht mehr als Glück, sondern strebt nach einer weiteren Verbesserung. Glücksempfinden ist ein subjektives Gefühl, aber auch abhängig von objektiven Situationsfaktoren. Glück ist nicht nur Reflexion der Lebenszufriedenheit, sondern auch die Frequenz und Intensität positiver Emotionen. Glücksdefinitionen sind temporal und kulturell determiniert und werden von Erziehung, intellektuellen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften des betreffenden Individuums beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Stoa und Epikureismus – antike Glücksstrategien
- 1.1 Die Stoa
- 1.1.1 Glücksbegriff der Stoa
- 1.1.2 Der Weg zum Glück: Tugendhaft leben
- 1.1.2.1 Emotionen dämpfen (Affektbekämpfung)
- 1.2 Der Epikureismus
- 1.2.1 Glücksbegriff
- 1.2.2 Wege zum Glück
- 1.1 Die Stoa
- 2. Die Stoa, Epikur und die moderne Emotionspsychologie
- 2.1 Eudaimonia – ein zu eingeschränkter Glücksbegriff?
- 2.2 Die Emotionen dämpfen – eine Illusion?
- 2.3 Weiterentwicklung als Chance und Gefahr
- 2.4 Autarkeia? Abhängigkeit des Glücks von äußeren Faktoren
- 2.5 Glück für jeden? Abhängigkeit von Glück und Glücksfähigkeit von Persönlichkeitseigenschaften
- 3. Abschließende Diskussion – Vorteile und Nachteile beider Philosophien
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Glücksphilosophien der Stoa und des Epikureismus und konfrontiert diese mit Theorien der modernen Emotionspsychologie. Die Untersuchung zeichnet die unterschiedlichen Wege zum Glück und den angestrebten Glückszustand nach und prüft die psychologische Durchführbarkeit der jeweiligen Strategien.
- Vergleich der stoischen und epikureischen Glückskonzepte
- Analyse der Wege zum Glück in beiden Philosophien
- Bewertung der Rolle von Emotionen im Streben nach Eudaimonia
- Untersuchung der Abhängigkeit des Glücks von inneren und äußeren Faktoren
- Konfrontation der antiken Konzepte mit der modernen Emotionspsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den historischen Kontext der hellenistischen Ethiken, die im Zuge des Zerfalls der Polis und des Wandels im Götterglauben versuchten, einen Glücksbegriff zu definieren, der unter allen Umständen für jeden erreichbar erscheint. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit – einen Vergleich der stoischen und epikureischen Glücksphilosophien und deren Konfrontation mit der Emotionspsychologie – und skizziert den Aufbau.
1. Stoa und Epikureismus – antike Glücksstrategien: Dieses Kapitel stellt die beiden philosophischen Richtungen vor. Es beschreibt den stoischen Glücksbegriff als Apatheia, einen Zustand der Seelenruhe und Unerschütterlichkeit, der durch Tugend erreicht wird. Der Weg dorthin beinhaltet die Beherrschung von Emotionen und die Unabhängigkeit von äußeren Gütern. Im Gegensatz dazu wird der epikureische Glücksbegriff und der dazugehörige Weg, der auf Bedürfnisreduktion und das Vermeiden von Angst basiert, erläutert. Beide Ansätze werden detailliert und vergleichend dargestellt.
2. Die Stoa, Epikur und die moderne Emotionspsychologie: Dieses Kapitel analysiert die stoischen und epikureischen Ansätze im Lichte der modernen Emotionspsychologie. Es hinterfragt, ob der Eudaimonia-Begriff zu eingeschränkt ist und ob die Unterdrückung von Emotionen realistisch und wünschenswert ist. Weiterhin werden die Abhängigkeit des Glücks von äußeren Faktoren und die Rolle von Persönlichkeitseigenschaften im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Glück untersucht. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den antiken Konzepten aus heutiger Perspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Glücksphilosophien der Stoa und des Epikureismus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die antiken Glücksphilosophien der Stoa und des Epikureismus und setzt diese in Beziehung zur modernen Emotionspsychologie. Sie untersucht die jeweiligen Wege zum Glück, die angestrebten Glückszustände und die psychologische Umsetzbarkeit der Strategien. Der Vergleich umfasst die Glückskonzepte, die Wege dorthin, die Rolle von Emotionen und die Abhängigkeit des Glücks von inneren und äußeren Faktoren.
Welche philosophischen Richtungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Stoa und den Epikureismus, zwei bedeutende hellenistische philosophische Schulen, die sich mit der Frage nach dem Glück auseinandersetzten. Der Fokus liegt auf ihren unterschiedlichen Konzepten von Glück und den vorgeschlagenen Wegen, dieses zu erreichen.
Wie wird der Glücksbegriff in der Stoa definiert?
Die Stoa definiert Glück (Eudaimonia) als Apatheia, einen Zustand der Seelenruhe und Unerschütterlichkeit. Dieser Zustand wird durch Tugend erreicht, was die Beherrschung von Emotionen und die Unabhängigkeit von äußeren Gütern beinhaltet.
Wie wird der Glücksbegriff im Epikureismus definiert?
Der Epikureismus versteht Glück als die Vermeidung von Schmerz und die Kultivierung von Freude. Der Weg zum Glück besteht in der Reduktion von Bedürfnissen und der Vermeidung von Angst. Im Gegensatz zur Stoa liegt der Fokus weniger auf der Tugend, sondern auf dem hedonistischen Prinzip der Lustmaximierung und Schmerzminimierung.
Welche Rolle spielen Emotionen in beiden Philosophien?
In der Stoa werden Emotionen als Hindernisse auf dem Weg zum Glück angesehen und sollen durch Tugend und Selbstbeherrschung kontrolliert oder unterdrückt werden. Der Epikureismus hingegen betrachtet bestimmte Emotionen, wie z.B. Angst, als schädlich und zu vermeidend. Die Arbeit untersucht kritisch, ob die vollständige Unterdrückung von Emotionen realistisch und wünschenswert ist.
Wie wird die Abhängigkeit des Glücks von äußeren Faktoren betrachtet?
Sowohl die Stoa als auch der Epikureismus befassen sich mit der Frage, inwieweit Glück von äußeren Faktoren abhängig ist. Die Stoa betont die Unabhängigkeit von äußeren Gütern, während der Epikureismus eine gewisse Abhängigkeit anerkennt, aber durch Bedürfnisreduktion zu minimieren versucht. Die Arbeit analysiert diese Aspekte kritisch im Kontext der modernen Emotionspsychologie.
Wie werden die antiken Konzepte mit der modernen Emotionspsychologie in Beziehung gesetzt?
Die Arbeit konfrontiert die antiken Glückskonzepte der Stoa und des Epikureismus mit aktuellen Theorien der Emotionspsychologie. Sie hinterfragt die psychologische Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Strategien und analysiert die Gültigkeit der antiken Konzepte im Lichte moderner Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich der stoischen und epikureischen Glücksstrategien, ein Kapitel zur Konfrontation mit der modernen Emotionspsychologie, eine abschließende Diskussion und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der stoischen und epikureischen Glückskonzepte, die Analyse der Wege zum Glück, die Bewertung der Rolle von Emotionen, die Untersuchung der Abhängigkeit des Glücks von inneren und äußeren Faktoren und die Konfrontation der antiken Konzepte mit moderner Emotionspsychologie.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die Kernaussagen und die Argumentationslinien jedes Abschnitts kurz und prägnant zusammenfasst.
- Quote paper
- M.A. Marion Näser (Author), 2003, Eudaimonia in Stoa und Epikureismus. Glück für jedermann zu jeder Zeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30722