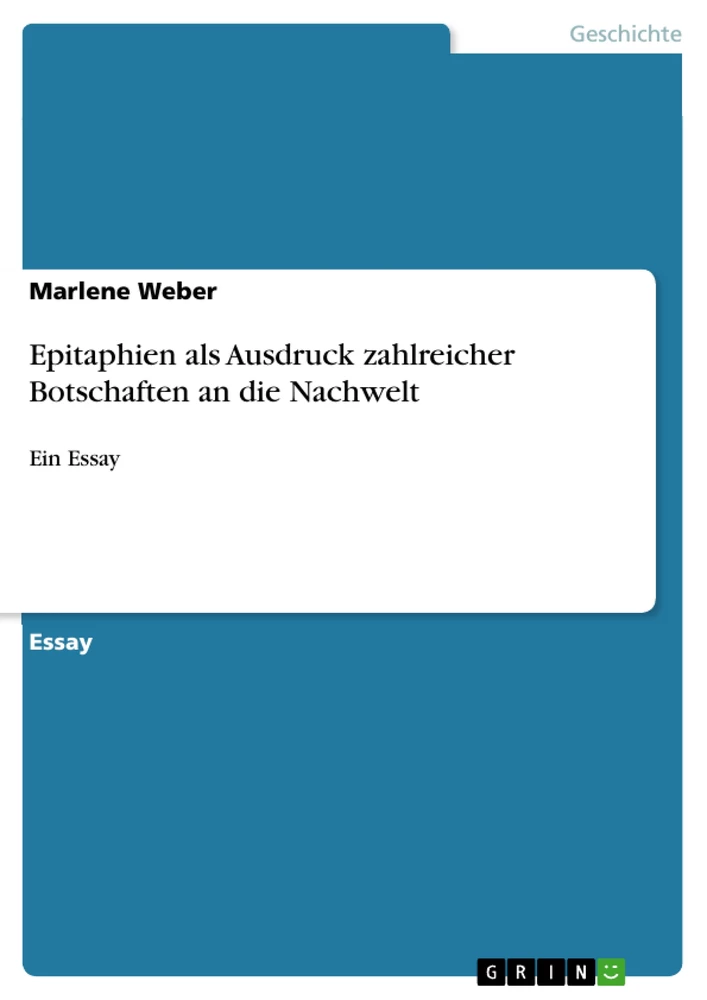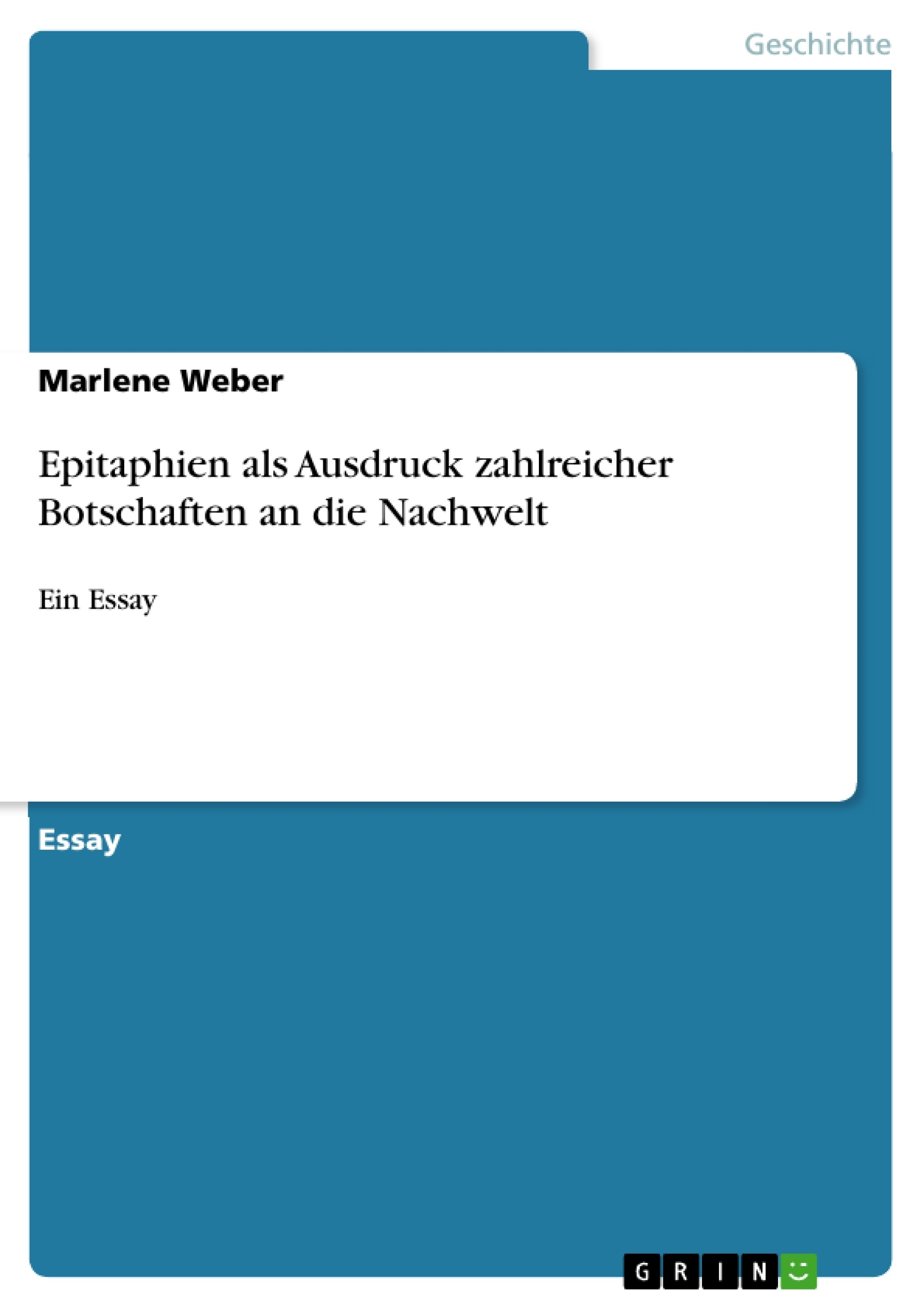Die vorliegende Arbeit soll einen kurzen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Epitaphs, das seinen Ursprung im 14. Jahrhundert hat, geben. Anschließend wird dessen formaler Aufbau genauer beleuchtet und detaillierter über Inhalt, Aufbau und Ikonographie berichtet. Ein weiteres nicht zu vernachlässigendes Thema in diesem Zusammenhang ist die Pfarrei als Ort bürgerlicher Repräsentation. Was kann ein Epitaph über den Auftraggeber an die Nachwelt berichten? Welche Botschaft sollte überbracht werden? Neben Repräsentation und Informationscharakter gab es jedoch noch die religiöse Komponente, auf die ebenfalls eingegangen wird. Abschließend werden die bis dato zusammengetragenen Ergebnisse an einem konkreten Beispiel genauer dargestellt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungsgeschichtlicher Überblick des Epitaphs
- Formaler Aufbau
- Repräsentation und Religion
- Erläuterung am Beispiel eines Epitaphs von St. Peter in München
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Epitaphien als Ausdruck von Botschaften an die Nachwelt. Sie verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte, den formalen Aufbau und die Bedeutung von Epitaphien im Kontext von Repräsentation und Religion zu geben. Ein konkretes Beispiel aus St. Peter in München dient der Veranschaulichung.
- Entwicklungsgeschichte des Epitaphs
- Formaler Aufbau und Ikonographie von Epitaphien
- Repräsentation und soziale Stellung des Verstorbenen
- Religiöse Aspekte und Symbolik
- Epitaphien als historische Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Epitaphien ein, indem sie anhand der Pfarrkirche St. Peter in München die vielfältigen Ausprägungen dieser Grabdenkmäler beschreibt. Sie umreißt die Ziele der Arbeit, die im Rahmen eines Seminars zum Pfarrarchiv entstanden ist, und benennt die zu behandelnden Themen: Entwicklungsgeschichte, formaler Aufbau, Repräsentation, Religion und eine abschließende Fallstudie an einem konkreten Beispiel.
Entwicklungsgeschichtlicher Überblick des Epitaphs: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Epitaphs, beginnend mit seinen Ursprüngen in der Spätgotik. Es beschreibt die Entwicklung von schlichten Grabplatten zu aufwändig gestalteten Denkmälern mit komplexen Bildprogrammen. Der Wandel von der lateinischen zur Volkssprache als Inschrift wird ebenso thematisiert wie die unterschiedlichen Gestaltungsformen in verschiedenen Epochen, vom Mittelalter bis in die Neuzeit, und die allmähliche Abgrenzung vom Grabmal als eigenständige Gattung. Das Kapitel veranschaulicht die Entwicklung mit Abbildungen mittelalterlicher Epitaphien.
Formaler Aufbau: Der formale Aufbau von Epitaphien wird detailliert analysiert. Das Kapitel beschreibt die verwendeten Materialien (Stein, Ton, Metall etc.), die Entwicklung der Textsprache (von Latein zu Volkssprache) und die typischen Inhalte wie Name des Verstorbenen, Todesdatum, sozialer Stand und Beruf. Die Bedeutung des Epitaphs als einzigartige und aussagekräftige historische Quelle wird hervorgehoben, im Gegensatz zu kopierbaren schriftlichen Quellen. Es wird auch auf die Verwendung von Wappen und Figuren des Verstorbenen eingegangen.
Schlüsselwörter
Epitaph, Grabdenkmal, Entwicklungsgeschichte, Formaler Aufbau, Repräsentation, Religion, Ikonographie, St. Peter München, Historische Quelle, Spätgotik, Renaissance, Barock.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Epitaphien in St. Peter München
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Epitaphien in der Pfarrkirche St. Peter in München. Sie analysiert die Entwicklungsgeschichte, den formalen Aufbau und die Bedeutung von Epitaphien im Kontext von Repräsentation und Religion. Ein konkretes Beispiel aus St. Peter in München dient der Veranschaulichung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklungsgeschichte des Epitaphs, seinen formalen Aufbau und seine Ikonographie, die Repräsentation und soziale Stellung des Verstorbenen, religiöse Aspekte und Symbolik, sowie Epitaphien als historische Quellen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Entwicklungsgeschichtlicher Überblick des Epitaphs, Formaler Aufbau, Repräsentation und Religion, Erläuterung am Beispiel eines Epitaphs von St. Peter in München und Schluss. Jedes Kapitel fasst einen Aspekt des Themas zusammen.
Welche Epochen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung von Epitaphien vom Mittelalter (Spätgotik) bis in die Neuzeit, beleuchtet die Veränderungen in Gestaltung und Textsprache (von Latein zur Volkssprache) über die Renaissance und den Barock.
Welche Aspekte des formalen Aufbaus werden analysiert?
Die Analyse des formalen Aufbaus umfasst die verwendeten Materialien (Stein, Ton, Metall etc.), die Entwicklung der Textsprache, die typischen Inhalte (Name, Todesdatum, sozialer Stand, Beruf), die Verwendung von Wappen und Figuren, sowie die Bedeutung des Epitaphs als einzigartige historische Quelle.
Welche Rolle spielen Repräsentation und Religion?
Die Arbeit untersucht, wie Epitaphien die Repräsentation und den sozialen Stand des Verstorbenen widerspiegelten und wie religiöse Aspekte und Symbolik in der Gestaltung und den Inschriften zum Ausdruck kamen.
Wie wird die Analyse veranschaulicht?
Ein konkretes Beispiel eines Epitaphs aus St. Peter in München dient der Veranschaulichung der theoretischen Ausführungen und der verschiedenen Aspekte der Epitaph-Forschung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Epitaph, Grabdenkmal, Entwicklungsgeschichte, Formaler Aufbau, Repräsentation, Religion, Ikonographie, St. Peter München, Historische Quelle, Spätgotik, Renaissance, Barock.
Wozu dient die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und erleichtert das Verständnis der Gesamtstruktur und der Argumentationslinie der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Marlene Weber (Author), 2015, Epitaphien als Ausdruck zahlreicher Botschaften an die Nachwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307148