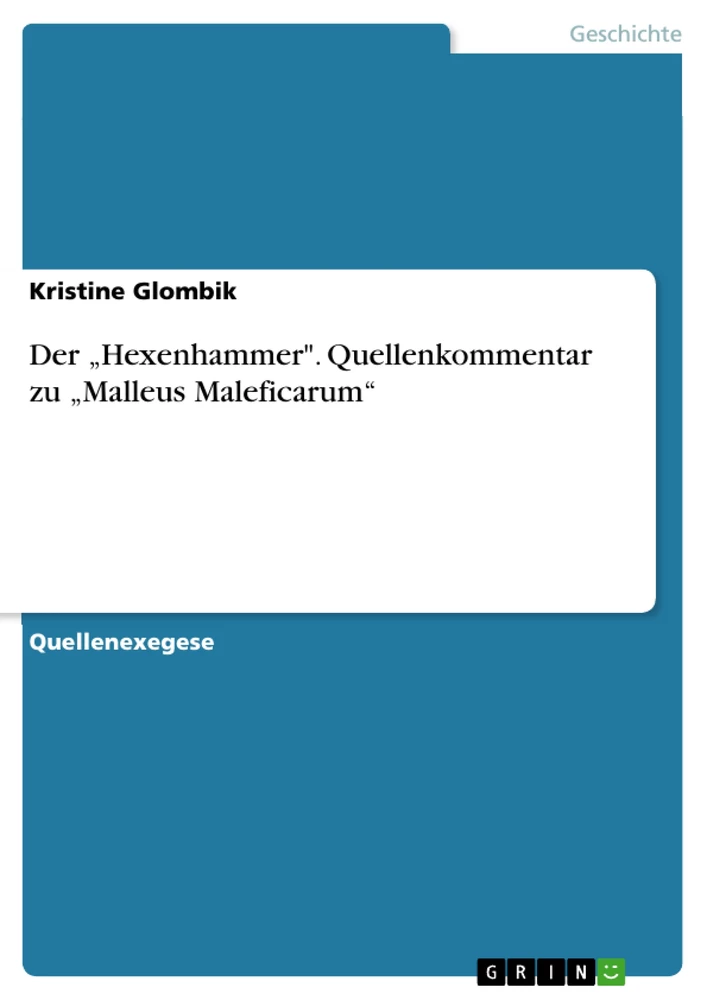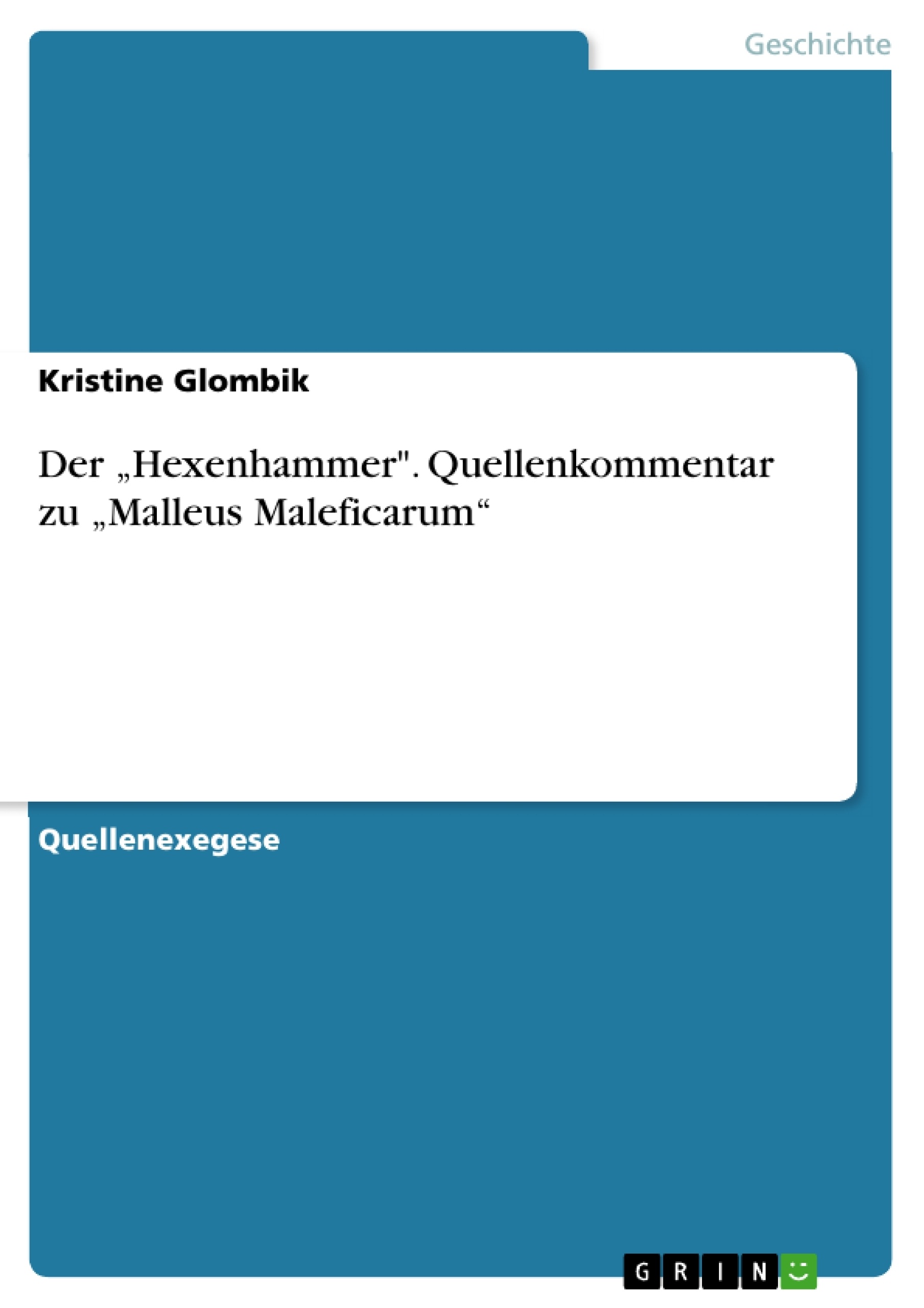Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Inhalt und Aufbau des „Hexenhammers“ von Heinrich Kramer und Jacob Sprenger. Sie bietet eine Darstellung des allgemeinen Bildes einer Hexe in der Frühen Neuzeit und bespricht, wie der Vorgang der Hexenverfolgung und der Hexenprozesse in Europa und speziell in Polen verlief. Im Fazit werden noch einmal die wichtigsten Fakten zu „Malleus Maleficarum“ und der Hexenverfolgung festgehalten.
Die Forschung ist, wenn es um das Thema der Hexenverfolgung in Polen geht, nicht so ausgereift wie die Forschung der deutschen Hexenverfolgung. Daher ist eine intensive Auseinandersetzung mit der polnischen Hexenverfolgung nur begrenzt möglich. Für die Arbeit wurde vorwiegend deutsche Literatur aus dem 20. Jahrhundert verwendet. Darüber hinaus wurde eine Übersetzung des Hexenhammers von J.W. Schmidt benutzt. Mit der digitalisierten Form des Hexenhammers und der Auskunft der Mitarbeiter der Herzog-August Bibliothek in Wolfenbüttel, war eine Auswertung der äußeren Form des Werkes möglich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Hexenhammer - Malleus Maleficarum
- 3. Das Hexenbild der Frühen Neuzeit
- 4. Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum) als zentrale Quelle zur Erforschung des Hexenglaubens und der Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit. Sie beleuchtet den Aufbau und Inhalt des Werkes, das allgemeine Hexenbild der damaligen Zeit und die Praxis der Hexenverfolgung, insbesondere in Polen. Die Arbeit beschränkt sich aufgrund des Forschungsstandes auf eine Analyse der verfügbaren deutschen Literatur und einer Übersetzung des „Hexenhammers“.
- Der Inhalt und Aufbau des „Hexenhammers“
- Das gesellschaftliche Hexenbild der Frühen Neuzeit
- Die Praxis der Hexenverfolgung in Europa und Polen
- Die Herausforderungen der Forschung zur polnischen Hexenverfolgung
- Die Quellenlage und Methodik der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Hexenglaube und Hexenverfolgung im Mittelalter und der Frühen Neuzeit ein. Sie beschreibt den wachsenden Glauben an Hexen und die Entstehung von Werken wie dem „Hexenhammer“, der im Mittelpunkt der Arbeit steht. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die methodischen Herausforderungen, die sich aus der eingeschränkten Forschung zur polnischen Hexenverfolgung ergeben. Die Arbeit stützt sich primär auf deutsche Literatur und eine Übersetzung des „Hexenhammers“. Die Erläuterung der verwendeten Quellen und deren methodische Relevanz unterstreicht die wissenschaftliche Sorgfalt.
2. Der Hexenhammer - Malleus Maleficarum: Dieses Kapitel analysiert den „Malleus Maleficarum“ (Hexenhammer) selbst, ein in Inkunabeldruck erstelltes Werk mit etwa 33 Auflagen. Es beleuchtet die Autoren Heinrich Kramer und Jacob Sprenger, ihre Hintergründe und Intentionen bei der Veröffentlichung des Buches. Der Fokus liegt auf der systematischen Verfestigung des Hexenglaubens und der Bereitstellung einer „praktikableren Grundlage“ für die Hexenverfolgung. Das Kapitel erwähnt die päpstliche Bulle „Summis desiderantes affectibus“ von 1484 und die inhaltlichen Parallelen zum „Directorium inquisitorium“ von Nikolaus Eymericus. Die physische Gestaltung des Buches (Größe, Einband, Papier, Tinte) wird ebenso beschrieben wie sein Aufbau in drei Teile mit Fragen zu Dämonen, Hexen und der göttlichen Zulassung. Beispiele der Fragestellungen werden erläutert, um den Inhalt und die Argumentationsstruktur zu verdeutlichen. Die Bedeutung des „Hexenhammers“ als Handbuch für kirchliche Richter und Schöffen bei der Verfolgung und Verurteilung von Hexen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Hexenhammer, Malleus Maleficarum, Hexenverfolgung, Frühe Neuzeit, Hexenglaube, Heinrich Kramer, Jacob Sprenger, Inkunabeldruck, Hexenprozesse, Polen, Inquisition, Dämonologie, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zum "Hexenhammer" - Malleus Maleficarum
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den "Hexenhammer" (Malleus Maleficarum) als zentrale Quelle für den Hexenglauben und die Hexenverfolgung der Frühen Neuzeit. Sie untersucht den Aufbau und Inhalt des Werkes, das damalige Hexenbild und die Praxis der Hexenverfolgung, insbesondere in Polen. Die Analyse basiert hauptsächlich auf deutscher Literatur und einer Übersetzung des "Hexenhammers".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Inhalt und Aufbau des "Hexenhammers", das gesellschaftliche Hexenbild der Frühen Neuzeit, die Praxis der Hexenverfolgung in Europa und Polen, die Herausforderungen der Forschung zur polnischen Hexenverfolgung und die Quellenlage und Methodik der Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Hexenhammer - Malleus Maleficarum, Das Hexenbild der Frühen Neuzeit, Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die methodischen Herausforderungen. Kapitel 2 analysiert den "Hexenhammer" selbst, seine Autoren und seinen Einfluss. Die folgenden Kapitel befassen sich mit dem Hexenbild und der Praxis der Hexenverfolgung.
Was wird im Kapitel über den "Hexenhammer" behandelt?
Das Kapitel über den "Hexenhammer" analysiert das Werk detailliert, einschließlich seiner Autoren (Heinrich Kramer und Jacob Sprenger), seiner Intentionen, seines Aufbaus in drei Teile und seiner Bedeutung als Handbuch für die Hexenverfolgung. Es beleuchtet die päpstliche Bulle "Summis desiderantes affectibus" und die inhaltlichen Parallelen zum "Directorium inquisitorium". Die physische Gestaltung des Buches und Beispiele seiner Fragestellungen werden ebenfalls erläutert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich primär auf deutsche Literatur und eine Übersetzung des "Hexenhammers". Die Einleitung erläutert die verwendeten Quellen und deren methodische Relevanz.
Welche Herausforderungen gab es bei der Forschung?
Eine Herausforderung der Forschung war die eingeschränkte Verfügbarkeit von Quellen zur polnischen Hexenverfolgung. Die Arbeit beschränkt sich daher auf die Analyse der verfügbaren deutschen Literatur und der Übersetzung des "Hexenhammers".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hexenhammer, Malleus Maleficarum, Hexenverfolgung, Frühe Neuzeit, Hexenglaube, Heinrich Kramer, Jacob Sprenger, Inkunabeldruck, Hexenprozesse, Polen, Inquisition, Dämonologie, Quellenkritik.
- Quote paper
- Kristine Glombik (Author), 2015, Der „Hexenhammer". Quellenkommentar zu „Malleus Maleficarum“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306904