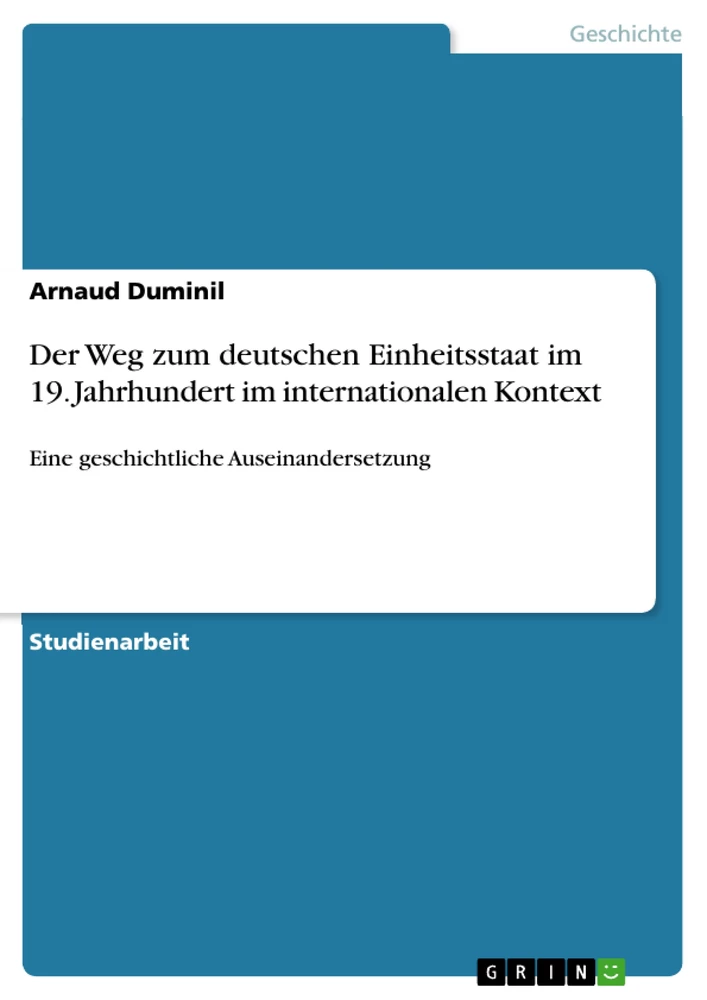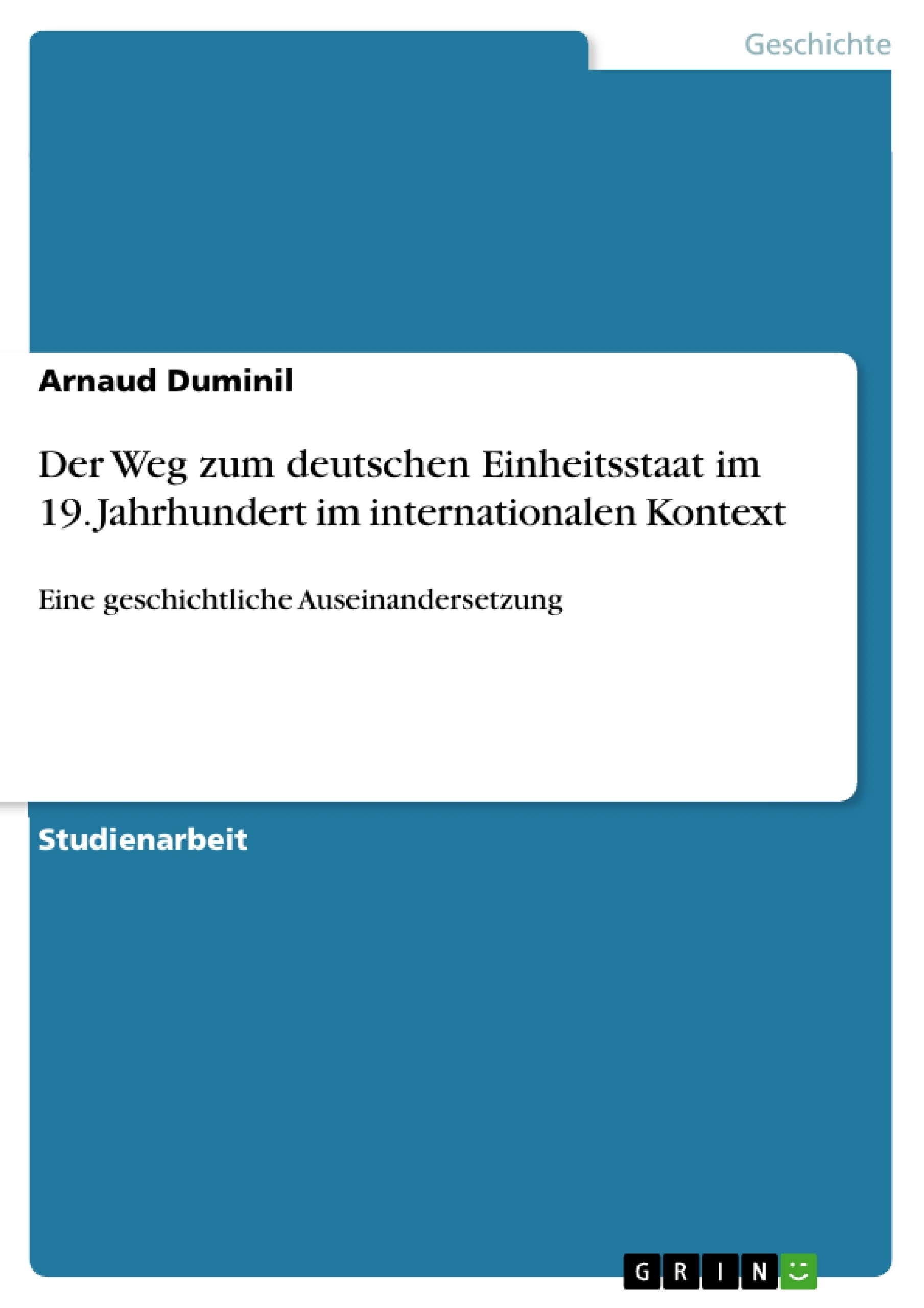Diese Arbeit behandelt die Frage, inwiefern die internationalen Verhältnisse im 19. Jahrhundert zur deutschen Einheit beigetragen haben. Im Mittelpunkt der Arbeit steht dabei der Akteur Otto von Bismarck, der entscheidend zur deutschen Einheit beitrug.
Zunächst wird auf die revolutionäre Periode 1815-1849 eingegangen, indem das Verhältnis deutscher Machthaber und deutscher Patrioten den Geschehnissen in Griechenland, Belgien und Frankreich gegenüber dermaßen analysiert werden, dass die Gründe, die zur Märzrevolution führen, in neues Licht betrachtet werden können. Der zweite Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Reaktion Preußens auf die Ereignisse in Italien und Polen, damit der Aufstieg Preußens sich derart erklären lässt, dass es von einem Machtvakuum in Mitteleuropa profitiert hat. Abschließend wird erörtert, ob sich Preußen nur durch Kriegshandlungen zur Weltmacht hat erheben können, oder ob ein einheitliches Deutschland von anderen auswärtigen Elementen „genehmigt“ wurde.
Dieser Text stammt von einem Autor, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Bitte haben Sie deshalb Verständnis für eventuelle Fehler und Inkonsistenzen im Ausdruck.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I/ 1815-1849: Der Weg zum „deutschen Nationalismus“
1/ Die griechischen Freiheitskämpfe
2/ Die Rheinkrise und die Märzrevolution in internationaler Sicht
II/ 1850-1866: Preußen kommt ans Tageslicht
1/ Das Ende des Wiener Systems
2/ Polen, 1863: Bismarcks russische Politik
III/ 1864-1871: Der Weg zur Einheit durch „Blut und Eisen“
1/ Die Auflösung des preußisch-österreichischen Dualismus‘
2/ Die Einheit nur durch Krieg?
Schluss
Literaturverzeichnis
Anhänge
Einleitung
„ Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. “[1]
Dies schrieb Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), als er als Schlachtenbummler die Schlacht von Valmy auf einer Höhe beobachtete, eine Schlacht zwischen französischen revolutionären Republikanern und westeuropaweit konföderierten Monarchisten. Dass der Deutsche Goethe einer der ersten Schlachten der Koalitionskriege dermaßen rühmt, erklärte der Historiker Joseph Rovan (1918-2004) folglich: die französischen Revolution sei als eines der Hauptereignisse der deutschen Geschichte zu betrachten[2]. Der Historiker François-Georges Dreyfus (1928-2011) war sogar folgender Meinung: „ La France devient le principal agent de l’unité allemande, à la fois par son influence juridico-administrative et par le sentiment national qu’elle contribue à éveiller et fortifier.“[3] Der Einfluss Frankreichs auf die Einheitsbewegungen in Deutschland ist also nicht zu übersehen, auch Napoleon selber gelingt es, die alte, ständische Ordnung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zu vertilgen, und die „Freiheit“ auf deutschen Boden durchzusetzen. Jedoch räumt der Historiker Jean-Claude Caron ein: „ si le mot liberté apparaît, il doit être compris dans un sens de libération et non dans un sens de libéralisation. “[4] Von einer Liberalisierung Deutschlands wollen auch die Machthaber 1815 beim Wiener Kongress nichts wissen, es heißt hingegen, wie es der Historiker Pierre Ayçoberry (1925-2012) gut zum Ausdruck brachte: „ féconder la liberté à la française par la morale germanique.“ Oder eher die Freiheit so zu zügeln, dass es zur „Restauration“ der Ständegesellschaft kommt, wie sie noch zehn Jahre zuvor existierte. Clemens von Metternich (1773-1859) übrigens, der Leiter des tanzenden Kongresses, betrachtete die Idee der Emanzipation der Völker als völlig absurd.[5] Immerhin bedeutet der Kongress für ihn die Wiederherstellung der AEIOU[6] -Macht in Europa. Für Preußen, die zweite deutsche Großmacht des Festlandes, auch bringt der Kongress viel: Friedrich-Wilhelm III., der „Biedermann auf dem Thron“, erhält für seine Dienstleistung das Rheinland und Westfalen, sodass Preußen übergehend das ehemalige Reichsgebiet dominiert, wobei es entzweit ist (Cf. Anhang 1). Der Deutsche Bund wird gegründet, und hiermit wird eine deutsche Entität in Mitteleuropa per Vertrag völkerrechtlich anerkannt: Also eine Legitimierung nach außen hin, nicht nach innen hin. Würde dieses zerstückelte Deutschland, das an die Vielstaaterei des Reichs erinnert, nur als Pufferzone für die anderen Mächte Europas dienen? Wie dem auch sei, die „deutsche Frage“ wird in Wien nicht gelöst, was für das Schicksal des ganzen 19. Jahrhunderts entscheidend ist.
Durch die Französische Revolution wird auf deutschem Gebiet viel über eine „deutsche Nation“ diskutiert[7], gestrebt wird nach der Entstehung eines einheitlichen Deutschlands, aber die Frage besteht dabei darin, wie und auf wessen Kosten sie entstehen könnte. Das Zwischenreich, also Deutschland von der Abdankung Napoleons I. bis zu der Napoleons III., ist, so Wolfram Siemann, „ eine Gesellschaft im Aufbruch “[8], bei der immerhin das Nationale, das Revolutionäre, das Deutsche von städtischen Bürgern getragen werden, die Bauern und die Arbeiter, das „Volk“ sozusagen, bleibt davon weitgehend ausgeschlossen. Hier geht es um einen Kampf zwischen (ruinierten) Adligen und reichen Wirtschaftsbürgern, Bildungsbürgern, für die folgender Spruch des italienischen Freiheitskämpfers Giuseppe Mazzini (1805-1872) gilt: Er sagte, dass die Heimat hauptsächlich das Bewusstsein der Heimat sei.[9] Immerhin geht es hier um „Kampf“, jedoch wird der Kampf für die Einheit Deutschlands Züge erhalten, die ihn eher als „Vorwand“ erscheinen ließe. Eigentlich wird die „Einheit“ dank des preußischen Premiers Otto von Bismarck (1815-1898) anhand von einem politischen Zwischenfall vollendet, der eben die nationalen Gefühle in andere verwandle, die darauf beruhen, nicht mehr zusammen zu sein, sondern zusammen gegen einen Anderen zu sein, und hier ausgerechnet gegen die Franzosen, die sog. „Erbfeinde“. Bismarck, als Sohn des Wiener Kongresses, gelingt es, den Deutschen eine Nation überzureichen, indem er Kriege führt. Jedoch weist die junge Historikerin Stéphanie Burgaud[10] darauf hin, dass sich durch den seit kurzem ermöglichten Zugang zu preußischen und sowjetischen Archiven ein neues Bild des deutschen Weges zur Einheit offenbart: Die vollendete Einheit Deutschlands durch Gewalt könnte nun nicht mehr als der sog. „Sonderweg“ betrachtet werden, ein Weg voller Hass, der zum Nationalsozialismus führe, die europäischen politischen Geschehnisse hätten Bismarck vielmehr dazu gezwungen, die Einheit Deutschlands durch Preußen eben nach außen hin zu vollbringen.
Es schickt sich also zu fragen, inwiefern die internationalen Verhältnisse zur deutschen Einheit beigetragen haben, jedoch vor allem im Hinblick auf das Entscheidendste: Bismarck.
Zunächst wird auf die revolutionäre Periode 1815-1849 eingegangen, indem das Verhältnis deutscher Machthaber und deutscher Patrioten den Geschehnissen in Griechenland, Belgien und Frankreich gegenüber dermaßen analysiert werden, dass die Gründe, die zur Märzrevolution führen, in neues Licht betrachtet werden können. Der zweite Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Reaktion Preußens auf die Ereignisse in Italien und Polen, damit der Aufstieg Preußens sich derart erklären lässt, dass es von einem Machtvakuum in Mitteleuropa profitiert hat. Abschließend wird erörtert, ob sich Preußen nur durch Kriegshandlungen zur Weltmacht habe erhoben können, oder ob ein einheitliches Deutschland von anderen auswärtigen Elementen „genehmigt“ wurde.
I/ 1815-1849: Der Weg zum „deutschen Nationalismus“
1/ Die griechischen Freiheitskämpfe
Auf dem Hambacher Fest, dem „nationalistischen“ Fest der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Überwachungsstaat des Karlsbader-Metternich‘schen Systems[11], hält Philipp Jakob Siebenpfeiffer, einer der Mitveranstalter, folgende Rede:
„Selbst der leise Wunsch, nur erst wieder ein Vaterland, eine freimenschliche Heimat zu erstreben, ist Verbrechen. Wir helfen Griechenland befreien vom türkischen Joche, […] aber knechtisch beugen wir den Nacken unter das Joch der eigenen Dränger.“ [12]
Der nationale Revolutionär lehnt sich in dieser Rede gegen die landsmännischen Fürsten auf, indem er im Hinblick auf den europäischen Zeitgeist erzürnt, dass eben die Deutschen diesem Zeitgeist nicht folgen, der in folgendem besteht: „nationale Freiheit“ à la française. Die „Grande Nation“ gilt nicht nur bei den Deutschen als mögliches Musterbild, sondern in ganzem Europa, dessen Völker sich nicht (nur) gegen freiheitsfeindliche Herrscher, sondern gegen Völker zerspaltende Fremdherrscher erheben. Des türkischen Sultans können die Griechen nicht mehr ertragen, nicht nur weil er als Despot regiert, sondern weil die Griechen sich unabhängig von ihm machen wollen, und dies auch so frei und liberal wie möglich. Dennoch gilt in Europa die „Dreifaltigkeit“ der christlichen Pentarchie: Restauration und Beibehalten des ständischen fürsterlichen Staates, Legitimierung der machthabenden Dynastien durch gottgegebene Herrschaft, Solidarität zwischen jenen Dynastien zwecks der Bewahrung eines gottgewollten Friedens[13]. Das Frankreich vom Bourboner Ludwig XVIII. (1815-1824) hat am Wiener System dank der Hingabe Talleyrands (1754-1838) Anteil und erfüllt tüchtig seine Pflicht, indem 1822 die Truppen von Louis-Antoine de Bourbon die spanische Revolution auf der Insel Trocadero endgültig niederschlagen, was in der Tat von der Heiligen Allianz gemäß des Tropauer Protokolls von 1820[14] beauftragt wurde. Es war das erste Mal, dass das Legitimitätsprinzip zu Kampfhandlungen gegen Revolutionäre führte, was der große Romantiker Chateaubriand (1768-1848)[15] so beschrieb: „ La légitimité allait pour la première fois brûler de la poudre sous le drapeau blanc. “ Derselbe wird 1821 mit einem anderen romantischen Schriftsteller George Gordon Byron (1788-1824) das „Comité philhellénique de Paris“ gründen[16]. Die Romantiker, die Zeitschriftsteller, die ganze national-romantische Welt begeistert sich in der Tat für Griechenland, das sich in Aufruhr befindet. Nachdem 1821 in Konstantinopel der orthodoxe Patriarch aufgehängt wird, kommt es auf dem Land der „ edlen Einfalt und stillen Größe “, wie der frühe Philhellenist Winckelmann es doch so schön schrieb, zur „ Epanastasis “, zum Aufstand des griechischen Volkes gegen die Osmanen, die nicht zögern, ihn blutig zu bekämpfen: Auf Chios, einem Insel nah an der ionischen Küste kommt es zur Erschlagung von 22.000 Griechen, Aufständischen, Frauen, Kinder, allen. Dieses Genozid entflammt die europäische Öffentlichkeit, Delacroix (1798-1863) malt dieses berüchtigte Ereignis zur Schau der Pariser Bürger, die auf den König Karl X. (1824-1830) drücken, damit diese grauenhafte Tat gerächt wird. Der Kaiser Nikolaus I. (1825-1855) erklärt den Osmanen ein Ultimatum, das nicht respektiert wird: Es kommt zum Krieg. Der Czar versteht sich als Verteidiger aller orthodoxen Christen, die die Mehrheit in Griechenland bilden. Jedoch mischen sich England und Frankreich ein, und bei Navarino, dem heutigen Pylos in Messenien, wird am 20. Oktober 1827 die osmanische Flotte völlig ausgelöscht. Man könnte sagen, dass hier die Autorität, sogar die Legitimität des russischen Herrschers in Frage gestellt wird, was jedoch England und Frankreich ihn noch erst einräumen werden, nachdem im Londoner Vertrag von 1827 England die Herrschaft über die ionischen Inseln gewährt wird, und Frankreich seinen politischen Platz als Schützer der Völker und sein auswärtiges Prestige wiedererhalten wird. Als König erhalten durch den Vertrag von Byzanz die Griechen einen Bayer, Otto von Wittelsbach (1832-1862), ausgerechnet einen deutschen Philhellenisten. Jean-Claude Caron sieht darin den Beweis für die Nichtexistenz Deutschlands als politischer Macht.[17] Tatsächlich wird Otto gewählt, nicht weil er Deutscher ist, sondern weil er den deutschen Philhellenisten nahe steht, und viele junge deutsche Studenten sich in Griechenland schon befinden und wirtschaftlich[18], daher politisch sehr aktiv sind, nachdem sie vor der Repression der Karlsbader Beschlüsse geflohen sind. Der Altphilologe Michel Espagne ist übrigens folgender Ansicht:
„Le philhellénisme [est] conçu en Allemagne comme une « obsession culturelle », est construit sur un échange dont on rappellera qu’il est peut-être l’une des premières « idées européennes » à travers la proposition d’un véritable « dénominateur commun.“[19]
Der Philhellenismus ist als europäische Bewegung zu betrachten, d.h., genau wie im Fall von Byron und Chateaubriand, er bildet wie die Romantik ein europäisch-gemeinsames Streben nach griechischem Idealem. Unter den Philhellenisten sind Chateaubriand, Benjamin Constant, Delacroix, Ingres zu finden oder noch der Philologe Charles Fauriel (1772-1844), der sich mit den vom völkischen Gelehrten Adamantois Korais (1748-1833) „ Chants populaires de la Grèce moderne “ beschäftigt. Diese Lieder werden veröffentlicht ganz im Sinn eines völkischen Griechenlands, wie es Friedrich August Wolf (1759-1824) in seinem Prolegomena ad Homerum von 1795 verstanden hatte: Lieder aus der Stimme des puren Volkes. Hiermit entsteht ein nicht übersehbarer deutsch-französischer gemeinsamer Kampf zur ideologischen „Wiederherstellung“ Griechenlands, wie 1834 es der bayrische Politiker Georg Ludwig von Maurer (1790-1892) in Das griechische Volk schreibt: „ Ebenso sollen jetzt Europäer, und Deutsche insbesondere, wieder das längst erloschene Licht in die Heimat des Lichtes zurückbringen.“[20]
Der Philhellenismus dient nicht zuletzt als Boden für die Freiheitsbewegung in Deutschland, wie Michel Espagne darauf hinweist: „ sans doute la coloration politique des associations philhellènes et leur cosmopolitisme sont-ils favorisés par l’appartenance de leur membre à la bourgeoisie cultivée à l’exemple du poète Ludwig Uhland dans le Wurtemberg. “[21] Immerhin bleibt unter diesen Gelehrten der Bayer Friedrich Thiersch (1784-1860) der entschlossenste Philhellenist. Aus seinem Antrieb entsteht bei Regensburg das neugriechische Wahlhalla des Architekts Leo von Klenze, es werden sogar die Pläne für eine bayrisch-griechische Armee entworfen. Übrigens ist er der erste, der eine europaweite Studie über das Bildungssystem erarbeitet. Für Thiersch kann es dadurch verbessert werden, dass die Fackel Griechenland wieder angezündet wird. Er vertritt die Auffassung, dass Europa dank Griechenlands Europa geworden ist, d.h. das weltweite Symbol der Freiheit, der Bildung und der Aufklärung. 1821 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung (AAZ) entwirft er die Theorie des „ ewig [en] Gesetz [es] der Wiedervergeltung “[22]. Nach Thiersch könnten sich die Herrschaften Europas nur dadurch legitimieren, dass sie sich als Erbe Griechenlands erklären, indem sie eben Griechenland gegen den „Erbfeind“ (die nicht christlichen Osmanen) verteidigen. Solchen Betrachtungen zufolge könnte Griechenland in die Heilige Allianz aufgehoben werden als, so Thiersch in der AAZ, „ eine Hauptstütze der europäischen Freiheit und Beschirmen der Christenheit des Orients.“[23]
Immerhin bin ich der Meinung, dass England und Frankreich Griechenland geholfen haben, damit sie nicht die osmanische Machtstellung in Osteuropa schwächen, das osmanische Reich war schon in Verfall, sondern die russische, also es ginge hier um eine Art „ containing Russia “. Hier ist interessant auf den Diplomaten Alexis de Tocqueville (1805-1859) zurückzugreifen, der 1851 in seinen Souvenirs schrieb:
„C'est une ancienne tradition de notre diplomatie qu'il faut tendre à ce que l'Allemagne reste divisée entre un grand nombre de puissances indépendantes ; et cela était évident, en effet, quand derrière l'Allemagne ne se trouvaient encore que la Pologne et une Russie à moitié barbare ; mais en est-il de même de nos jours ? La réponse qu'on fera à cette question dépend de la réponse qu'on fera à cette autre : quel est au vrai, de nos jours, le péril que fait courir la Russie à l'indépendance de l'Europe ? Quant à moi, qui pense que notre occident est menacé de tomber tôt ou tard sous le joug ou du moins sous l'influence directe et irrésistible des tsars, je juge que notre premier intérêt est de favoriser l'union de toutes les races germaniques, afin de l'opposer à ceux-ci. L'état du monde est nouveau ; il nous faut changer nos vieilles maximes et ne pas craindre de fortifier nos voisins pour qu'ils soient en état de repousser un jour avec nous l'ennemi commun.“[24]
Also die große Idee der Diplomatie bestünde darin, die Deutschen gegen die Slawen zu benutzen. Der Historiker Benoît Pellistrandi aber weist auf interessante Zahlen hin: „ En 1865, l’armée de l’Empire d’Autriche compte pour près de 500000 hommes : 130000 Allemands soit 26%, 96.000 Tchéco-slovaques (19%), 52000 Italiens (10.5%) 37000 Polonais (7%) 32000 Hongrois (6.5%). “[25] Dies bedeutet, dass der Rest der österreichischen Armee, also 30% aus Slawen oder anderen besteht.
Jedoch was für die Gelehrten und Literaten die Rettung „Hellas“ ist, ist in der Tat nur ein „ mirage grec “[26]. Auf den österreichischen Orientalisten Jakob Fallmerayer stützt sich Benoît Pellistrandi im Folgenden: „ La Grèce totalement métissée n’était qu’un ramassis d’Albanais, de Valaques et de Slaves […] Les vrais Grecs seront les phililogues allemands ayant fait souche en Grèce. “[27]
2/ Die Rheinkrise und die Märzrevolution in internationaler Sicht
Anfangs 1830 ist also dem Deutschen Bund gegenüber Frankreich zur Weltmacht wieder geworden, Prestige hat es in Spanien, Griechenland und Nordafrika gewonnen, aber im Juli bricht eine neue Revolution aus, die Europa wiederum erschüttert. Während Louis-Philippe d’Orléans (1778-1850), ein direkter Nachfahre des Sonnenkönigs, zum „König der Franzosen“ gewählt wird, spaltet sich das katholische Belgien vom protestantischen Königreich Niederlanden ab: Die Geburt einer neuen Nation ganz mitten Europa sorgt für Sensation, zumal das Neuankömmling sich einen Herrscher sucht. Der Franzosenkönig versucht dabei, seinen Sohn, den Herzog von Nemours durchzusetzen, was aber ihm die Engländer aus Angst vor einer französischen, seehandelnden Herrschaft auf die flämischen Hafen verweigern. Gleichzeitig werden 60.000 preußische Soldaten am deutschen Rheinufer stationiert, auch Preußen fürchtet sich einer Machtexpansion des Königreiches Frankreich: Napoleons Schreckherrschaft ist eigentlich nur vor 15 Jahren her. Am 20. Dezember 1830 erklärt im Londoner Protokoll Belgien seine Neutralität, aber der niederländische König Wilhelm I. (1815-1840) will es zurückerobern, worauf Louis-Philippe seine Truppen einsetzt, um es zu verteidigen (und anschließend vorteilhafte Handelsvorträge zu gewinnen). Nach diesem kurzen Krieg besteigt Leopold von Sachsen-Coburg, ausgerechnet ein Preuße, den belgischen Thron unter Bewahrung von Louis-Phillipe. Hier könnte der Heiligen Allianz vorgeworfen werden, dass sie Wilhelm I. rücksichtslos aufgegeben hat, im totalen Widerspruch zu den Verträgen. Dies könnte eine Abschwächung der Verbindung zwischen den Herrschern der Pentarchie zeigen.
Wie dem auch sei, blühen in Europa die nationalen Bewegungen. Der Partikularismus ist stark prägend, vor allem in Ungarn, wo 1830 die magyarische Sprache statt des Lateins zu Amtssprache erhoben wird, die Ungarn versuchen sich der Habsburger Krone gegenüber auf regionale Ebene zu emanzipieren. Im deutschen Bund aber übernimmt die nationale Bewegung internationale Farben, vor allem als es zur Rheinkrise kommt, als die Franzosen eine vorgeblich „von Natur her“ selbstverständliche Herrschaft über das deutschgewordene linke Rheinufer beanspruchen: Hier könnte behauptet werden, die deutschnationalen Gefühle entstehen bloß aus Hass auf Franzosen, nur der könnte die regionalzerspalteten Deutschen sozusagen, wobei nur für eine Weile, vereint haben. Immerhin wird dabei der Rhein zu einem deutschen Kulturgut, zum Symbol einer „Erbfeindschaft“, wie sie seit der Entstehung und rascher Verbreitung des Lieds von Ernst Moritz Arndt (1769-1860) „ Was ist des Deutschen Vaterland ?“ verstanden wird. Immerhin bleibt Frankreich noch das Musterbild der Revolution während der Ereignisse von 1848 und 1849. In einem Parlament à la française, mit Sitz in einer deutschen Kirche, der Frankfurter Paulskirche, wird über die „deutsche Frage“ heftig debattiert. Im Vorparlament, wo der Geist des völkerfreundlichen Vormärzens herrscht, wird das „Bundesgebiet“ noch klar definiert:
„Schleswig, staatlich und national mit Holstein unzertrennlich verbunden, ist unverzüglich in den deutschen Bund aufzunehmen und in der constituierenden Versammlung [la Constituante also] gleich jedem andern deutschen Bundesstaate durch freigewählte Abgeordnete zu vertreten.
Ost- und Westpreußen ist auf gleiche Weise in den deutschen Bund aufzunehmen.
Die Versammlung erklärt die Theilung Polens für ein schmachvolles Unrecht. Sie erkennt die heilige Pflicht des deutschen Volkes, zur Wiederherstellung Polens mitzuwirken. Sie spricht dabei den Wunsch aus, daß die deutschen Regierungen den in ihr Vaterland rückkehrenden Polen freien Durchzug ohne Waffen und, so weit es nöthig, Unterstützung gewähren mögen.“[28]
Schleswig soll von Dänemark abgenommen, die preußische Stelle im Bund gestärkt und Polen die Einheit gewährt werden. Dies bedeutet also, dass die Völker Mitteleuropas streng staatlich getrennt werden müssten, damit Frieden zwischen jenen Völkern entstehen kann, demgemäß, im Vergleich mit der deutschchristlichen Glaubensspaltung, sollte sozusagen die Regel „ cuius regio, eius natio “ gelten. Dennoch wäre eine solche Lösung für die Hohenzoller nicht zu ertragen, und auch nicht für die Habsburger. Denn die deutsche Frage besteht in nichts anderem als folgendem, wie es der Abgeordnete der Frankfurter Versammlung Robert Blum (1848 hingerichtet) zum Ausdruck brachte: „ Man muss sich entschieden, ob Preußen sich in Deutschland auflöst, oder ob Deutschland Preußen wird.“[29] Wer entscheidet aber, ist nicht die Versammlung, sondern eben Preußen, dessen König die Bundkrone mit aussortierten Worten ablehnt.[30] Otto Dann beteuert diesbezüglich zu Recht: „Wenn damals der preußische König mitgemacht hätte, wäre der deutsche Nationalstaat gemäß der Reichsverfassung von 1849 schon längst verwirklicht! “[31] Im ganzen Bund erheben sich die Revolutionärer, der Versammlung zum Trotz: In Baden rufen der ehemalige Adlige Gustav Struve und der nachmalige Yankee-Offizier Friedrich Hecker die Republik aus, in Köln sorgen Marx und Engels für revolutionäre Stimmung, in Dresden gehen der Panslawist Bakunin und der „Germanist“ Wagner auf die Barrikaden, in Berlin auch kommt es zu Barrikadenkämpfen, teils unter der Leitung der Gründer der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbrüderung, dem jüdischen Sozialisten Simon Buttermilch / Stefan Born. Alle Revolutionäre, ob Nationalisten, Liberalen, Fürkämpfer der proletarischen Sache, Juden oder russische Anarchisten werden von einer einzigen Armee geschlagen: das preußische Heer, teils aus Eigeninitiative, teils im Auftrag des Bundes. Pierre Ayçoberry war dazu folgender Ansicht: „ Par un tragique renversement, l’unité allemande se réalise dans la répression et c’est l’armée prussienne qui s’en fait l’instrument. “[32] Aber Österreich auch hat zur Niederschlagung der Märzrevolution beigetragen, in Zusammenarbeit mit den Russen.
Die Bearbeitung der „deutschen Frage“ im Parlament macht in Mitteleuropa Schule: Wenn es in Deutschland zur Einigung aller Deutschen kommen könnte, dann, so denken die nichtdeutschen Nationalisten, könnten auch die anderen Völker „frei“ sein. Dementsprechend kommt es im Vielvölkerstaat zu Völkerspaltungen, d.h. die Ungarn, die Slawen, die Italiener erheben den Anspruch, selbstständig zu werden. In Prag wird in einem panslawischen Kongress die Unabhängigkeit von Böhmen und Mähren ausgerufen, Metternich flieht nach Paris, der „unsterbliche“, frisch gekrönte Kaiser Franz Josef (1848-1916) ins Schloss Schönbrunn, von dem aus er die „Gegenrevolution“ steuert. Der deutschböhmische (es soll später „sudetisch“ heißen) General und Fürst Alfred zu Windisch-Grätz bezwingt die Prager, Josef Radetzky von Radetz, auch ein Deutschböhme, überlegt den Italienern bei Custozza, der kroatische Feldmarschall Joseph Jellachich erobert das aufständische Wien zurück: Es sind also Adligen, die sich ihre Machtposition durch die Armee versichern. Die Regierung von Felix zu Schwarzenberg ruft den josefischen Autokratismus und die Verdeutschung der Monarchie aus, indem Franz Josef als „Erster Fürst der Deutschen“ proklamiert wird. Der Vielvölkerstaat immerhin „regionalisiert“ sich, d.h. auf die Minderheiten wird der Verdeutschungsbewegung zum Trotz mehr geachtet als zuvor. Im April 1849 bricht die magyarische Revolution von Lajos Kossuth zusammen, mithilfe von den Russen. Benoît Bellistrandi vertritt dazu folgende Stellungnahme:
„Aussi la victoire contre les indépendantistes hongrois a-t-elle une triple signification : elle marque le salut de l’Empire d’Autriche qui n’a pas été emporté dans la tourmente nationaliste et elle ouvre la voie au rétablissement du centralisme ; enfin elle a fait du tsar [Nikolaus I.] un arbitre en Europe centrale […] L’équilibre européen continue de se penser en termes de masses et, à cet égard, la prépondérance autrichienne en Europe centrale demeure une nécessité face à la réelle menace d’une expansion russe.“ [33]
Gebraucht wird Österreich auf internationale Ebene, um eine gefährliche Ausdehnung Russlands zu verhindern: Denn wenn die Slawen sich vom österreichischen Reich abschieben, dann könnten die russischen Slawen einfacher Zugang zum Mitteleuropa haben, was das mitteleuropäische Gleichgewicht in Gefahr bringen würde, zumindest nach dem Blickwinkel der Westeuropäer. Die Revolution ist europaweit gescheitert, in Frankreich gelingt Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) durch einen Staatsstreich das Kaisertum wiederherzustellen, auf deutschem Gebiet können die Fürsten ihre Machtstelle sichern, der Aufstand der Völker Europas ist getilgt. Jedoch zieht Otto Dann folgenden Fazit: „ die regionale Differenzierung ging in dieser Revolution soweit, daß sich Österreich mit einem eigenen Landespatriotismus absonderte. “[34] Durch die Revolution verwandelt sich demzufolge die „deutsche Frage“ in die „deutsch-deutsche Frage“, d.h. die Frage, ob von nun an, Preußen oder Österreich gelingen wird, über alle Deutschen zu herrschen.
Nach der Revolution versucht der preußische Diplomat Joseph von Radowitz die Lage auszunützen, und bildet einen sog. Engeren Bund, der aus Preußen, Hannover und Sachsen besteht. Dies wird aber von den Habsburgern nicht gebilligt, und die Preußen werden am 29. November 1850 in Olmütz, im Herzen Mährens gedemütigt[35]: Gezwungen werden sie anzunehmen, dass sie sich nicht aus Eigennutz in die Angelegenheiten der mitteldeutschen Staate (hier Kurhessen) einmischen, also dass der Deutsche Bund unter österreichischer Vorherrschaft wiederhergestellt wird, eine Art Bundrestauration also. Aber die Preußen können sich damit leicht abfinden: Der deutsche Zollverein wird nicht erweitert und Wien bleibt aus dem deutschen Binnenmarkt ausgeschlossen. Schon 1833 warnte Metternich vor der Bildung eines solchen, für Preußen vorteilhaften Handelsbundes: „ Eine Reihe bisher unabhängiger Staaten verpflichtet sich gegen einen übermächtigen Nachbar in einem überaus wichtigen Zweige der öffentlichen Bestellung, seinen Gesetzen zu folgen, sich seiner Administration- und Control-Maßregeln zu unterwerfen.“[36] Eine Art kleiner Nebenbund also bildet der Zollverein, der als Folge der gelungenen europäischen Wirtschaftsrevolution zu betrachten ist. Mit dem Zollverein entsteht nicht nur ein neuer Handelsraum mitten Europas, sondern ein deutscher einheitlicher Raum, was Pellistrandi zu Recht so kommentiert:
„Les traités de commerce constituent le socle des relations entre Etats en temps de paix. Or, malgré les apparences et si l’on excepte l’épisode napoléonien, le XIXème siècle est plutôt un temps de paix. Les conflits en Europe sont, après 1815, restés toujours localisés et les affrontements des pays occidentaux avec d’autres continents ne mobiliseront jamais des masses énormes de population.“[37]
Und dabei eifern die Deutschen abermals immer den gleichen nach: den Franzosen, die bereits 1790 die wirtschaftliche Einheit Frankreichs geschaffen hatten, aber Frankreich war schon ein einheitlicher Nationalstaat. So funktioniert aber auf deutschem Boden nicht: Das Wirtschaftliche geht dem Politischen vor. Deutschland, unter Führung Preußens wird infolgedessen nach der Märzrevolution zu wirtschaftlicher Großmacht: Ihr Universitätswesen genießt großes Ansehen, vor allem im Bereich der Technik und der Chemie; Justus von Liebig wird 1845 in den Stand eines Freiherrn erhoben, die heutigen Großkonzern Bayer und BASF werden 1863 und 1865 gegründet, auch die wirtschaftlichen Beziehungen mit Amerikas durch die Auswanderung vieler Deutschen aus armseligen Verhältnissen erfahren einen erheblichen Aufschwung. Die Bevölkerungszahl explodiert, vor allem in den Städten wegen der Landflucht: In Berlin verdreifacht sie sich innerhalb kurzer Zeit. Es herrschen also relativ gute Bedingungen im Bund: Es heißt also, sich nicht mehr aufs Wirtschaftliche, sondern aufs Politische zu konzentrieren und dabei muss Preußen „Freunde“ finden.
II/ 1850-1866: Preußen kommt ans Tageslicht
1/ Das Ende des Wiener Systems
Angesichts der im vorigen Teil erörterten Punkte könnte die Periode 1850-1871 als wirtschaftliche Kriegszeit bezeichnet werden. In der Tat zwingt Preußen 1850 Hannover und Oldenburg zum Beitritt des Zollvereins, 1853 wird er für 12 Jahre weiter von den Mitgliedern eines Zollkomitees, also eines parallelen deutschdeutschen Bundesrates, gebilligt, 1857 setzt sich der preußische Thaler als einheitliche Währung durch, sozusagen als Symbol der Herrschaft Preußens: Die wirtschaftliche Vorherrschaft übernimmt hiermit politische Züge im Sinn eines weiteren Ausschlusses Österreichs, d.h. es verwirklicht sich peu à peu die kleindeutsche Lösung. Trotzdem bleibt Preußen noch politisch schwach. Otto von Bismarck, der aufkommende Mann der Auseinandersetzungen innerhalb des österreichisch-preußischen Dualismus‘, erinnert sich an die Anfänge der 1850er Jahre in seinen Memoiren folglich: „[Wir hatten] das Gefühl einer Demütigung, die Preußen durch den Kaiser Nikolaus erlitten hatte. “[38] Dass der russische Kaiser Preußen bei Olmütz aufgegeben und 1849 gegen Dänemark bedroht hätte, ist es leicht zu verstehen: Die Russen haben (noch) kein Interesse daran, dass Preußen Zugang zu den Nordseehafen erhält und zur bedrohlichen mitteleuropäischen Großmacht wächst. Da müssen sich also die Preußen selber durchsetzen, und die russische „Freundschaft“ erzwingen, „ dann “, schrieb Bismarck, „ bleibt es noch immer Zeit, einen Krieg zu führen.“[39]
Aber es muss hier noch gefragt werden, warum eben Preußen diese Rolle der vereinenden Mitteleuropamacht zu spielen hat, und dazu gab 1854 der König von Württemberg Wilhelm I. (1816-1864) Bismarck eine eindeutige Erklärung: „ Wir deutschen Südstaaten können nicht gleichzeitig die Feindschaft Österreichs und Frankreichs auf uns nehmen.“[40] Alle Deutschen, auch im Süden, in Bayern, wo Denkmale zur Ehrung der „teutschen Zunge“ entstehen wie 1842 der Wahlhalla bei Regensburg oder die 1863 vollendente Befreiungshalle bei Kelheim an der Donau, in Schwaben, in Baden, streben nach Einheit, und alle Mittel zur Vollendung dieser Einheit sind heilig, selbst wenn dazu die bayrischen und schwäbischen Kronen von ihrer Macht einbüßen müssen. Das Wiener System ist tot, und niemand wird diese Kronen schützen können als der Bestgerüstete: Preußen.
Und Frankreich spielt mithin weiter seine Rolle als „feindliches Element“. Alphonse de Lamartine (1790-1869), die Seele der französischen Spätrevolutionen, erklärte 1848: „ Les traités de 1815 n’existent plus en droit aux yeux de la République française. “[41] An folgenden Worten musste sich meiner Meinung nach Napoleon III. auch gehalten haben:
„La République a prononcé en naissant […] trois mots qui ont révélé son âme et qui appeleront sur son berceau les bénédictions de Dieu et des hommes : Liberté, Egalité, Fraternité […] Le sens de ces trois mots appliqués à nos relations extérieures est celui-ci : affranchissement de la France des chaînes qui pesaient sur son principe et sur sa dignité ; récupération du rang qu’elle doit occuper au niveau des grandes puissances européennes ; enfin, déclaration d’alliance et d’amitié à tous les peuples. Si la France a la conscience de sa part de mission libérale et civilisatrice dans le siècle, il n’y a pas un de ces mots qui signifie guerre. Si l’Europe est prudente et juste, il n’y a pas un de ces mots qui ne signifie paix.“ [42]
So anspruchsvoll diese Worte sein mögen, sie werden unter Napoleon Anwendung finden, zunächst beim Krimkrieg von 1854, während dessen Preußen inaktiv, also bedeutungslos auf internationale Ebene bleibt (Siehe dazu die Karikatur im Anhang 2). Ziel dabei ist es für die Engländer und die Franzosen zu verhindern, dass sich die Machtstelle Russlands am Schwarzen Meer verstärkt. Dieser Krieg bedeutet aber auch viel für die Mächte, die daran nicht direkt teilnehmen, und zwar vor allem für Österreich, das mobilmacht, um seine Grenzen zu verteidigen. Preußen, gemäß der Schutz- und Trutzbündnisse mit Österreich sollte auch sein Heer einsetzen, was es macht, aber gegen Österreich: Anstatt seine Truppen in Posen zu stationieren, verlegt der König 200.000 Mann in Oberschlesien, also unweit Österreich. Pellistrandi zitiert dazu Bismarck: „ suivre l’Autriche en politique extérieure est une marque de faiblesse.“[43] Russland wird von den vorgeblichen österreichischen Verbündeten verraten, Preußen aber steigt in russischer Achtung. Die Seeherrschaft Englands ist gesichert, dabei hat Napoleon III. Prestige und wirtschaftliche Verträge, die 1860 in Amiens unterzeichnet werden, gewonnen, und zum Pariser Kongress von 1856 wird Russland gedemütigt, und zum ersten Mal Sardinien eingeladen als Großmacht.
Dies hat seinen Grund: Italien befindet sich in Aufruhr und Aufbruch, und dabei sind die Piemonteser am Steuer. „ Itala farà de sè “ [Italien hat sich allein gemacht] soll es heißen, aber eigentlich bekommt 1859 „ Il Risorgimento “ seinen Anstoß durch den Einsatz französischer Truppen an der piemontesischen Seite gegen Österreich: Ruhmvoll sind die Schlachten von Solferino und Magenta, auch so schrecklich, dass daraufhin Henry Dunant das Rote Kreuz gründete. Italien, das damals 6,5 Millionen Bewohner zählt, wird dank der Franzosen geboren, die aber kurz von der Endschlacht ausräumen, und dies aufgrund preußischer Bedrohungen: Sollte die Lage sich weiter zu Ungunsten der Habsburger und zu Gunsten der Franzosen entwickeln, dann würden die Preußen am Rhein Frankreich angreifen, schon damals. Immerhin erhält Napoleon III. in „Dankbarkeit“ für seine Hilfeleistungen im Vertrag von Villafranca Nizza und Savoyen: Dies ist die erste Erweiterung Frankreichs seit 1815. Österreich also erhält vom Bund keine direkte Hilfe, noch schlimmer verbündet sich der am 14. März 1861 gekürte König Italiens, Vittorio Emanuele II. von Savoyen (1861-1878) mit den Preußen, ein Bündnis, das von Napoleon III. gefördert wird.
Die italienische Freiheitsbewegung macht Schule in Deutschland. Für die Deutschen ist die Entstehung Italiens von großer Bedeutung, wie Otto Dann es erklärt: „ deren Gegner war Österreich, ein Staat des Bundes, und ihr Verbündeter der unbeliebte Napoleon III. Es ging also nicht allein um das Schicksal Italiens, sondern zunehmend auch um die Folgen für Deutschland. “[44] In Coburg entsteht anlässlich dessen ein mächtiger deutschnationaler Verein, dessen Zweck ist es, die „ Umwandlung des Deutschen Bundes in einen nationalen Bundesstaat mit parlamentarischer Kontrolle und Legislative “[45] zu vollenden. Otto Dann erklärt weiter: „ Der italienische Krieg machte deutlich, daß sich eine Monarchie auch mit einer nationalen Bewegung verbünden konnte.“[46] Es heißt also Einheit und Freiheit des einen Volkes nicht mehr durch Herrschaftswechsel, durch Enthauptungen und Kriegshymnen wie in Frankreich, sondern mit Beibehaltung der Ordnung, durch Bewahrung der internationale Stelle des Landes als Großmacht. Otto Dann betrachtet diesbezüglich den König Italiens als „ einen nationalen König neuen Stils.“[47] Ihm zufolge „nationalisiert“ sich der deutsche Staat, d.h., wie er betont, „ Das Bürgertum betrachtete den Staat nicht mehr als seinen Gegner, es ging auf ihn zu […] Die staatsragenden Schichten erkannten den Nutzen, der sich für die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft ergab, wenn sie die nationalen Kräfte und Legitimationen in den Dienst ihrer Ziele stellten. “[48] Daher wurde Napoleon I. nicht mehr als Usurpator betrachtet, sondern als Kultfigur, als Vorkämpfer einer nationalen Sache. Er hat die Revolution „von oben“ vollendet, und so sollte es auch in Deutschland gehen. 1859 veröffentlicht ein Bekannter von Bismarck, Ferdinand Lassalle (1825-1864), der nachmalige Mitgründer der SPD, das Essay Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens [49], in dem es hieß, die Frage zu erörtern, ob Preußen die Rolle Piemonts zu übernehmen vermöchte. Für Lassalle aber soll dies auf demokratische Weise erfolgen, aber so sieht es nicht der künftige Premier Preußens, Bismarck. Seine Amtsantrittsrede ist ein Meilenstein der politischen Geschichte Deutschlands: In der sog. „Blut-und-Eisen-Rede“ erklärt am 30. September 1862 der „ Realpolitiker Bismarck “[50]:
„Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht […] Preußen muß seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten auf den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpaßt ist; Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig; nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden - das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen - sondern durch Eisen und Blut.“ [51]
Vom frischen gekrönten Wilhelm I. (1861-1888) wird Bismarck zu Hilfe gerufen, der damals als Diplomat in Paris fungierte: Mit Napoleon III. soll er viel diskutiert haben (siehe Anhang 3) über europäische Politik und großmächtige Zukunft, aber was für den Franzosen nur Theorie bleiben mag, wird bei Bismarck zur Realität. Und das erste Opfer dabei sind die Polen gewesen.
2/ Polen, 1863: Bismarcks russische Politik
Polen stellt für die deutschen Nationalisten ein Problem dar. Bei denen, die an den Geist des Völkerfrühlings hängen, soll man Polen die Unabhängigkeit Deutschland gegenüber gewähren wie der Frankfurter liberale Abgeordnete Arnold Rugge in einer Rede am 25. Juli 1848 erklärte: „ Die Polen sind ein nothwendiges Moment in der europäischen Entwickelung, die Polen können, sie dürfen nicht unterdrückt werden […] Wir müssen jetzt das neue Völkerrecht gründen helfen. “[52] Am Tag zuvor hatte der ostpreußische konservative Abgeordnete Wilhelm Jordan folgende Worten ausgesprochen:
„Ich sage, die Politik, die uns zuruft: Gebt Polen frei, es koste, was es wolle, ist eine kurzsichtige, eine selbstvergessene Politik, eine Politik der Schwäche, eine Politik der Furcht, eine Politik der Feigheit. Es ist hohe Zeit für uns, endlich einmal zu erwachen aus jener träumerischen Selbstvergessenheit […] zu erwachen zu einem gesunden Volksegoismus.“[53]
Während Arnold Rugge eher von „ der endlichen Lösung der europäischen Frage […] in Gemeinschaft mit England und Frankreich “[54] spricht, steht Jordan hartnäckig auf „volksegoistische“, preußische Vorteile: Und dies bedeutet, nie Posen den Polen aufzugeben. Seit 1848 ist das Großherzogtum Posen durch eine Personalunion an Preußen einverleibt, die Provinz besteht aus 60% Polen und ist dem Erzbischof vom russischen Kongreßpolen untergeordnet. Posen dient sozusagen als Pufferzone zwischen Preußen und Russland, aber die Polen streben auch nach Freiheit und Einheit, und dies soll erfolgen, indem alle polnische Gebiete, also auch Posen, zurückgewonnen werden. Die Posner aber sind der preußischen Krone gegenüber loyal und sehr eingedeutscht, mehr als die Schlesier. Die Erinnerung an die napoleonische Zeit, als Tadeusz Kosciusko und Dabrowski für Polen kämpften, ist bei den Posnern schon weit entfernt, aber die deutsche Frage, die jene Erinnerung an Napoleon I. des Öfteren ins Leben ruft, ist nicht mit der polnischen Frage zu verwechseln: Deutschland hat keinen Staat, aber Polen hat keinen Staat mehr, und die Polen wollen es wieder haben, also gegen Preußen, Russland und ferner gegen Österreich, das Galizien friedlich und völkerfreundlich administriert, kämpfen. Thomas Serrier hebt Folgendes zu Recht hervor: „ Les Polonais ne voulaient pas être une minorité mais une contre-nation […] Les Allemands de l’autre côté ne voulaient pas perdre la moindre parcelle de leur Etat […] ils voulaient la germaniser. “[55] Es herrscht Hass zwischen Polen und Deutschen, wie der Publizist Moritz Busch erklärte: „ Den Niemec und Prussiak haßt er mehr wie den Moskoviten, weil des Ersteren höhere Civilisation ihn sicherer unterjocht und vernichtet als des Letzteren blos physische Kraft. Seit 1848 hat absolut jeder gesellige Verkehr zwischen den Deutschen und Polen aufgehört. “[56] Bismarck war übrigens bereits 1848 folgender Ansicht: „ Man kann Polen in seinen Grenzen vor 1772 herstellen wollen, ihm ganz Posen, Westpreußen und Emsland wiedergeben; dann würden Preußens beste Schienen durchschnitten […] Ein rastloser Feind würde geschafft, viel gieriger als der russische Kaiser. “[57] In Anlehnung an die spätere Oder-Frage scheint das deutsch-polnische Zerwürfnis praktisch unlösbar zu sein. Um Polen entgegenzustehen braucht Preußen sich an Russland anzunähern. Burgaud erklärt folglich, warum es so wichtig gewesen ist, Polen jedwede Hoffnung zu vernichten:
„[La Prusse, pour exister, doit] éradiquer à jamais le spectre d’une Pologne indépendante mais surtout propulser son pays sur le devant de la scène […] Car si la Prusse ne sort pas de l’ombre, si elle n’acquiert pas de structure internationale, elle n’a aucune chance d’être crainte ou respectée, donc à terme d’être courtisée. “[58]
Dazu zitiert sie Bismarck: „ Wir werden ihnen Bajonette für Bajonette bieten.“[59] Es muss also eine Annäherung geben, aber keine Allianz[60]: Die Konvention Alvensleben, nach dem Namen der Diplomat Gustav von Alvensleben (Bismarck sagte von ihm, er sei einer „ der Meisterbilder von Generalen “[61] ), der sich bemüht hat, einen Vertrag über die Lösung der polnischen Frage zwischen Berlin und der Neva zu verfassen, wird das Schicksal der Polen entscheiden und auch die Ereignisse von 1866[62]. Russland gewährt seinem neuen „Freund“ Neutralität im Fall von Kampfhandlungen auf polnischem Gebiet (also auch in Schlesien), und lässt die preußischen Truppen den polnischen Aufstand auf polnischem Gebiet niederschlagen. Der damalige russische Außenminister, der Fürst Alexander Gortschakow (1798-1883), war folgender Meinung: „ il était impossible que les Prussiens agissent autrement sans se couler. “[63] Preußen benötigt also eine solche Politik zu führen, um seine Machtstelle in Mitteleuropa zu sichern, zumal dass die Polen eng mit den Franzosen arbeiten könnten. Stefan Kieniewicz vertritt diesbezüglich die folgende Auffassung:
„Deux faits semblaient évidents à la majorité des patriotes polonais: que l’éclipse de la France après 1815 n’était que passagère et elle ne tarderait pas à recouvrer son hégémonie - et que, dans son propre intérêt, la France en expansion appuierait les revendications des peuples asservis et leur lutte contre la Sainte Alliance. “[64]
„Auf die Franzosen warten“, so reden die Anführer der aufrührerischen Polen.[65] Allerdings und Napoleons[66] Hilfeversprechungen zum Trotz kommt es zur Annäherung zwischen Frankreich und Russland, indem der Kaiser Italien anerkannt. Polen ist noch einmal aufgegeben.
Es heißt nun für Preußen, Polen endgültig zu schlagen. Stéphanie Burgaud zitiert abermals Bismarck, der zum vorigen folgende Stellungnahme hatte: „ tout ce que l’on fait pour la Pologne […] sert à renforcer la position française sur le continent […] nous ne pouvons pas tenir le Rhin avec une Pologne dans le dos.“[67] Die Engländer auch wünschten sich, dass Preußen geschadet wird, und missbilligen dabei die Konvention Alvensleben (deren geheimen Artikel sie nicht kennen) als „ atteinte méprisable aux droits de l’homme et des nations.“[68]
Preußen also hat sich mit Russland auf das Schicksal eines möglichen, grenzgefährdenden Feindes abgemacht und dabei Unterstützung für seine künftige Politik gefunden. Die sog. Bismarck’sche Bündnispolitik ist in Gang gesetzt. Nun heißt es, sich dem Auswärtigen zu wenden, und Preußen aus einer Regionalmacht eine anerkannte Großmacht zu machen.
III/ 1864-1871: Der Weg zur Einheit durch „Blut und Eisen“
1/ Die Auflösung des preußisch-österreichischen Dualismus‘
Um attraktiv zu sein, muss man seine Anziehungskraft aufzeigen, was Preußen durch Kriege zu tun scheint. Bereits 1848 finden die preußischen Truppen Gelegenheiten, sich auf dem Schlachtfeld zu gewähren, und zwar gegen Dänemark, worauf sich aber England und Frankreich, und vor allem Russland eingemischt und die Kämpfe zu Ende gebracht haben. Im Londoner Protokoll von 1852 wird die Stelle Lauenburgs, Holsteins, als Mitgliedsstaaten vom Bunde, und Schleswigs, dem dänischen Königtum und dem Deutschen Bund, klar definiert: Die drei Herzogtümer, von einer großen deutschen Minderheit bevölkert, werden von Dänemark in Personalunion administriert, Holstein und Lauenburg sollten aber weiterhin zum Bund gehören. 1863 aber kommt es in Dänemark zum Hauswechsel und der neue König, Christian IX. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1863-1906) erhebt Anspruch auf die drei Staate und zerbricht das regionale Gleichgewicht. Das deutsche Volk sei hiermit bedroht, so denken zumindest die Preußen, die in diesem Zwischenfall die Chance ergreifen, ihre Macht in Richtung Nordsee auszudehnen. Und dies unter dem Vorwand, die einheimischen Deutschen zu schützen. Albrecht von Roon (1803-1879), der seit kurzem das preußische Heer umgestaltet hat, sieht dabei eine gute Gelegenheit, die neue „Grande Armée“ Europas zu testen, und dies erfolgt ganz planmäßig: Binnen einigen Monaten werden die dänischen Truppen geschlagen. Jedoch hat sich dabei Österreich im Namen des Bundes eingemischt. Während Preußen versucht hat, ohne Auftrag des Bundes anzugreifen, zwingen die Habsburger Preußen, dass es sich dem Bunde wieder unterordnet. Dies könnte einerseits eine weitere Demütigung für Preußen darstellen, aber andererseits erkennt Österreich Preußen indirekt an als ebenbürtigen Mitstreiter der deutschen Sache. Der Frieden von Wien am 30.10.1864 wird von den Preußen gut gelenkt, und nach der Gasteiner Konvention von 1865 sollen Österreich und Preußen sich die Verteidigung der Elbherzogtümer zukünftig teilen. Aber auf klügere Weise erhält Preußen Schleswig und Österreich Holstein, sodass eine österreichische Provinz von preußischen und preußenfreundlichen Gebieten eingekesselt wird.
Der Schleswig-Holstein-Konflikt wird abermals zum Auslöser des Kampfes um die Vorherrschaft in Deutschland. Bei den italienischen Befreiungskämpfen hat sich erwiesen, dass die große Donaumonarchie erschlagbar ist, und zwar auf ganz leichte Weise, zumal Preußen mit Italien nun verbündet ist. Frankreich dabei wird hinters Licht geführt: Bismarck verspricht, nur mündlich und zweideutig, Napoleon die Wiederherrschaft auf dem linken Rheinufer gegen seine Neutralität bei einem Krieg zwischen Preußen und Österreich, der 1866 geschieht. Am 14. Juni 1866 erklärt der preußische Gesandte im Bundestag folgendes: „ Insbesondere aber steht die Stellung Österreichs in Holstein nicht unter dem Schutze der Bundesverträge, und Seine Majestät der Kaiser von Österreich kann nicht als Mitglied des Bundes für das Herzogtum Holstein betrachtet werden. “[69] Österreich, das über die Politik des Bundes entscheidet, befiehlt den bündischen Truppen, die in Holstein eindringenden Preußen anzugreifen, worauf Preußen aus dem Bund austritt, und hiermit die ganze Welt seine Machtansprüche auf Deutschland aufdeckt. Die bündisch-habsburgischen Truppen werden leicht geschlagen, am 3. Juli 1866 bei Königgrätz fügen die Preußen den Österreichern unter dem Kommando von Moltke dem Älteren (1800-1891) eine durchschlagende Niederlage zu. Aber der glänzende Sieg soll nicht demütigend sein, so zumindest will es Bismarck, der Wilhelm I. verwehrt, auf Wien zu marschieren. Stattdessen betreten die Preußen Preßburg (das heutige Bratislava): Österreich soll ein möglicher Partner[70] für zukünftige Pläne bleiben, eigentlich Pläne, die gegen Frankreich ganz klar gerichtet sind. Obwohl die Italiener den Habsburgern unterliegen, der zwischenstaatliche Bündnis hat sich in Gang gesetzt und Italien erhält das bisher österreichische Venedig, Frankreich aber nichts, das davor zittert, dass ein neuer Deutscher Bund unter starker Führung Preußens entsteht. Noch schlimmer scheitern alle Versuche, einen Süddeutschen Bund ins Leben zu rufen: Der Frage, ob der künftige deutsche Staat großdeutsch oder kleindeutsch sein wird, wird aber noch keine Antwort geboten. Auf heimtückische Art und Weise aber sichert sich Bismarck den Beistand der Süddeutschen im Fall eines Angriffs Frankreichs gegen Geld und Schutz wider Österreich. Die sog. Schutz- und Trutzbündnisse von 1867 sind aber nicht zeitlich begrenzt, infolgedessen nicht auflösbar; darüber hinaus verwandelt sich der Zollverein, der Nord- und Süddeutschland wirtschaftlich vereint, durch die Gründung eines Zollparlaments im Jahre 1868 in einen, so Ernst Rudolf Huber (1903-1990), „ Zollbundesstaat “[71]: Man könnte sagen, die Einheit Deutschlands ist schon vollgebracht.
Jedoch besteht für Preußen noch die Gefahr, dass Frankreich und Russland, nun wieder gute Freunde, aber keine Verbündeten geworden, sich gegen Preußen einigen. Preußen muss noch seinen „Bündniswert“ bewerten, und in der Tat unterzeichnen Wilhelm I. und Nikolaus I. einen „Geheimen Bund“, die sog. „ Accord des souverains “ [Übereinkunft der Herrscher]. Nach diesem geheimen Vertrag soll sich Preußen in die Angelegenheiten Russlands wegen der sog. „orientalischen Frage“, also der Ausdehnung russischer Einflusssphäre am Bosphorus zu Ungunsten der Habsburger und auf Kosten des „ kranken Manns Europas “[72] nicht einmischen, im Gegenzug wird Russland bei preußischen Kriegshandlungen wider Österreich oder Frankreich neutral bleiben. Dies bedeutet, dass Bismarck Rückdeckung im Osten erhält. Einen solchen, franzosenfeindlichen Vorgang erklärt Stéphanie Burgaud damit, dass der russische Kaiser die französische Freundschaft für nichtig hält: Tatsächlich hat ein Pole versucht, bei der Pariser Weltausstellung von 1867 den Kaiser zu erschießen. Dass ein „befreundetes“ Land Feinde der russischen Sache Asyl bewährt, sei nicht ertragbar. Gortschakow teilte dem Kaiser folgendes mit: „ Que pouvons-nous faire d’autre? Personne ne peut compter sur la France ou l’Angleterre ; l’Autriche est faible et pas bien disposée envers nous. Si nous rompons avec la Prusse, nous restons seuls.“[73] Die Engländer dabei wollen sich überhaupt nicht in festländische Angelegenheiten einmischen, soweit das „ British interest “ nicht gefährdet wird. Die Franzosen selber nähern sich den Habsburgern wieder an, indem Napoleon III. die habsburgischen Interessen in Mexico unterstützt, wobei aber die ganze Affäre tragisch endet[74], mit der Enthauptung des autoproklamierten Kaiser Maximilian I., des jüngeren Bruders von Franz Josef. Immerhin scheinen die Franzosen und die Österreicher versöhnt zu sein, aber in Wahrheit führt Wien eine andere, preußenfreundlichere Politik ins Schilde: Da es seine Interesse am Bosphorus bewähren will, entscheidet sich Franz Josef einen geheimen Vertrag mit Wilhelm I. wider die Russen zu unterzeichnen: Im Fall eines Krieges zwischen Russland und Österreich sollten die Preußen den Österreichern beistehen, was im klaren Widerspruch zum vorigen Vertrag steht. Darin besteht die sog. Bismarck’sche Bündnispolitik, in Dubiösem und Egoistischem, ganz im Sinn der vordem zitierten Rede von Wilhelm Jordan. Auch die Griechen wenden sich Wien zu, indem die aufständischen Kreter Gesuch nach Hilfe nach Wien schicken. Die Griechen wollen sich aber nicht nur von den Osmanen emanzipieren, aber auch von den Slawen, und genauer von den Serbien, die unter Schutz dem russischen Kaiser als panslawistischem Herrscher eine Gefahr bilden. Der russische Diplomat Nikolai Ignatjew (1832-1909) schrieb in einer Mitteilung zum Kaiser am 20. Jänner 1868 folgendes: „ Il nous faut faire coïncider le mouvement gréco-serbe avec une guerre entre la Prusse et la France.“[75] Demzufolge offenbart sich die russische Politik eindeutig franzosenfeindlich, was Bismarck so erklärte: „[Der Grund] waren die ungeschicktesten Bestimmungen des Pariser Friedens [von 1856]; einer Nation von hundert Millionen kann man die Ausübung der natürlichen Rechte der Souverainität an ihren Küsten nicht dauernd untersagen. “[76] Jedoch erleidet Russland dabei angesichts der Bismarck’schen Bündnispolitik eine tiefwurzelnde Niederlage: Da sich Preußen mit Österreich heimlich verbündet hat, bedeutet, dass später die Preußen Österreich gegen die Slawen unterstützen will, und nicht Russland gegen die immerhin donauländischen Deutschen. Diesbezüglich ist Stéphanie Burgaud folgender Ansicht: „ Il reste que depuis 1866 Bismarck, dans sa recherche de points d’appui en Europe, escompte la réconcialiation des deux puissances germaniques et qu’il n’a pas hésité à y sacrifier les intérêts russes. C’était l’alternative à la constitution d’une grande Allemagne. “[77] Wie dem auch sei, ist die politische Einheit Preußens noch nicht vollendet: Bismarck fehlt es noch ein deutscher Kaiser.
2/ Die Einheit nur durch Krieg?
In Anlehnung an Wilhem Jordan schreibt Bismarck in seinen Memoiren: „ Die einzige gesunde Grundlage eines großen Staates, und dadurch unterscheidet er sich wesentlich von einem kleinen Staate, ist der staatliche Egoismus und nicht die Romantik. “[78] Man könnte hier behaupten, dem „ Realpolitiker Bismarck “ wären die einzig preußischen Interessen wichtig. Doch indem er Preußen mit Russland durch eine Entente (und keine Allianz) und mit Österreich durch eine Art „ traité secret à trois “[79] zweckmäßig „verbündet“, sorgt er für die Zukunft von mehr als Preußen: Deutschland, und dies sollte bestenfalls durch die Erniedrigung einer der größten Mächte Europas, des „Erbfeindes“ Frankreich erfolgen. Denn derzeit ist Frankreich noch eine Großmacht, den wiederholten diplomatischen Niederlagen zum Trotz. Das „Empire français“ ist das drittgrößte der Welt nach England und Russland, jedoch erklärt der nachmalige Präsident Adolphe Thiers (1797-1877) in seiner Histoire du Consulat et de l’Empire aus dem Jahre 1860: „[La France est] une grande puissance, mais une puissance tronquée. “[80] Benoît Pellistrandi ist aber folgender Meinung:
„L’isolement diplomatique de la France en 1815, la ténacité de la politique extérieure française pour sortir du cadre de Vienne et les craintes réitérées des puissance européennes à chaque secousse révolutionnaire (1830, 1848) et à la politique offensive de Napoléon III révèlent une donnée majeure de l’histoire des relations internationales entre 1800 et 1871: la peur de la prédominance française.“[81]
Schon 1867 bei der Luxemburger Krise aber beschwören die alldeutschen Nationalisten den Geist der Rheinkrise wieder, und das, was für Napoleon lediglich eine neue diplomatische Niederlage darstellt, kristallisiert wiederum die franzosenfeindlichen Gefühle auf dem deutschen Boden. Wie die Betrachtung Frankreichs als hegemoniale Macht von Bismarck selber angstvoll immer auch übertrieben sein möge, Bismarck könnte gewiss nicht ertragen, dass die Franzosen einen Kaiser haben und er keinen hätte. Damals aber ist Frankreich isolierter denn je. Zunächst hat der Sohn Wilhelm I. eine englische Prinzessin geheiratet, Viktoria von Sachsen-Coburg-Gotha, die Nichte des belgischen Königs Leopold, was zur Abkühlung der englisch-französischen Verhältnisse beiträgt.[82] Das englische Haus Hannover, und dann die Sachsen-Coburg-Gotha/Windsor sind zunächst vielmehr preußenfreundlich. Italien auch hat Napoleon den Rücken gewandt, seitdem der Kaiser Truppen in Rom eingesetzt und den Italienern verwehrt hat, dass sie den Thron des Papstes bedrohen. Ein anderer Leopold wird demnächst der unschuldige Auslöser der für Preußen entscheidenden deutsch-französischen Krise des 19. Jahrhunderts: Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen (1835-1905), Enkel von Murat, also ein Verwandter des Kaisers Napoleon III.[83], und Cousin des nachmaligen Kaisers Wilhelm I., ein Schlüsselmann der deutsch-französischen Beziehungen sozusagen.
1868 bricht die „ Gloriosa “, die „Glorreiche Revolution“ in Spanien aus, worauf der General Juan Prim i Prats (durch einen Anschlag 1870 getötet) einen neuen König für Spanien sucht. Unter den krönbaren Köpfen Europas, die noch frei sind, befinden sich, ungeachtet der Bonapartes, viele Hohenzoller, was eine gute Partie für Spanien wäre: Durch eine Annäherung an Preußen könnte sich Spanien gegen Frankreich wieder durchsetzen. Doch Bismarck ist anderer Meinung: „ ein König von Spanien könnte eben nur spanische Politik treiben. “[84] Die Behauptung, Frankreich hätte dabei Angst vor der Wiederherstellung eines deutschen, frankreichseinzingelnden Reichs à la Karl V. (mit Erweiterung, da es auch in Rumänien einen Domnitor deutsches Blutes gibt, der Schwabe Karl I. von Hohenzollern-Sigmaringen), hält er für durchaus bloße Quatscherei:
„Wir wären vielmehr berechtigt gewesen zu der Besorgnis vor einem engern Verständnis zwischen der spanischen und der französischen Krone als zu der Hoffnung auf Herstellung einer spanisch-deutschen und antifranzösischen Konstellation nach Analogie Karls V. […] Die früher zu Wasser und zu Lande mächtige Nation kann heut nicht die stammverwandte Bevölkerung von Kuba im Zaume halten; wie sollte man von ihr erwarten, daß sie eine Macht wie Frankreich aus Liebe zu uns angriffe?“[85]
Immerhin tritt Leopold auf Druck Napoleons zurück. Ein Hohenzoller verzichtet also auf eine Krone wegen eines französischen „Kaisers“; das kann Bismarck nicht annehmen: „ Ich hielt diese Demütigung vor Frankreich und seinen renommistischen Kundgebungen für schlimmer als die von Olmütz. “[86] Frankreich steht also auf dem Weg Preußens zur Großmacht, es soll also besiegt werden: „ Ich sah kein Mittel den fressenden Schaden, den ich von einer schüchternen Politik für unsre nationale Stellung befürchtete, wieder gutzumachen, ohne Händel ungeschickt vom Zaume zu brechen und künstlich zu suchen. Den Krieg sah ich als eine Notwendigkeit an. “[87] Napoleon hat sich bei der Spanischen Erbfolgekrise geirrt: Es handelte sich dabei nur um eine dynastische Frage, er aber betrachtete sie als eine deutsch-französische Frage, und so wird sie sein müssen. Bismarck abermals ergreift die Gelegenheit, seine Politik fortzuführen, und verfälscht ein diplomatisches Dokument, die sog. Emser Depesche (so nach dem Namen der Stadt, Bad Ems, wo der preußische König als Kurgast weilt), in der Wilhelm I. auf Druck Napoleons (durch seinen Diplomaten Vincent Graf Benedetti) ausdrücklich auf die spanische Throne für sein ganzes Haus verzichtete. In Form eines Telegrammes erreicht diese Nachricht Bismarck, als er in Gesellschaft von Roon und Moltke, den Seelen des preußischen Militarismus, speist. Trotz der Niederschlagenheit, von der Bismarck erzählt, treffen die drei Herrschaften die gemeinsame Entscheidung, aus einer erneuten diplomatischen Niederlage eine Falle für den französischen Kaiser zu machen. Die Fälschung der Depesche, die Bismarck allen diplomatischen preußischen Missionen im Bunde schicken lässt, besteht im folgenden Text:
„Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der Kaiserlich Französischen Regierung von der Königlich Spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der Französische Botschafter in Ems an Seine Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegraphiere, dass Seine Majestät der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten.
Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den Franz. Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass Seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe.
Teilen Sie dies dort mit. “[88]
Hohe Wellen der franzosenfeindlichen Empörung schlagen diese Worte in der deutschen Öffentlichkeit, Napoleon ist von dieser Werbekampagne entrüstet und fällt in die Falle: Er erklärt Preußen den Krieg, der Mechanismus der Bündnisse setzt sich in Gang, Süddeutschland tritt an preußischer Seite an, Napoleon sieht sich gezwungen, die Flotte und die römische Garnison einzusetzen, verliert dabei Rom, und wird in Sedan eingekesselt, am 2. September 1870 gefangengenommen, durch das neuerdings ausgerufene Parlament der Dritten Republik abgesetzt, ab dem 19. September wird Paris belagert, der Krieg beendet sich im Mai 1871, die Republik soll hohe Summen zahlen, und noch gepfefferter: Elsass und Mosel werden besetzt, und dem am 18. Januar 1871 (170 Jahre nach der Selbstkrönung Friedrich I., König in Preußen) ausgerufenen Deutschen Reich einverleibt. Aber schon im November 1870 teilte Bismarck mit: „ Die deutsche Einheit ist gemacht, und der Kaiser auch.“[89]
Nun heißt zu fragen, ob diese Einheit nur durch den deutsch-französischen Krieg möglich war. Die Historikerin Sandrine Kott ist diesbezüglich folgender Ansicht: „ C’est dans l’opposition à la France, désignée comme ennemi, que se construit l’identité nationale allemande. “[90] Sie erklärt aber auch folgendes: „ L‘ approfondissement constant des liens entre la Confédération du Nord et les Etats méridionaux [montre] le caractère inéluctable de l’unité. […] La guerre de 1870-71 résulterait essentiellement de la volonté française de freiner cette marche vers l’unité allemande. “[91] Auch Otto Dann vertritt diese Auffassung mit folgender Stellungnahme in Bezug auf die Wirkungen der französischen Kriegserklärung auf die „Deutschen“: „ Das deutsche Volk war damit über Nacht zu einer nationalen Verteidigungsgemeinschaft gegen eine französische Herausforderung geworden. “[92] Die Erinnerung an 1840 ist nicht zu unterschätzen, die Franzosenfeindlichkeit war noch sehr stark hinsichtlich der Gefahr, die Napoleon III. für die Souveränität der Donaumonarchien darstellt. Dabei konnte Bismarck auf eine Welle des Reichspatriotismus zählen, der US-amerikanische Historiker Gordon Craig (1913-2005) betont jedoch zu Recht, dass Bismarck Napoleon III. nur in Ermangelung einer besseren Wahl[93] vorgezogen wurde. Frankreich stellte auch ein leichtes Opfer für Preußen dar, es war total isoliert, der erste Präsident der Dritten Republik Adolphe Thiers hätte diesbezüglich folgendes geäußert: „ Europa war nicht zu finden.“[94] Dies kann dadurch erklärt werden, dass Frankreich als Angreifer betrachtet wird, und deswegen erhält es keine Hilfe von den Österreichern, geschweige denn von den Engländern, wie es Bismarck so formuliert: „ Es ist wichtig, daß wir die Angegriffenen sein, und die gallische Überhebung und Reizbarkeit wird uns dazu machen, wenn wir mit europäischer Öffentlichkeit […] verkünden, daß wir den öffentlichen Drohungen Frankreichs furchtlos entgegentreten. “[95] Immerhin hat Bismarck Angst davor, dass die anderen Mächte in die Schwächung Frankreichs ihren Vorteil sähen und Frankreich angriffen, was eine Infragestellung der preußischen Politik bilden würde:
„Für mich spitzte sich daher zu, mit Frankreich abzuschließen, bevor eine Verständigung der neutralen Mächte über ihre Einflußnahme auf den Frieden zustande gekommen wäre, gerade so, wie es 1866 unser Bedürfnis war, mit Österreich abzuschließen, bevor die französische Einmischung in Süddeutschland wirksam werden konnte.“[96]
In internationaler Sicht also ist Preußen zu der Macht geworden, die die Entscheidung über das Schicksal Europas zu treffen hat, und dies setzt voraus, dass Frankreich nicht ganz untergeht, andernfalls würden sich die anderen Mächte einmischen und Preußen als übermütiger Staatsschlachter ins Visier nehmen, was schon im Nachbarland Italien gewägt wird, noch bevor Napoleon gefangengenommen wurde, wie folgende Begebenheit aus Bismarcks Memoiren den Beweis dafür liefert:
„Ich habe […] Besuche von republikanischen Italienern gehabt, welche überzeugt waren, daß der König Victor Emmanuel mit der Absicht umginge, dem Kaiser Napoleon beizustehen, und diese Tendenz zu bekämpfen geneigt waren, weil sie von der Ausführung der dem König zugeschriebenen Absichten eine Verstärkung der ihrem Nationalgefühl empfindlichen Abhängigkeit Italiens von Frankreich befürchteten.“[97]
Hier ist Bismarck nicht als Verteidiger der nationalen Sache Italiens (eines Verbündeten Preußens also) zu betrachten: Dass Vittorio Emanuel den Freiheitskämpfern geholfen hat, ist Bismarck ganz klar, dass dieser Beistand nur eine Schnapsgelegenheit für den piemontesischen König bildete, damit er die Krone Italiens erobert, mit der Unterstützung des „befreiten“ Volkes noch dazu. Die nationale Sache sollte ihm vielmehr einerlei gewesen sein, von Belang war sie, soweit er die Krone innehatte, und bei Bismarck spielt es sich nicht anders ab: Das Reich wird zwar gegründet, aber pur deutsch ist es gar nicht, es gibt in der Tat viele Minderheiten, die das Reich bewohnen, und eigentlich neuerdings und neben den schon zum Bund gehörenden Dänern und Polen werden die Elsässer und katholische Franzosen zu Bürgern des „Deutschen Reiches“. Es ist zu bemerken, dass Wilhelm I., der schon einiges gegen eine „deutsche“, ihm fremde Krone hatte, den Titel von „Kaiser der Deutschen“ entschlossen ablehnt. Die Franzosen hatten einen „König der Franzosen“ gehabt, sogar einen „Kaiser der Franzosen“, aber von einem „Kaiser der Deutschen“ wird nie die Rede sein können. Jean-Claude Caron hebt übrigens zu Recht hervor: „ L’intégration des peuples allemands dans l’Empire n’a pas été l’œuvre d’une centralisation politique menée sur la longue durée, mais plutôt celle d’un pays, la Prusse, et d’une volonté, celle de Bismarck. “[98] Hier ginge es also eher um die Machtergreifung Preußens auf eines „Deutschland“, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Trotzdem „ ein europäisches Ereignis “[99] ist die Einheit Deutschlands durch die Reichsbildung, Otto Dann aber weist auf folgendes hin: „ Das junge Deutsche Reich befand sich an der Schnittstelle zwischen den modernen Nationalstaaten und den alten Vielvölkerstaaten. “[100] Der Historiker Hans-Ulrich Wehler bezeichnet sogar den Zeitschnitt zwischen 1866 und 1871 als eine „ Revolution von oben, “[101] aber ich bin der Meinung, dass von Revolution nicht ohne weiteres die Rede sein kann. Angesichts der vorigen Punkte handele es sich eher der zum ersten Mal vollendeten, außerdem nur kleindeutschen Einigung zum Trotz um die bloße Übernahme von sozusagen leeren Machtstellen durch preußische Adlige. Jean-Claude Caron erinnert zu Recht an Folgendes: Dass der Zollverein noch zwanzig Jahre bestehen wird, was nach der angeblichen Vollendung der politischen Einheit im Jahre 1871 beweist, dass die tatsächliche Einheit der nun „Reichsbürger“ noch unvollendet bleibt.[102]
Schluss
Anhand der in dieser Arbeit verwendeten Quellen und wissenschaftlichen Studien lässt sich ein neues Bild der internationalen Beziehungen im 19. Jahrhundert entwerfen. Tatsächlich hat sich die Einheitsbewegung auf gesamtdeutschem Gebiet meiner Meinung nach so entwickelt, dass auf zwei Elemente stets geachtet wurde: Erstens wer auf Germania herrschen soll, zweitens wem gegenüber sich diese Herrschaft behaupten soll. Die Periode des Vormärzens und der Märzrevolution sollte demgemäß durch einen neuen Blickwinkel bearbeitet werden, d.h. beachtet soll der Rutsch von der Begeisterung für die Befreiung der anderen Völker, die sich in bloßen Neid und sogar Angst verwandelt hat. Es kristallisieren sich durch das Thema dieser Arbeit bereits die Probleme, die bis zum Zweiten Weltkrieg die Wissenschaft und die Politik beschäftigen werden: die Frage der Völker, der Woodrow Wilson (1856-1924) eine Lösung zu geben versuchte, oder vielleicht schon die der „Rassen“, die missbraucht wurde, was zum Wirr des Nationalsozialismus geführt hat. In der Tat wurde vorher durch die Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen verschiedener Politiker und Zeitdenker, sowie mit der zwar vielleicht romantisierten, aber schon politikwissenschaftswürdigen Autobiographie Bismarcks erörtert, dass die Vereinigung aller Deutschen nicht nur eine dynastisch-politische Sache, sondern auch eine „völkische“ gewesen ist. Die philhellenistische Bewegung ist meines Erachtens einer der Vorläufer dieses völkischen Trends, die Reinheit des angeblichen Vorahnens Griechenland zu rühmen, bedeutet auch die Überlegenheit des Nachkommens Deutschland zu behaupten. Indem es beteuert wird, dass das Deutsche dem Griechischen nachkommt, beanspruchen wiederum die Deutschen nicht zuletzt die „ renovatio imperii “ des 19. Jahrhunderts zu verkörpern. Dabei übernimmt der Machtkampf zwischen Deutschen und Slawen völkische Farben, die Franzosen auch werden von nun an als „Erbfeind“ erklärt, als wäre die Feindschaft Sache der „Heredität“. Bereits hier können Begriffe Verwendung finden, die die Wissenschaftlicher am Anfang des 20. Jahrhunderts weitgehend verbrauchen werden.
Man könnte nun auch behaupten, Bismarcks Leistung bildet bereits eine Sonderung Deutschlands auf internationaler Ebene. Eigentlich ermöglicht das große Weltereignis der Gründung eines Reichs im fremden Land, dass dieses Reich sich behauptet als Entscheidungskraft in Europa. Jedoch räume ich hier ein, dass nicht ohne weiteres von einem „deutschen Reich“ die Rede sein kann. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass die sog. Einheit Deutschlands bloß eine Erweiterung Preußens ist. In anderen Worten, um Robert Blum zu paraphrasieren, wird das sog. Deutschland zum großen Preußen und nicht umgekehrt. Es wäre noch zu forschen, inwiefern die Preußen selber diese Tatsache betrachtet haben sollen, wobei eigentlich Bismarck auf dieses Problem keine klare Antwort gibt. Eines aber ist sicher: dass während der beiden ankommenden Weltkriege der „Völkerkampf“ des 19. Jahrhunderts fortgesetzt werden wird.
Es ist also auf die vorigen Punkte zu schließen, dass die Studien über das hier gewählte Thema weiter zu entwickeln wären, indem klarer bearbeitet wird, was zum Politischen und was zum Völkischen gehört. Bei der Entstehung und eigentlich der Wiederherstellung der „deutscher Nation“ lässt sich aber feststellen, dass das Politische dem Völkischen vieles überweicht. Weiter wäre also zu fragen, ob die Theorie „des Sonderweges“ Deutschlands politisch begründet werden kann, oder ob es dabei nur um Völkisches ginge.
Bibliographie
Primärliteratur
von BISMARCK, Otto: Gedanken und Erinnerungen. Friedrichsruher Ausgabe, 1932. München: Goldmann Sachbuch, 1981.
HARDTWIG, Wolfgang, HINZE, Helmut (Hrsg.): Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 7: Vom deutschen Bund zum Kaiserreich 1815-1871. Stuttgart: Reclam, 1997 (RUB 17007).
LONGERICH, Peter (Hrsg.): Was ist des Deutschen Vaterland? Dokumente zur Frage der Deutschen Einheit 1800-1990. München: Piper, 1990.
« Voisins et ennemis : La Guerre des caricatures entre Paris et Berlin (1848-1890) ». Eine Ausstellung des Goethe-Instituts. Ursula Koch, 1990.
Sekundärliteratur
BURGAUD, Stéphanie: La politique russe de Bismarck et l’unification allemande. Mythe fondateur et réalités politiques. Strasbourg: Presses Universitaires, 2010.
CARON, Jean-Claude, VERNUS, Michel: L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes (1815-1914). Paris: Armand Colin, 2011².
DANN, Otto: Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770-1990. München: Beck, 1993.
ESPAGNE, Michel (Hrsg.) : Philhellénisme et transferts culturels dans l’Europe du XIXème siècle. Revue germanique internationale, 1-2/2005. Paris: CNRS éditions, 2005.
HEIN-MOOREN, Klaus Dieter (u.a.) : Von der französischen Revolution bis zum Nationalsozialismus. Bamberg: Buchner, 2002².
KIENIEWICZ, Stefan : Les insurrections polonaises du XIXème siècle et le problème de l’aide de la France. Paris: Académie polonaises des sciences, 1971.
KOTT, Sandrine : L’Allemagne au XIXème siècle. Paris: Hachette, 1999.
PELLISTRANDI, Benoît: Les relations internationales de 1800 à 1871. Paris: Armand Colin, 2010².
SERRIER, Thomas : Entre Allemagne et Pologne. Nations et identités frontalières : 1848-1914. Paris: Belin, 2002.
SIEMANN, Wolfram : Gesellschaft im Aufbruch. Deutschland 1849-1871. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
WEHLER, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte: 1849-1914. München: Beck, 2006².
Anhang 1: Der Deutsche Bund, 1815-1866
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Von: (abgerufen am 17.12.2013)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Map-GermanConfederation_de.svg
Anhang 2: Preußen und der Krimkrieg aus französischer Sicht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„So, so, ich war davon sicher… Sie sind erfroren… in solchen Zustand führt die Neutralität heutzutage… anstatt so inaktiv zu bleiben, hätten Sie daran gut getan, Sie wie alle zu bewegen.“
Aus: « Voisins et ennemis : La Guerre des caricatures entre Paris et Berlin (1848-1890) ». Une exposition du Goethe-Institut. Ursula Koch, 1990, S. 24.
Anhang 3 : Aus deutscher Sicht
Napoleon III. bringt Bismarck bei, wie man internationale Politik treibt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus Stéphanie Burgaud: La politique russe de Bismarck et l’unification allemande. Mythe fondateur et réalités politiques. Strasbourg: Presses Universitaires, 2010.
[...]
[1] Johann Wolfgang von Goethe: Kampagne in Frankreich 1792. Gedenkausgabe des Werkes, Briefe und Gespräche. Zürich: Ernst Beutler, 1949, S. 86.
[2] Cf. Jean-Claude Caron [et al.]: L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes (1815-1914). Paris: Armand Colin, 2011², S. 150.
[3] Dreyfus in Caron, ibid., S. 153.
[4] Ibid., S. 154.
[5] Cf. ibid., S. 37.
[6] Austria Est Imperare Orbi Universo
[7] Der Historiker Otto Dann erklärt: „ Die Entstehung von Nationen als staatsbildender Kraft ist das besondere Merkmal der europäisch-abendländischen Geschichte. “ In: Otto Dann: Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770-1990. München: Beck, 1993, S. 24.
[8] Siemann in Dann, ibid., S. 137.
[9] Mazzini zitiert in: Benoît Pellistrandi: Les relations internationales de 1800 à 1871. Paris: Armand Colin, 2010², S. 90.
[10] Stéphanie Burgaud: La politique russe de Bismarck et l’unification allemande. Mythe fondateur et réalités politiques. Strasbourg: Presses Universitaires, 2010.
[11] Cf. die Schlußakte der Wiener Ministerkonferenzen in: Wolfgang Hardtwig [et al.]: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 7: Vom deutschen Bund zum Kaiserreich 1815-1871. Stuttgart: Reclam, 1997, vor allem die Artikel 54 und 58 zur Bewahrung „landständischer Verfassungen“, S. 53-54. Cf. auch die Karlsbader Beschlüsse, ibid., S. 79-81.
[12] Siebenpfeiffer in: Peter Longerich: Was ist des Deutschen Vaterland? Dokumente zur Frage der Deutschen Einheit 1800-1990. München: Piper, 1990, S. 63.
[13] Cf. den Vertrag zwischen Alexander I., Franz I. und Friedrich Wilhelm III. in: Hardtwig, op. cit., S. 57-60, und genauer: „ Östreich, Preußen und Rußland, damit bekennend, daß die christliche Nation, zu der sie und ihre Völker gehören, in Wahrheit keinen andern Souverän hat als den, dem allein die Macht gehört, weil in ihm allein alle Schätze der Liebe, der Erkenntnis und der unbegrenzten Weisheit liegen, d.h. Gott “.
[14] Cf. den Tropauer Vertrag, ibid., S. 60-62, genauer: 3. „… so werden sie, um die in Aufruhr befindlichen Staaten in den Schoß der großen Allianz zurückzuführen, zunächst freundschaftliche Schritte unternehmen, in zweiter Linie Zwangsmittel einsetzen “.
[15] In: Mémoires d’outre-tombe, XXVIII, Chapitre 1.
[16] Zur Definition des Philhellenismus ist Michel Espagne zu zitieren: „ Qu’est-ce que le philhellénisme? […] un mouvement scientifique, esthétique et philosophique qui redonne dès la fin du XVIIIème siècle à la Grèce antique son statut de référence hégémonique culturelle et politique en adaptant l’humanisme aux temps modernes […] l’affirmation d’une solidarité plus durable avec le peule grec considéré tout au long du XIXème siècle comme l’une des dernières nations opprimées […].“ In: Michel Espagne : Philhellénisme et transferts culturels dans l’Europe du XIXème siècle. Revue germanique internationale, 1-2/2005. Paris: CNRS éditions, 2005, S. 5.
[17] Cf. Caron, op. cit., S. 160.
[18] Dazu sagte der jüdische Bankier und Saint-Simoner Gustav von Eichhtal: „ Ils [die Griechen] verront avec plaisir des colonies, surtout des colonies industrielles, s’établir dans le pays. “ In : Pellistrandi, op. cit., S. 139.
[19] Espagne, op. cit., S. 5.
[20] In Espagne, ibid., S. 40. Ähnlich verfasst 1824 François Pouqueville eine « Histoire de le régénaration de la Grèce ».
[21] Ibid., S. 64.
[22] In Espagne, ibid., S. 40.
[23] Ibid., S. 40.
[24] Zitiert in Pellistrandi, op. cit.
[25] Ibid., S. 139.
[26] Pellistrandi, ibid., S. 139.
[27] Ibid., S. 70-71.
[28] In Hardtwig, op. cit., S. 273-275.
[29] In Caron, op. cit., S. 171.
[30] Er hielt jene Krone für « un collier de servitude offert par des maîtres boulangers », so Caron, ibid., S. 172.
[31] Dann, op. cit., S. 146.
[32] Ayçoberry in Caron, op. cit., S. 172.
[33] Pellistrandi, op. cit., S. 95.
[34] Dann, op. cit., S. 131.
[35] Cf. die Olmützer Punktation in Hardtwig, op. cit., S. 377-380.
[36] Metternich in Longerich, op. cit., S. 62.
[37] Pellistrandi, op. cit., S. 150.
[38] Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Friedrichsruher Ausgabe, 1932. München: Goldmann Sachbuch, 1981, S. 86.
[39] Ibid., S. 71. Bildet diese Stelle im Sinne eines Sonderweges eine Vorahnung der Operation « Barbarossa » ?
[40] So der König, zitiert von Bismarck selber, ibid., S. 85.
[41] Lamartine in Pellistrandi, S. 87.
[42] Ibid., S. 87.
[43] Bismarck in Pellistrandi, op. cit., S. 102.
[44] Dann, op. cit., S. 138.
[45] Ibid., S. 140.
[46] Ibid., S. 153.
[47] Ibid., S. 154.
[48] Ibid., S. 155.
[49] Zum Digitalisat: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424750#?page=1 (abgerufen am 15.12.2013)
[50] Klaus Dieter Hein-Mooren: Von der französischen Revolution bis zum Nationalsozialismus. Bamberg: Buchner, 2002², S. 220.
[51] Bismarck in Hardtwig, op. cit., S. 411-412.
[52] Arnold Rugge in Hardtwig, op. cit., S. 301-302.
[53] Wilhelm Jordan, ibid., S. 298.
[54] Rugge, ibid., S. 302.
[55] Thomas Serrier: Entre Allemagne et Pologne. Nations et identités frontalières : 1848-1914. Paris: Belin, 2002, S. 42.
[56] Busch in Burgaud, op. cit., S. 57.
[57] Bismarck in Burgaud, ibid., S. 57.
[58] Burgaud, ibid., S. 63.
[59] Bismarck in Burgaud, ibid., S. 143.
[60] Wilhelm I., als er die Konvention Alvensleben unterzeichne, schreibt als Fußnote: „ Fürchte, dass dies ein Allianz-Antrag sein wird.“ In Burgaud, ibid., S. 143.
[61] Bismarck in Burgaud, ibid., S. 50.
[62] Cf. ibid., S. 53.
[63] Gortschakow in Burgaud, ibid., S. 143.
[64] Stefan Kieniewicz : Les insurrections polonaises du XIXème siècle et le problème de l’aide de la France. Paris: Académie polonaises des sciences, 1971, S. 4.
[65] Die tatsächlich zum Mythos der stets bereiten Revolutionärer werden, cf. Gustav Freytag: Soll und Haben, Berthold Rasmus: Die Sensenmänner („Wir kämpfen für Eure Freiheit und für Unsrige!“)
[66] Er soll 1865 gesagt haben: « Je n’entends pas les Polonais se plaindre, il parait qu’on s’amuse à Varsovie. » In Kieniewicz, op. cit., S. 7.
[67] Bismarck in Burgaud, op. cit., S. 73.
[68] Zitiert aus dem Times von 19.02.1863 in Burgaud, ibid., S. 72.
[69] Karl von Savigny in Hardtwig, op. cit., S. 437.
[70] Cf. Pellistrandi, op. cit., S. 97.
[71] Huber in Dann, op. cit., S. 147.
[72] Nikolaus I. soll über den dramatischen Zustand des osmanischen Reiches erklärt haben: „ Wir haben einen kranken Mann auf den Armen. Es wäre ein Unglück, wenn er uns eines Tages entfallen sollte.“ Cf. Pellistrandi, op. cit., S. 105.
[73] Gortschakow in Burgaud, op. cit., S. 337.
[74] Camerone !
[75] Ignatjew in Burgaud, op. cit., S. 338.
[76] Bismarck, op. cit., S. 354.
[77] Burgaud, op. cit., S. 429.
[78] Bismarck in Burgaud, ibid., S. 183.
[79] Cf. Traité secret à trois. In: Hermann Oncken: Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis 1870. Band 3, Dok.-Nr.698. Berlin, Leipzig: 1926, S. 185-188. Zum Digitalisat: http://www.gibs.info/index.php?id=627 (abgerufen am 16.12.2013). Und genauer: „ Sollten Russland von Österreich oder Preussen-Norddeutschland von Frankreich angegriffen werden, sollte die jeweils nicht angegriffene Macht eine Armee an der österreichischen Grenze aufmarschieren lassen. Bismarck lehnte ein schriftlich fixiertes Bündnis mit der Begründung ab, sowohl Preussen als auch Russland seien ihren jeweiligen Gegnern allein gewachsen, Damit vermied er, sich zur Unterstützung Russlands gegen Österreich zu verpflichten, sicherte dem Zaren aber gleichzeitig zu, sich bei einem gemeinsamen Angriff Österreichs und Frankreichs auf Russland an der französischen Grenze zu engagieren, das gebiete die Interessengleichheit beider Länder. Bismarck favorisierte damit – wie Beust [der österreichische Außenminister] mit Frankreich – eine Entente statt einer Allianz. […] Österreich bestand auf die Wahrung einer abwartenden Neutralität im Falle eines Kriegsausbruches zwischen Frankreich und Preußen.“
[80] Adolphe Thiers in Pellistrandi, op. cit., S. 136 (Histoire du Consulat et de l’Empire, Livre LVI, t. XVIII p. 137).
[81] Pellistrandi, ibid., S. 136.
[82] Ganz im Sinne folgenden Memorandum an Albert von Sachsen-Coburg-Gotha vom damaligen Premier Palmerston: „ L’Angleterre et l’Allemagne ont donc naturellement un intérêt direct à s’assister l’une l’autre pour devenir riches, unies et puissantes. “ In Burgaud, op. cit., S. 33.
[83] Bismarck ist dazu folgender Meinung: „ Man [könnte] in Spanien, sowohl als in Deutschland annehmen, dass der Prinz Leopold wegen seiner persönlichen und Familienbeziehungen in Paris eher Persona grata sein werde als mancher deutsche Prinz. “ Bismarck, op. cit., S. 335.
[84] Bismarck, op. cit., S. 335.
[85] Ibid., S. 335-336.
[86] Ibid., S. 340.
[87] Ibid., S. 340.
[88] In Hardtwig, op. cit., S. 461.
[89] Bismarck in Burgaud, op. cit., S. 419.
[90] Sandrine Kott: L’Allemagne au XIXème siècle. Paris: Hachette, 1999, S. 86.
[91] Ibid., S. 83.
[92] Dann, op. cit., S. 148.
[93] Cf. Kott, op. cit., S. 86.
[94] Zitiert von Bismarck, op. cit., S. 350.
[95] Bismarck, ibid., S. 342.
[96] Ibid., S. 352.
[97] Ibid., S. 352.
[98] Caron, op. cit., S. 182.
[99] Dann, op. cit., S. 152.
[100] Ibid., op. cit., S. 156.
[101] Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte: 1849-1914. München: Beck, 2006², S. 156.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Schwerpunkt des Textes?
Der Text analysiert die internationalen Verhältnisse und deren Einfluss auf die deutsche Einigung im 19. Jahrhundert, insbesondere unter Berücksichtigung der Rolle Otto von Bismarcks.
Welche Zeiträume werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Zeit von 1815 bis 1871, unterteilt in die Perioden 1815-1849 (der Weg zum "deutschen Nationalismus"), 1850-1866 (Preußens Aufstieg) und 1864-1871 (der Weg zur Einheit durch "Blut und Eisen").
Welche Ereignisse werden im Zeitraum 1815-1849 betrachtet?
In diesem Zeitraum werden die griechischen Freiheitskämpfe und die Rheinkrise sowie die Märzrevolution in internationaler Sicht analysiert, um die Gründe für die Märzrevolution zu beleuchten.
Was steht im Fokus der Analyse für den Zeitraum 1850-1866?
Der Fokus liegt auf Preußens Reaktion auf die Ereignisse in Italien und Polen, um Preußens Aufstieg durch ein Machtvakuum in Mitteleuropa zu erklären.
Was wird im Zeitraum 1864-1871 erörtert?
Es wird erörtert, ob sich Preußen nur durch Kriegshandlungen zur Weltmacht erhoben hat oder ob ein einheitliches Deutschland von anderen auswärtigen Elementen "genehmigt" wurde.
Welche Rolle spielt Frankreich im Kontext der deutschen Einigung?
Frankreich wird als wichtiger Einflussfaktor auf die Einheitsbewegungen in Deutschland dargestellt, sowohl durch seine juristisch-administrative Wirkung als auch durch die Stärkung des Nationalgefühls. Allerdings wird auch die Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, insbesondere im Zusammenhang mit der Rheinkrise, betont.
Wie wird Bismarcks Rolle im Text dargestellt?
Bismarcks Rolle wird als entscheidend für die deutsche Einigung hervorgehoben, wobei er durch Kriege und geschickte Bündnispolitik die Einheit Deutschlands herbeiführt. Seine Politik wird jedoch auch kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob die Einheit nur durch Gewalt möglich war.
Was ist die Konvention Alvensleben und welche Bedeutung hat sie?
Die Konvention Alvensleben ist ein Vertrag zwischen Preußen und Russland zur Lösung der polnischen Frage. Sie ermöglichte Preußen, den polnischen Aufstand niederzuschlagen und sicherte Russland Neutralität im Falle von Kampfhandlungen auf polnischem Gebiet.
Welche Bedeutung hat der Deutsch-Französische Krieg für die deutsche Einigung?
Der Deutsch-Französische Krieg wird als entscheidender Faktor für die Vollendung der deutschen Einigung dargestellt. Durch den Krieg wurde das Nationalgefühl in Deutschland gestärkt und die Gründung des Deutschen Reiches ermöglicht.
Wie wird die Einigung Deutschlands im Text bewertet?
Die Einigung Deutschlands wird als komplexer Prozess dargestellt, der nicht nur politisch, sondern auch völkisch motiviert war. Es wird argumentiert, dass die Einigung eher einer Erweiterung Preußens als einer echten Vereinigung aller Deutschen entsprach.
- Quote paper
- Arnaud Duminil (Author), 2014, Der Weg zum deutschen Einheitsstaat im 19. Jahrhundert im internationalen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306819