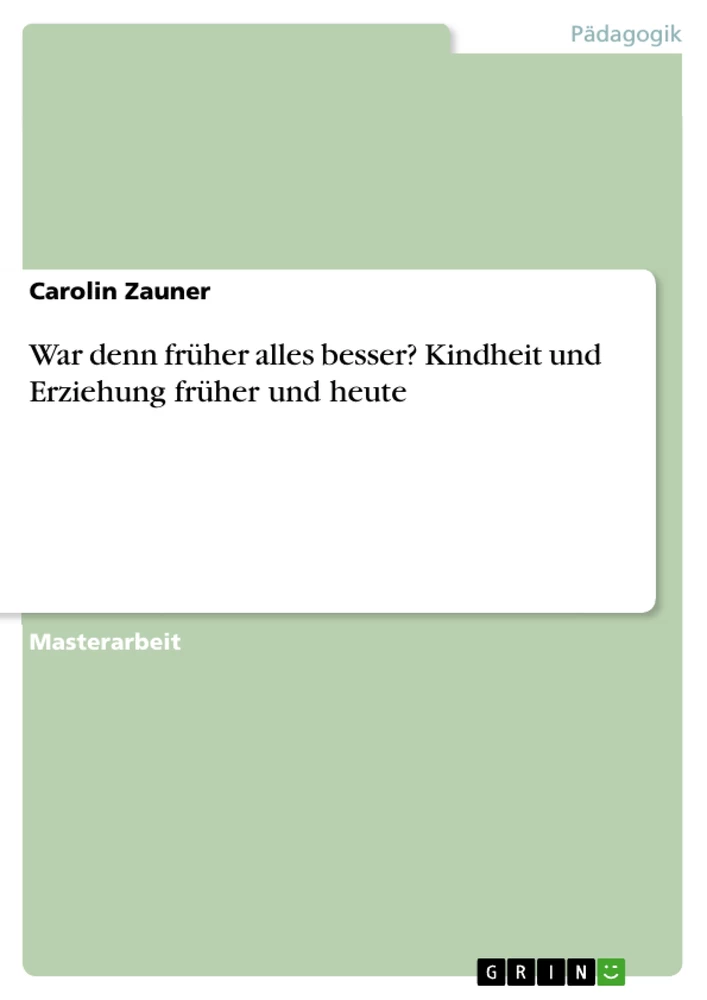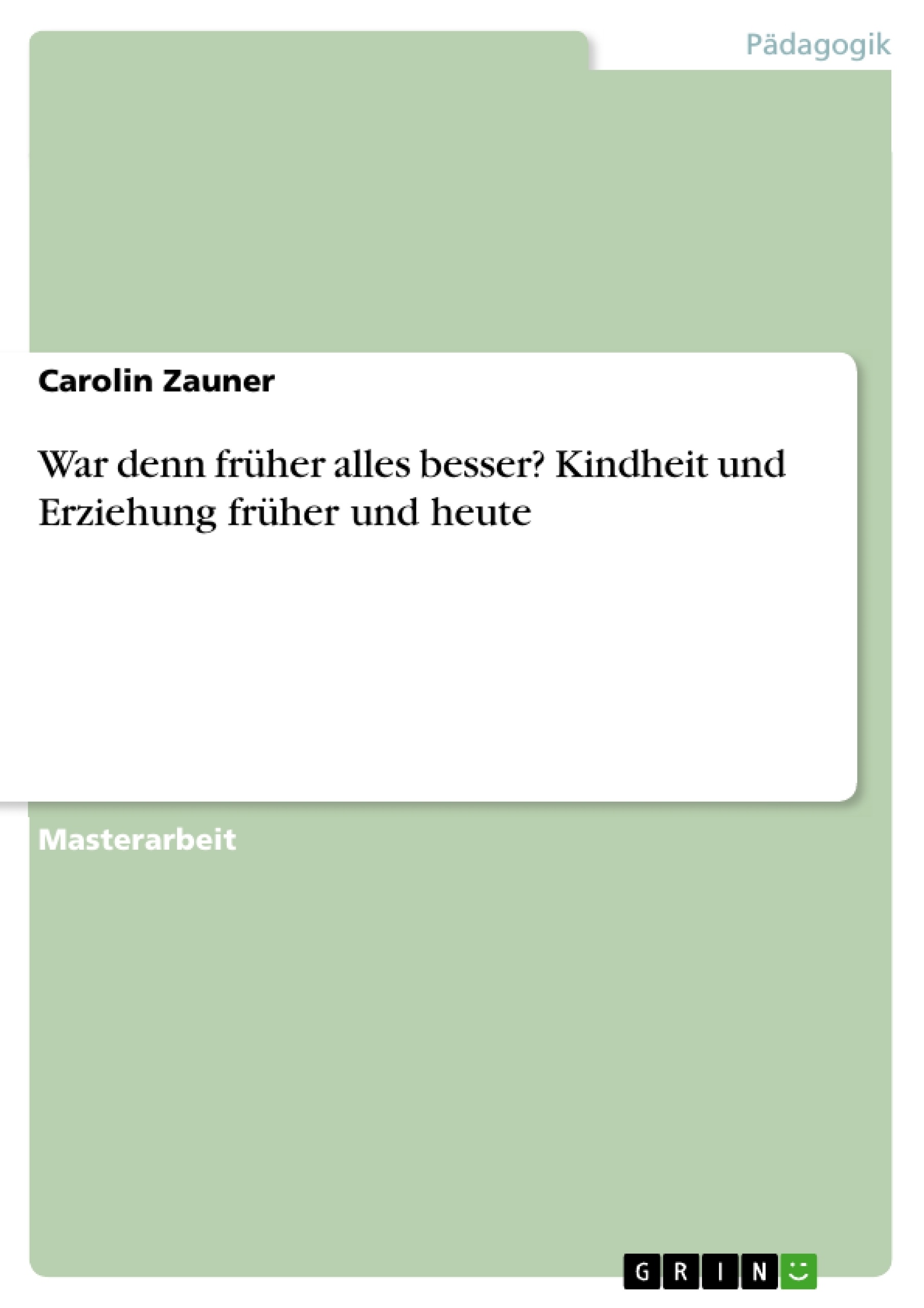„Wir müssen unsere Kinder wieder mehr erziehen und ihnen Werte vermitteln. Pflichtbewusstsein, Fleiß, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, An-stand, richtiges Benehmen.“ (Thole, 2015, S. 1)
Diese Worte sprach Doris Schröder-Köpf (2001), die Ehefrau unseres ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Der „Erziehungsnotstand“ in Deutschland wurde nicht nur von der Fernsehmoderatorin Petra Gerster ausgerufen, sondern auch von den Autoren Michael Winterhoff und Bernhard Bueb. Durch diese ausgelöste Panik vor „kleinen Tyrannen“ konnten sich ebenso Volkshochschulen über ihre ausgebuchten Erziehungskurse, sowie der Markt für Erziehungsratgeber erfreuen. Es löste einen regelrechten Erziehungsboom aus, der die Erfahrungen und Unsicherheiten der heutigen Elterngeneration mit ihren Kindern widerspiegelt. Immer mehr Eltern und Pädagogen kämpfen mit alltäglichen Aushandlungen um Grenzen, Freiräume und Einhaltung von Regeln durch die Kinder. Viele Eltern sind davon übermüdet, überfordert und suchen händeringend um Rat. Derartige Diskussionen über Erziehung haben längst schon die Medien erreicht und machten sich bereits vor einigen Jahren in TV-Formaten wie „Die Supernanny“, „Eltern auf Probe“ oder „Die Superlehrer“ breit, welche eine sehr hohe Einschaltquote erzielten.
Der immer größer werdende Druck der modernen Gesellschaft und der rasche Wertewandel machen sich bei vielen Eltern erkennbar. Sie möchten das Beste für ihr Kind, versuchen alles dafür zu tun und sind häufig überfordert damit. Sie sind sich in der Erziehung ihrer Kinder oftmals sehr unsicher und greifen häufig zu Erziehungsratgebern, von welchen es heutzutage derartig viele auf dem Markt gibt wie nie zuvor. Häufig hört man Klagen, dass sich die Kinder von heute nicht benehmen können, keinen Respekt haben und schlecht erzogen sind. Dazu sehen einige Autoren die Lösung in der Rückkehr zu traditionellen Werten. Die Supernanny Katharina Saalfrank vertrat diese Ansicht bis vor kurzem auch, steht dieser Lösung nun jedoch negativ gegenüber und fordert „Beziehung statt Erziehung“, der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Bergmann ist wiederum der Meinung „Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Liebe“. So lässt sich schnell erkennen, dass jeder eine andere Meinung zum Thema Erziehung hat und eine regelrechte Debatte darüber geführt wird. In diesem Zusammenhang erscheint allerdings sehr häufig der Satz „Früher war noch alles besser“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kindheit im Wandel der Zeit
- 2.1 Definition des Kindheitsbegriffes
- 2. 2 Kindheit im historischen Wandel
- 2. 2. 1 Kindheit in der vorbürgerlichen Gesellschaft im Mittelalter
- 2. 2. 2 Die bürgerliche Vorstellung von Kindheit
- 2.2.3 Kindheit in der deutschen Romantik
- 2.2. 4 Kindheitsbild nach Rousseau
- 2. 2. 5 Reformpädagogische Konzeption von Kindheit
- 2. 2. 6 Kindheit in der Zeit des Nationalsozialismus
- 2. 2. 7 Kindheit in der Nachkriegszeit
- 2.2. 8 Kindheit zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert
- 3. Erziehung im Wandel der Zeit
- 3. 1 Definition von Erziehung
- 3. 2 Erziehung in der Antike
- 3. 3 Erziehung im Mittelalter
- 3. 4 Erziehung in der Wende der Neuzeit
- 3. 5. Erziehung zur Zeit der Aufklärung
- 3. 5. 1 Erziehung nach Jean-Jacques Rousseau
- 3. 5. 2 Erziehung nach Johann Heinrich Pestalozzi
- 3. 5. 3 Erziehung nach Immanuel Kant
- 3. 6 Erziehung zur Zeit der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert
- 3. 7 Erziehung zur Zeit der Reformpädagogik bis zum Nationalsozialismus
- 3. 8 Erziehung zur Zeit des Nationalsozialismus
- 3. 9 Erziehung nach 1945 und die 68er Bewegung
- 3. 10 Kindheit und Erziehung im 21. Jahrhundert
- 4. Gegenwärtige Erziehungsvorstellungen
- 4. 1 Amy Chua – die Mutter des Erfolgs?
- 4. 2 Die Abschaffung der Kindheit - Michael Winterhoff
- 4.3 Wer erziehen will, muss strafen – Bernhard Bueb
- 5. Kindheit und Erziehung im Wandel der Zeit - eine Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Wandel des Kindheits- und Erziehungsverständnisses im Laufe der Geschichte. Sie beleuchtet die verschiedenen historischen Epochen und ihre jeweiligen Vorstellungen von Kindheit und Erziehung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild von den Veränderungen und Kontinuitäten im Umgang mit Kindern und ihrer Entwicklung zu zeichnen.
- Entwicklung des Kindheitsverständnisses in verschiedenen historischen Epochen
- Veränderungen in den Erziehungszielen und -methoden
- Einfluss von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren auf Kindheit und Erziehung
- Kritik an aktuellen Erziehungsmodellen und -debatten
- Relevanz der Geschichte von Kindheit und Erziehung für das heutige Verständnis von Kindsein und Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Kindheitsverständnisses von der vorbürgerlichen Gesellschaft bis zum 21. Jahrhundert. Es analysiert die unterschiedlichen Kindbilder und die prägenden Einflüsse auf die jeweilige Wahrnehmung von Kindheit. Das dritte Kapitel widmet sich der Geschichte der Erziehung, beginnend mit der Antike und endend mit dem 21. Jahrhundert. Es beschreibt die Entwicklung von Erziehungszielen, -methoden und -institutionen.
Das vierte Kapitel beleuchtet aktuelle Erziehungsdebatten und -modelle, die sich mit dem Wandel von Kindheit und Erziehung auseinandersetzen. Es analysiert verschiedene Ansätze und ihre Kritikpunkte. Das fünfte Kapitel bietet eine Schlussbetrachtung, die die Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst und die Relevanz der historischen Perspektive für das heutige Verständnis von Kindheit und Erziehung herausstreicht.
Schlüsselwörter
Kindheit, Erziehung, Geschichte, Wandel, Kindheitsbild, Erziehungsziele, Erziehungsmethoden, Reformpädagogik, Nationalsozialismus, Aufklärung, Moderne, Postmoderne, Gesellschaft, Kultur, Bildung, Familie, Schule, Identität, Entwicklung, Kritik, Debatte.
- Citar trabajo
- Carolin Zauner (Autor), 2015, War denn früher alles besser? Kindheit und Erziehung früher und heute, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306719