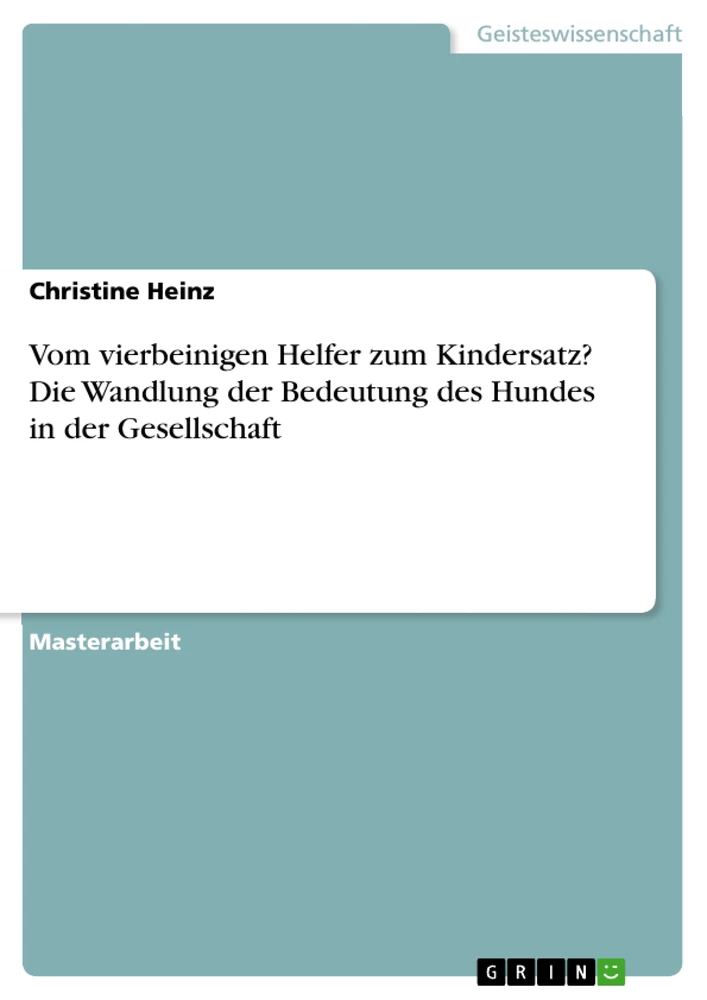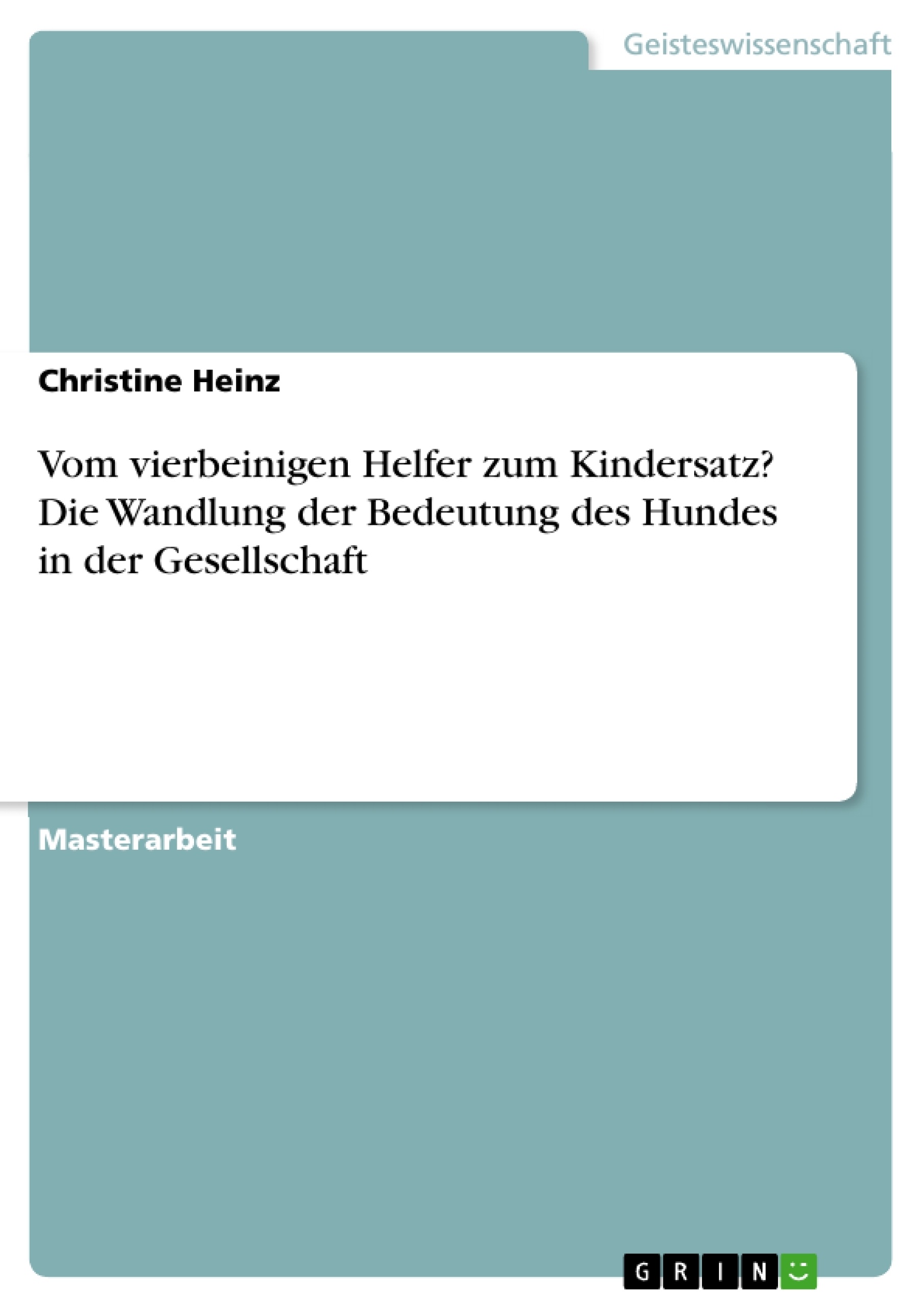Die Bezeichnung „der beste Freund des Menschen“ kommt nicht aus dem Nichts. Ihr liegen Jahrhunderte voller Zuneigung und gegenseitigen Nutzen zugrunde. Jedoch ist der Hund des 21. Jahrhunderts nur noch bedingt mit seinen früheren Artgenossen und gar seinem Vorfahren, dem Wolf, vergleichbar. Waren Hunde früher hauptsächlich Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie dem Hüten von Vieh, dem Bewachen von Haus und Hof oder der Jagd, sind sie heute zunehmend reine Familienmitglieder. Heute herrscht gut erkennbar eine andere Situation vor. Der Hund hat einen anderen Stellenwert erhalten. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der veränderten Bedeutung des Hundes in der heutigen Gesellschaft. Untersucht wurde unter anderem die Frage, ob der moderne Hund nicht nur Haustier sondern vielmehr Kindersatz ist.
Das erste Kapitel befasst sich mit den Theorien und Sichtweisen von Norbert Elias und Gerhard Schulze. Bei Elias steht besonders die Zivilisationstheorie im Fokus.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Domestizierung und späteren gezielten Zucht verschiedener Rassen.
In Kapitel drei soll die Vermenschlichung des Hundes anhand verschiedener Beispiele aus dem Alltag analysiert werden. Thematisiert wird unter anderem, was Namen heute aussagen und welche Rolle Hunde in sozialen Netzwerken spielen.
Weiterhin steht der Hund als Wirtschaftsfaktor im Fokus. Außerdem beleuchtet ein Exkurs das paradoxe Verhältnis von Mensch und Tier. Hier wird die Frage thematisiert, warum Nutztiere täglich getötet und gegessen werden, während dies bei Haustieren wie Hund und Katze nicht vorstellbar ist.
Kapitel vier ist meiner eigenen Erhebung gewidmet. Mit einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden soll die eingangs aufgestellte These untersucht werden. Mithilfe von Tabellen und Grafiken werden die erzielten Forschungsergebnisse veranschaulicht. Hier soll erläutert werden, wie Hunde noch besser in den Alltag ihrer Besitzer integriert werden könnten und welche Tendenzen sich bereits jetzt erkennen lassen.
Mit den Ansprüchen und Anforderungen, denen sich Hunde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten konfrontiert sehen, befasst sich Kapitel fünf.
Kapitel sechs fasst alle wichtigen Punkte dieser Arbeit noch einmal zusammen und gibt einen Überblick über die vorausgegangen Kapitel. Ein persönliches Fazit schließt diese Thesis ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretische Rahmung
- 1.1 Norbert Elias – Zivilisationstheorie
- 1.1.1 Zum Begriff der Zivilisation
- 1.1.2 Selbstzwang und Fremdzwang
- 1.1.3 Bezug zur Fragestellung
- 1.1.4 Zwischenfazit und Ausblick
- 1.2 Gerhard Schulze – Die Erlebnisgesellschaft
- 1.2.1 Wandel des Alltagslebens
- 1.2.2 Fünf verschiedene soziale Milieus
- 1.2.3 Bezug zur Fragestellung
- 1.2.4 Fazit und Ausblick
- 2. Wie der Hund zum Haustier wurde
- 2.1 Vorfahre Wolf
- 2.2 Die Domestikation
- 2.3 Zucht
- 2.4 Die Schattenseite der gezielten Selektion
- 3. Wie der Hund zum Menschen wird
- 3.1 Aktueller Forschungsstand und Überblick über das Feld
- 3.2 Der Hund als Wirtschaftsfaktor
- 3.3 Die zunehmende Vermenschlichung des Hundes anhand verschiedener Beispiele
- 3.4 Exkurs: Heimtier versus Nutztier – ein Paradoxon
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Eigene Erhebung
- 4.1 Qualitative Methode: Beobachtung
- 4.1.1 These und Fragestellung
- 4.1.2 Setting und Feld
- 4.1.3 Dokumentation und Auswertung
- 4.1.4 Zusammenfassung und Zwischenfazit
- 4.2 Quantitative Methode: Fragebogen
- 4.2.1 Konzipierung und Forschungsprozess
- 4.2.2 Auswertung
- 4.2.3 Evaluation
- 4.2.4 Zusammenfassung und Fazit
- 5. Der Hund in der Zukunft
- 5.1 Die Folgen der Vermenschlichung
- 5.2. Der Hund in der modernen Arbeitswelt
- 5.3 Einflüsse von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf das Zusammenleben
- 5.4 Zurück zu den Wurzeln – zumindest teilweise
- 5.5 Welche Hunde brauchen wir in der Zukunft?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der veränderten Bedeutung des Hundes in der heutigen Gesellschaft. Die Frage, ob der moderne Hund nur noch Haustier, sondern vielmehr Kindersatz ist, steht im Fokus.
- Die Zivilisationstheorie von Norbert Elias und die Veränderungen der Gesellschaft.
- Die Erlebnisgesellschaft nach Gerhard Schulze und ihre Auswirkungen auf die Mensch-Tier-Beziehung.
- Die Domestizierung des Wolfes und die Entstehung verschiedener Hunderassen durch gezielte Zucht.
- Die zunehmende Vermenschlichung des Hundes durch Konsum von Produkten und gemeinsamen Erlebnissen.
- Die Bedeutung des Hundes als Wirtschaftsfaktor und die ökonomische Rolle der Hundehaltung in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich den Theorien von Norbert Elias und Gerhard Schulze. Anhand ihrer Arbeiten zur Zivilisierung und Erlebnisgesellschaft sollen die Gründe für den Bedeutungswandel des Hundes erläutert werden. Das zweite Kapitel beschreibt den Prozess der Domestizierung des Wolfes sowie die spätere Zucht verschiedener Rassen. Dabei stehen vor allem die Veränderungen im Erscheinungsbild und Verhalten des Hundes im Vordergrund. Im dritten Kapitel werden die Folgen der Vermenschlichung des Hundes anhand verschiedener Beispiele aus dem Alltag beleuchtet, unter anderem der Wandel der Namensgebung und die mediale Präsenz von Hunden in sozialen Netzwerken. Darüber hinaus wird das paradoxe Verhältnis zwischen Mensch und Tier in einem Exkurs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Zivilisationstheorie, Erlebnisgesellschaft, Domestizierung, Zucht, Vermenschlichung, Hundehaltung, Wirtschaftsfaktor, Mensch-Tier-Beziehung, Heimtier, Nutztier, Animal Studies, Hundeschule, Beobachtung, Fragebogen, Hund in der Zukunft, Hundeführerschein, Qualzucht.
- Quote paper
- Christine Heinz (Author), 2014, Vom vierbeinigen Helfer zum Kindersatz? Die Wandlung der Bedeutung des Hundes in der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305844