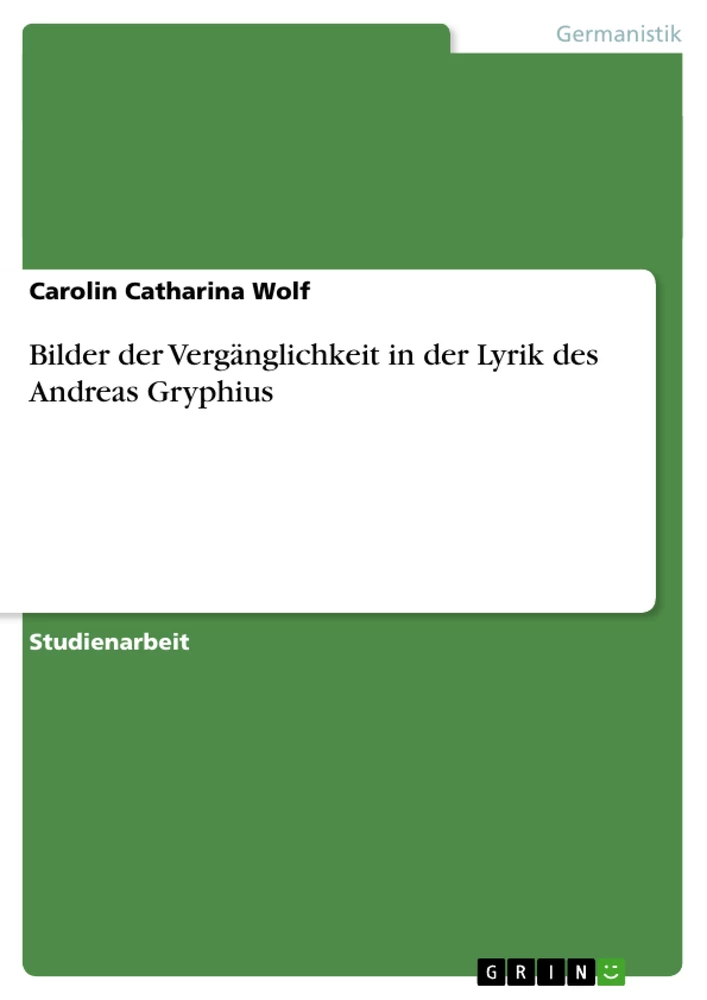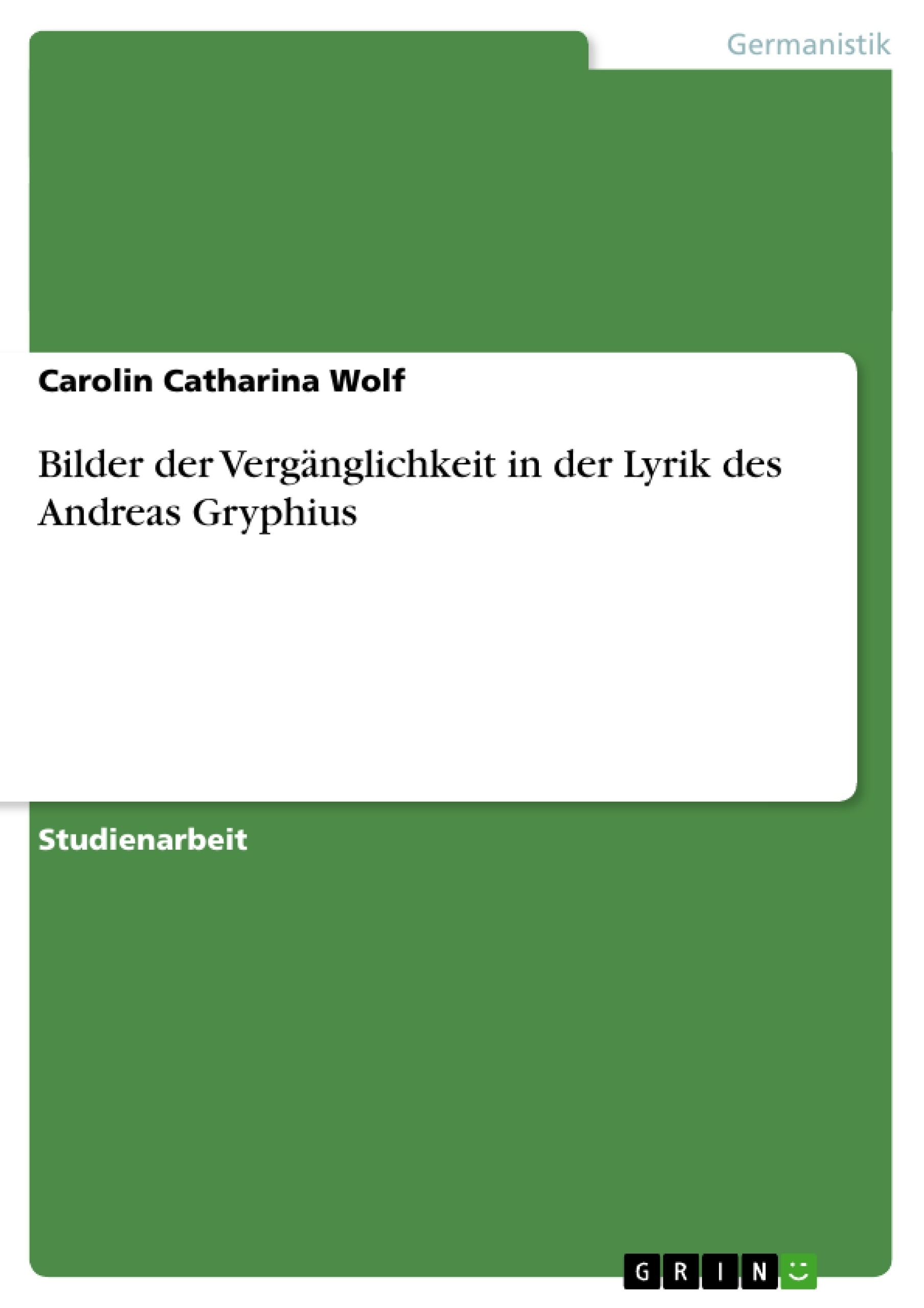Das seit dem frühen Mittelalter verbreitete und vor allen Dingen die Barockdichtung kennzeichnende Vanitas- Motiv findet seinen Ursprung im Alten Testament: „vanitas vanitatum, et omnia vanitas“ (lat.: “Eitelkeit der Eitelkeiten, und alles ist eitel”, oder “Alles ist eitel”) so lautet das Zitat aus Prediger Salomo 1,2 und 12,8.
Die auch von Hiob und den Psalmen verkündete Vergänglichkeit hält dem Menschen die Vergeblichkeit all seines Strebens, die Nutzlosigkeit von Macht, Ruhm, Geld, Wissen, Können, Schönheit und Glück, im Hinblick auf die Allmacht des Todes vor Augen und betrachtet den Tod selbst als integralen Bestandteil des Lebens.
Als wohl bedeutendsten vanitatischen Lyriker kann man Andreas Gryphius (1616- 1664) bezeichnen: Die Not des 17. Jahrhunderts hat in seiner Dichtung Spuren hinterlassen, denn als Kind seiner Zeit hatte er sehr früh das Leid von Krieg und Krankheit am eigenen Leib erfahren. Für die in der Vergänglichkeitsmetaphorik typische provozierende Gegenüberstellung von Leben und Tod in einem Bild hat er sich ein Repertoire an Motiven angeeignet, welche im Folgenden- insbesondere auch am Beispiel seiner Gedichte „Es ist alles eitel“ und „Menschliches Elende“ - ausgeführt werden sollen.
Des Weiteren finden die politischen und gesellschaftlichen Umstände des Barock Erläuterung, aber auch das „Carpe diem“ und der Tod als Positivum werden näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Das Vanitas-Motiv
- II. Vergänglichkeitsmetaphorik und Bildarsenal
- III. Wirkung und Interessen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Vanitas-Motivs in der Lyrik von Andreas Gryphius. Ziel ist es, Gryphius' Vergänglichkeitsmetaphorik zu analysieren und deren Wirkung im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Umstände des Barock zu beleuchten.
- Das Vanitas-Motiv im Barock
- Gryphius' Vergänglichkeitsmetaphorik
- Die Rolle von Krieg und Krankheit in Gryphius' Werk
- Wiederkehrende Motive und Bilder
- Wirkung und Interpretation von Gryphius' Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Das Vanitas-Motiv: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung des Vanitas-Motivs im Alten Testament und erläutert dessen Bedeutung im Kontext des Barocks. Es wird gezeigt, wie die existentiellen Ängste und Todeserfahrungen des 17. Jahrhunderts, geprägt vom Dreißigjährigen Krieg und Pestepidemien, das Vanitas-Motiv in der Literatur und Kunst verstärkten. Die soziale Ungerechtigkeit und die Umbrüche in gesellschaftlichen und religiösen Strukturen werden als weitere Faktoren für die Verbreitung des Motivs genannt. Der Abschnitt endet mit der Vorstellung von Andreas Gryphius als einem der bedeutendsten Vertreter des vanitastischen Expressionismus in der deutschen Lyrik und verbindet die existenzielle Not des 17. Jahrhunderts mit der individuellen Lebenserfahrung des Autors. Der Fokus liegt auf der Verbindung von religiöser Kontemplation und der sinnlichen Erfahrung des Lebens als Reaktion auf das Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit.
II. Vergänglichkeitsmetaphorik und Bildarsenal: Das Kapitel analysiert Gryphius' Vergänglichkeitsmetaphorik und sein Repertoire an Motiven. Es wird aufgezeigt, wie Gryphius wiederkehrende Bilder und Allegorien verwendet, um das Thema Vanitas darzustellen. Die Arbeit verweist auf die Bibel als eine Quelle für seine Metaphorik, behandelt aber auch die Frage nach weiteren Einflüssen, wie der Patristik, der mittelalterlichen Allegorese oder der Emblematik des Barock, die aber für Gryphius' Werk nicht nachweisbar sind. Stattdessen wird Gryphius' eigenständige Verwendung und Potenzierung der biblischen Motive im Kontext des Barocks herausgestellt und als Summe und Verstärkung aller bestehenden Motive interpretiert.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Vanitas, Barocklyrik, Vergänglichkeit, Todesmotiv, Memento Mori, Metaphorik, Bildarsenal, Dreißigjähriger Krieg, Existenzialismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Vanitas-Motivs in der Lyrik Andreas Gryphius'
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Vanitas-Motivs in der Lyrik von Andreas Gryphius. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Gryphius' Vergänglichkeitsmetaphorik und deren Wirkung im Kontext des Barock, unter Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen Umstände dieser Epoche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Vanitas-Motiv im Barock, Gryphius' Vergänglichkeitsmetaphorik, die Rolle von Krieg und Krankheit in Gryphius' Werk, wiederkehrende Motive und Bilder in seinen Gedichten und die Wirkung und Interpretation seiner Werke. Der Ursprung des Vanitas-Motivs im Alten Testament und dessen Bedeutung im Kontext des Barocks wird ebenso beleuchtet wie die existentiellen Ängste und Todeserfahrungen des 17. Jahrhunderts, die das Motiv verstärkten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I ("Das Vanitas-Motiv") untersucht den Ursprung und die Bedeutung des Vanitas-Motivs im Barock, insbesondere im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und der Pestepidemien, und stellt Andreas Gryphius als bedeutenden Vertreter des vanitastischen Expressionismus vor. Kapitel II ("Vergänglichkeitsmetaphorik und Bildarsenal") analysiert Gryphius' Verwendung von Metaphern und Bildern zur Darstellung des Vanitas-Motivs und untersucht die Quellen seiner Bildsprache, wobei der Fokus auf der eigenständigen Verwendung und Potenzierung biblischer Motive liegt. Die Arbeit enthält keine Kapitelzusammenfassung für Kapitel III ("Wirkung und Interessen"), der im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist aber im Preview nicht weiter erklärt wird.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verweist auf die Bibel als eine Quelle für Gryphius' Metaphorik. Einflüsse der Patristik, der mittelalterlichen Allegorese oder der Emblematik des Barock werden zwar erwähnt, jedoch als für Gryphius' Werk nicht nachweisbar ausgeschlossen. Stattdessen wird Gryphius' eigenständige Verwendung und Potenzierung der biblischen Motive hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Andreas Gryphius, Vanitas, Barocklyrik, Vergänglichkeit, Todesmotiv, Memento Mori, Metaphorik, Bildarsenal, Dreißigjähriger Krieg, Existenzialismus.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Carolin Catharina Wolf (Author), 2004, Bilder der Vergänglichkeit in der Lyrik des Andreas Gryphius, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30563