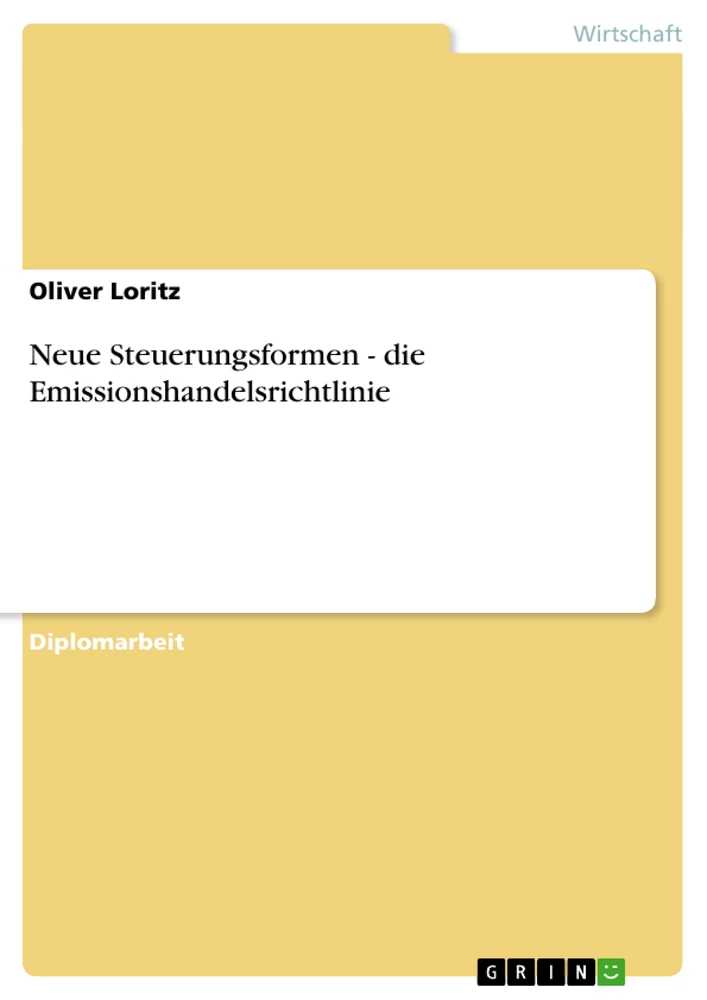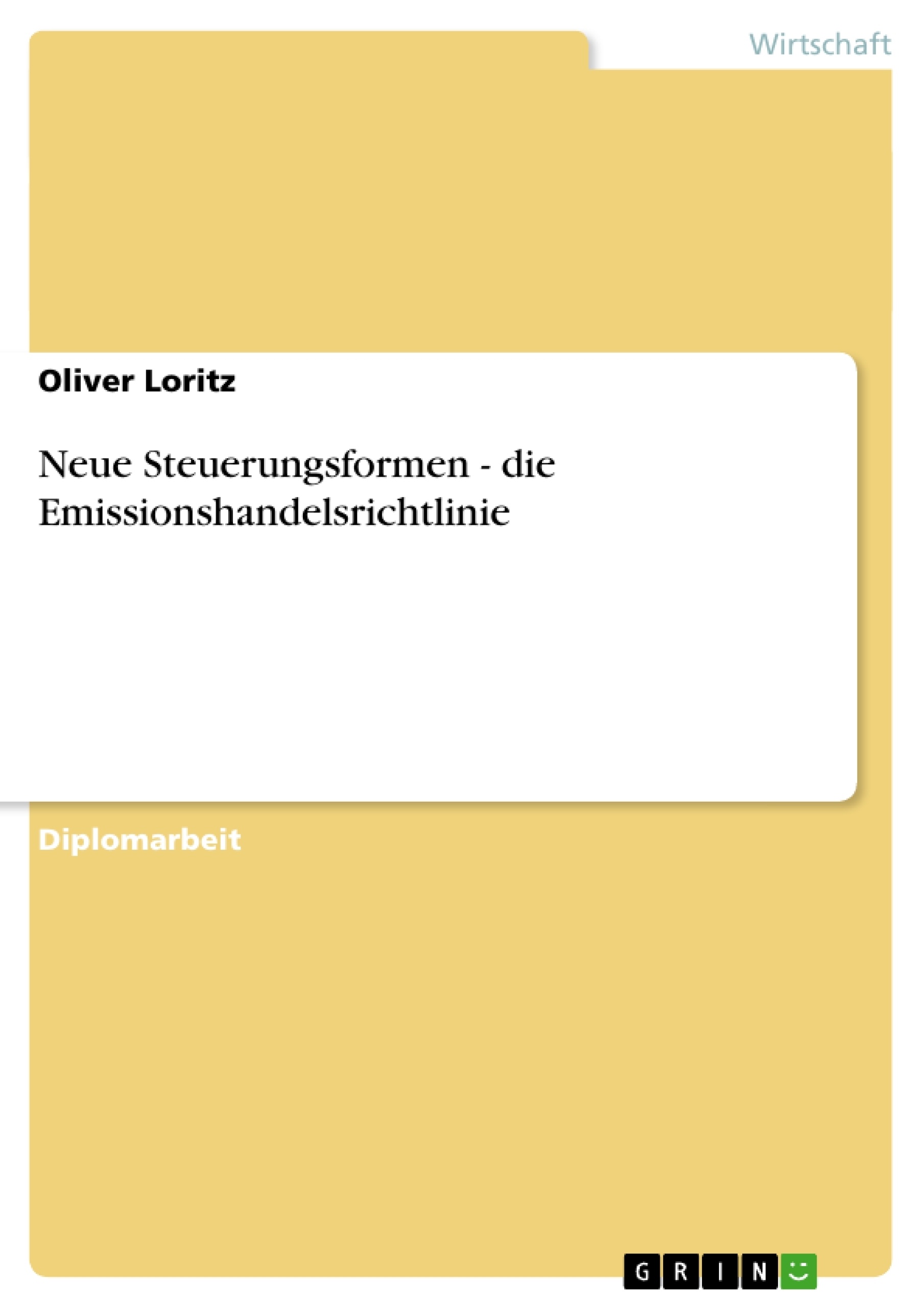Durch das Protokoll von Kyoto wurde ein Vorgang eingeleitet der erstmals in der
Geschichte der Menschheit aktive Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene bewirken
kann. Primäres Ziel ist die Reduzierung des Treibhauseffektes auf ein für den
Menschen akzeptables Niveau. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union leisten
ihren Beitrag zum Klimaschutz durch die Verpflichtung zur Begrenzung ihrer Treibhausgasemissionen.
Die Umsetzung dieser Verpflichtung findet gegenwärtig statt.
Mit der Richtlinie 2003/87/EG der Kommission wird ab dem Jahr 2005 ein System
für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft eingeführt.
Es handelt sich dabei um eine Instrument mit dem umweltpolitische Ziele
möglichst kostengünstig und ohne Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung
erreicht werden sollen Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind zur
Zeit mit der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht befasst. Dies gibt Anlass
zu der Frage nach den tatsächlichen Erfolgsaussichten des Instruments und den Problemen,
die bei der Umsetzung der Richtlinie entstehen können. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit der Analyse des Steuerungsinstrumentes unter verschiedenen
Gesichtspunkten. Im Verlauf der Arbeit wird zunächst der umweltpolitische Hintergrund
beleuchtet, um das Verständnis für die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen
zu wecken. Anschließend wird das Grundmodell handelbarer Umweltzertifikate
erläutert, auf das der EU-weite Emissionshandel zurückgeht. Das Verständnis
des Modells ist für die Nachvollziehbarkeit der Regelungen der Richtlinie
unverzichtbar. Die im Grundlagenkapitel angeführten Bewertungsmaßstäbe bilden
den argumentativen Rahmen für die Beurteilung der Richtlinie. Im zweiten Kapitel
werden die Regelungen der Richtlinie vorgestellt und diskutiert. Die Darstellung der
Umsetzung in nationales Recht findet im dritten Kapitel statt. Schwerpunkt sind hier
die Bestimmungen für die Zuteilung der Berechtigungen an die Anlagenbetreiber.
Sie werden bei den Untersuchungen in Kapitel vier ebenfalls von Bedeutung sein.
Das vierte Kapitel setzt sich mit der rechtlichen Bewertung der Bestimmungen des
Emissionshandelssystems auseinander. Hier werden insbesondere verschiedener materiell-
rechtliche Probleme behandelt, die sich aus der Einführung des Handelssystems
ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- KAPITEL 1: GRUNDLAGEN
- 1.1 Treibhausgasemissionen und Klimawandel
- 1.1.1 Der Treibhauseffekt - Naturwissenschaftliche Grundlagen
- 1.1.2 Der Klimawandel und die Folgen
- 1.1.3 Klimapolitische Herausforderungen
- 1.2 Das Kyoto-Protokoll
- 1.2.1 Hintergründe und wesentliche Bestimmungen
- 1.2.2 Ratifikation und Geltungsbereich
- 1.2.3 Flexible Mechanismen
- 1.2.4 Senken
- 1.3 Umweltpolitische Instrumente
- 1.3.1 Arten und Grundprinzipien
- 1.3.2 Das Modell handelbarer Umweltverschmutzungsrechte
- KAPITEL 2: DIE EMISSIONSHANDELSRICHTLINIE
- 2.1 Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll
- 2.2 Europarechtliche Legitimation
- 2.3 Wesentliche Bestimmungen
- 2.3.1 Inhalt und Ziele
- 2.3.2 Geltungsbereich
- 2.3.3 Zuteilung von Zertifikaten (Primärallokation)
- 2.3.4 Überwachung und Berichterstattung (Monitoring)
- 2.3.5 Eigenschaften der Zertifikate
- 2.3.6 Der Emissionshandel (Sekundärallokation)
- 2.3.7 Berücksichtigung von flexiblen Mechanismen
- KAPITEL 3: UMSETZUNG IN NATIONALES RECHT
- 3.1 Stand der Umsetzung
- 3.2 Gesetzliche Umsetzung
- 3.2.1 Allgemeines
- 3.2.2 Genehmigung
- 3.2.3 Berechtigungen (Zertifikate)
- 3.2.4 Primärallokation
- 3.2.5 Monitoring
- 3.2.6 Sanktionen
- 3.2.7 Pooling
- 3.3 Institutionelle Umsetzung
- 3.4 Der Nationale Allokationsplan
- 3.4.1 Allgemeines
- 3.4.2 Makroplan
- 3.4.3 Mikroplan
- 3.4.4 Allgemeine Allokationsregeln
- 3.4.5 Spezielle Allokationsregeln
- KAPITEL 4: RECHTLICHE BEWERTUNG
- 4.1 Überblick
- 4.2 Vereinbarkeit mit bestehendem Ordnungsrecht
- 4.2.1 Allgemeines
- 4.2.2 Grenzwertproblematik
- 4.2.3 Energieeffizienzgebot
- 4.2.4 Vorsorgeprinzip
- 4.2.5 Genehmigung
- 4.3 Vereinbarkeit mit nicht-ordnungsrechtlichen Instrumenten des Klimaschutzes
- 4.3.1 Freiwillige Selbstverpflichtung
- 4.3.2 Ökosteuer
- 4.4 Verfassungsrechtliche Aspekte
- 4.5 Rechtsschutz
- 4.5.1 Streitgegenstände
- 4.5.2 Gesetze
- 4.5.3 Rechtsverordnungen
- 4.5.4 Verwaltungsakte
- 4.5.5 Realakte
- 4.5.6 Allokationspläne
- KAPITEL 5: ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Emissionshandelsrichtlinie und untersucht deren rechtliche Rahmenbedingungen. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht und die rechtliche Bewertung der Emissionshandelsrichtlinie im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit bestehendem Recht sowie ihre verfassungsrechtlichen Aspekte.
- Rechtliche Grundlagen des Emissionshandels
- Umsetzung der Emissionshandelsrichtlinie in nationales Recht
- Rechtliche Bewertung der Emissionshandelsrichtlinie
- Verfassungsrechtliche Aspekte des Emissionshandels
- Ziele und Herausforderungen des Emissionshandels
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Grundlagen des Klimawandels und der Treibhausgasemissionen. Es werden die Ursachen des Klimawandels, die Folgen für die Umwelt und die Gesellschaft sowie die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels erläutert. Das Kyoto-Protokoll wird als ein wichtiges internationales Abkommen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen vorgestellt und seine wesentlichen Bestimmungen sowie flexible Mechanismen werden diskutiert. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Emissionshandelsrichtlinie, die ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls in der Europäischen Union darstellt. Die Richtlinie soll den Emissionshandel von Treibhausgasen in der EU regulieren und so zur Reduktion dieser Emissionen beitragen. Die Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen, die Ziele und den Geltungsbereich der Richtlinie sowie die wichtigsten Bestimmungen zur Zuteilung von Emissionszertifikaten, der Überwachung und Berichterstattung und dem Emissionshandel selbst. Kapitel 3 befasst sich mit der Umsetzung der Emissionshandelsrichtlinie in nationales Recht. Es werden die verschiedenen Aspekte der Umsetzung, wie z.B. die gesetzliche und institutionelle Umsetzung, der Nationale Allokationsplan und die verschiedenen Regelungen zur Zuteilung von Emissionszertifikaten, dargestellt. Kapitel 4 analysiert die rechtliche Bewertung der Emissionshandelsrichtlinie. Die Kapitel untersucht die Vereinbarkeit der Richtlinie mit bestehendem Ordnungsrecht, nicht-ordnungsrechtlichen Instrumenten des Klimaschutzes und die verfassungsrechtlichen Aspekte der Richtlinie. Das Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen des Emissionshandels.
Schlüsselwörter
Emissionshandelsrichtlinie, Kyoto-Protokoll, Treibhausgasemissionen, Klimawandel, Umweltpolitik, Rechtliche Bewertung, Verfassungsrecht, Internationale Zusammenarbeit, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der EU-Emissionshandelsrichtlinie?
Das Ziel ist die kostengünstige Reduzierung von Treibhausgasemissionen, um die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen, ohne die wirtschaftliche Entwicklung massiv zu bremsen.
Wie funktioniert das System der Emissionszertifikate?
Unternehmen erhalten oder kaufen Berechtigungen für eine bestimmte Menge CO2. Wer weniger emittiert, kann Zertifikate verkaufen; wer mehr emittiert, muss zusätzliche Zertifikate am Markt erwerben (Cap & Trade).
Was ist ein Nationaler Allokationsplan (NAP)?
Ein NAP legt fest, wie viele Emissionsberechtigungen ein Mitgliedstaat insgesamt ausgibt und nach welchen Regeln diese auf die einzelnen Anlagenbetreiber verteilt werden.
Welche rechtlichen Probleme gibt es bei der Umsetzung?
Es gibt Konflikte mit bestehendem Ordnungsrecht (z.B. immissionsschutzrechtliche Grenzwerte), Fragen der Verfassungsmäßigkeit der Zuteilung und Probleme beim Rechtsschutz gegen Allokationsentscheidungen.
Was bedeutet das "Vorsorgeprinzip" im Klimaschutz?
Es besagt, dass bereits im Vorfeld Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltschäden getroffen werden müssen, auch wenn noch letzte wissenschaftliche Unsicherheiten über das genaue Ausmaß bestehen.
Was passiert bei Verstößen gegen die Richtlinie?
Unternehmen, die nicht genügend Zertifikate für ihre tatsächlichen Emissionen vorweisen können, müssen hohe Sanktionen (Bußgelder) zahlen und die fehlenden Zertifikate im Folgejahr nachliefern.
- Citar trabajo
- Oliver Loritz (Autor), 2004, Neue Steuerungsformen - die Emissionshandelsrichtlinie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30543