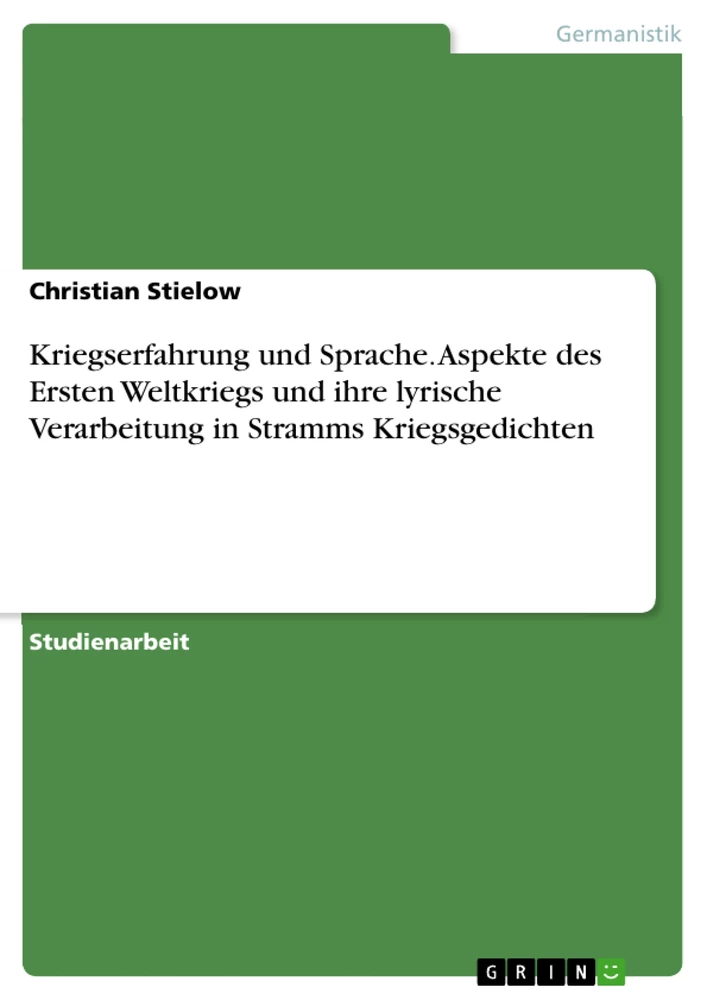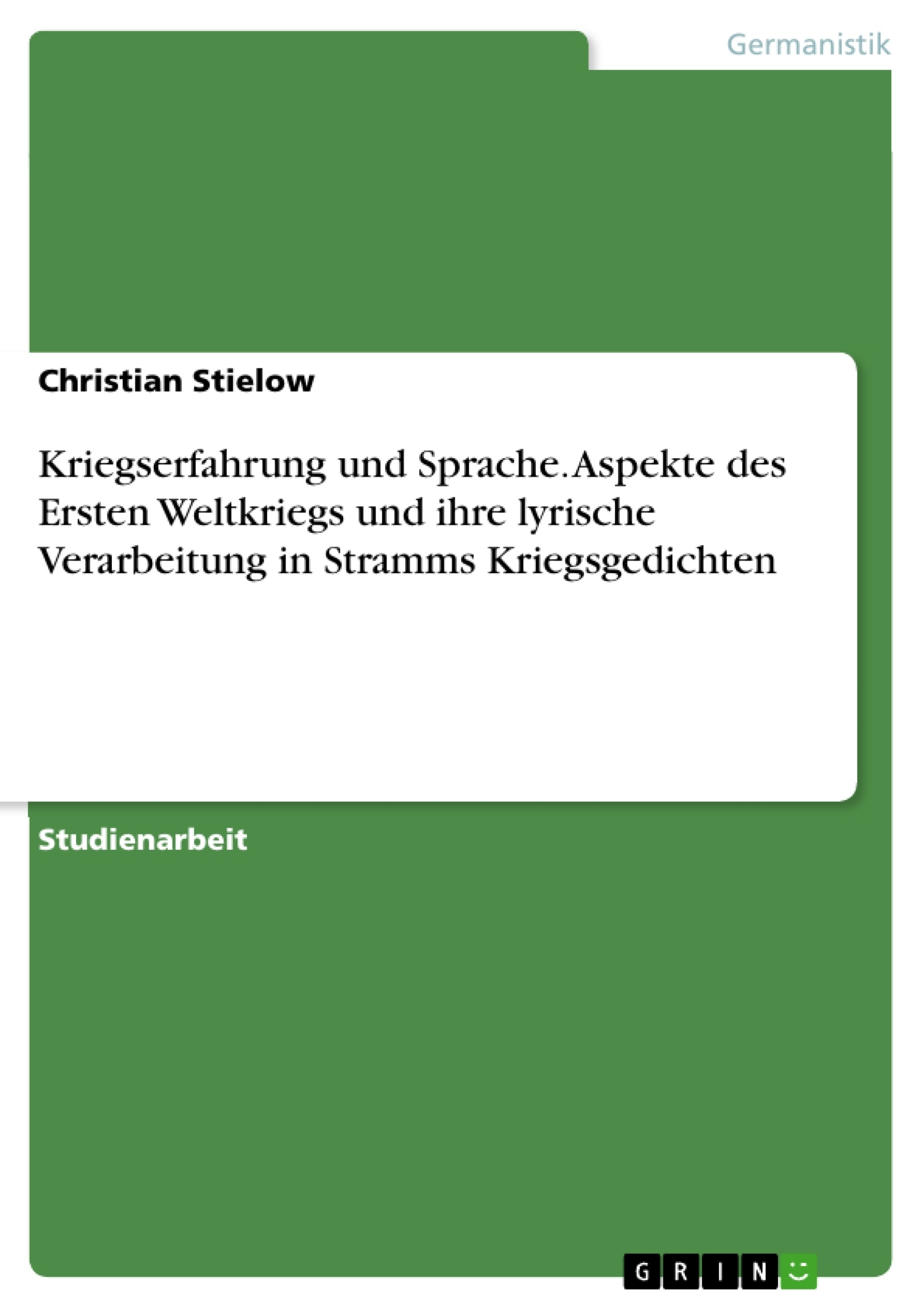August Stramms Kriegsgedichte stechen schon aufgrund ihrer formalen Besonderheit aus dem überwiegenden Teil der Weltkriegslyrik hervor: Einwortzeilen, Reduktion von Worten auf den Wortstamm, Neologismenbildung, Verwendung ungewöhnlicher Komposita, Infinitivreihungen sowie weitestgehender Verzicht auf grammatikalische Korrektheit sind nur einige Merkmale seiner Gedichte. Dabei deutet Stramms biografischer Hintergrund zunächst wenig auf seine „eigenwillige Sprachgestaltung“ hin.
August Stramm wurde 1874 im westfälischen Münster geboren und war damit deutlich älter als seine expressionistischen Dichterkollegen. Es war jedoch nicht nur Stramms Alter, das ihn von den anderen Expressionisten unterschied; im Gegensatz zu diesen war er fest im bürgerlichen Leben etabliert. Er machte Karriere der Reichspostverwaltung, heiratete eine Journalistin und Unterhaltungsschriftstellerin und war aktiv in der militärischen Reserve. Vom Einjährig-Freiwilligendienst über den Leutnantsgrad stieg er 1913 zum Hauptmann auf, der höchsten Stellung eines Reserveoffiziers. Mit Kriegsbeginn wurde Stramm umgehend eingezogen. Er diente zunächst im Elsass, bevor er im Frühjahr 1915 an die Ostfront versetzt wurde. Am 1. September 1915 fiel Stramm bei Kämpfen am Bug bei Horodec im heutigen Weißrussland.
In der vorliegenden Arbeit geht der Autor der Frage nach, inwieweit Stramms Kriegserlebnisse sich auf seine Lyrik ausgewirkt haben. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kriegserfahrung und Sprache Stramms? Auf welche thematische Weise nähert sich der Autor dem Krieg? Und welche historischen Hintergründe des Krieges finden sich in seinem Werk?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Interpretationen
- Werttod
- Patrouille
- Angriff
- Granaten
- Frage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Kriegserfahrungen August Stramms auf seine Lyrik. Sie geht der Frage nach, ob und wie sich die Kriegserfahrung in der Sprache Stramms niederschlägt und welche thematischen Aspekte des Krieges in seinen Gedichten verarbeitet werden.
- Zusammenhang zwischen Kriegserfahrung und Sprache
- Thematische Annäherung an den Krieg in Stramms Gedichten
- Historische Hintergründe des Krieges in Stramms Werk
- Analyse der formalen Besonderheiten der Kriegsgedichte Stramms
- Vergleich der Kriegsgedichte hinsichtlich ihrer thematischen und formalen Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit analysiert fünf repräsentative Gedichte Stramms: "Werttod", "Patrouille", "Angriff", "Granaten" und "Frage". Diese Gedichte wurden ausgewählt, um die drei verschiedenen Kriegsschauplätze Stramms (Elsass, Somme, Ostfront) exemplarisch abzudecken und zu untersuchen, ob eine Entwicklung in Stramms Sichtweise auf den Krieg erkennbar ist.
Die Interpretation der Gedichte fokussiert auf ihre Form und ihren Inhalt, um im Fazit einen Vergleich zwischen den Werken zu ziehen, typische Merkmale in Stramms Werk herauszustellen und seine Gedichte in den Kontext des Kriegsgeschehens zu setzen. Die Arbeit befasst sich mit Stramms Einsatzformen im Krieg (Etappe, Stellungskrieg, Bewegungskrieg) und den Herausforderungen, die sich aus der Zeitknappheit für das Schreiben von Gedichten ergaben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit August Stramms Kriegsgedichten und beleuchtet die spezifische Sprache des Dichters, die von Einwortzeilen, Wortstammreduktion, Neologismen und ungewöhnlichen Komposita geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen die Analyse von Kriegserfahrungen und ihrer literarischen Verarbeitung, die Untersuchung der formalen Besonderheiten der Kriegsgedichte sowie die Berücksichtigung der historischen Hintergründe des Ersten Weltkriegs.
- Quote paper
- Christian Stielow (Author), 2015, Kriegserfahrung und Sprache. Aspekte des Ersten Weltkriegs und ihre lyrische Verarbeitung in Stramms Kriegsgedichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305298