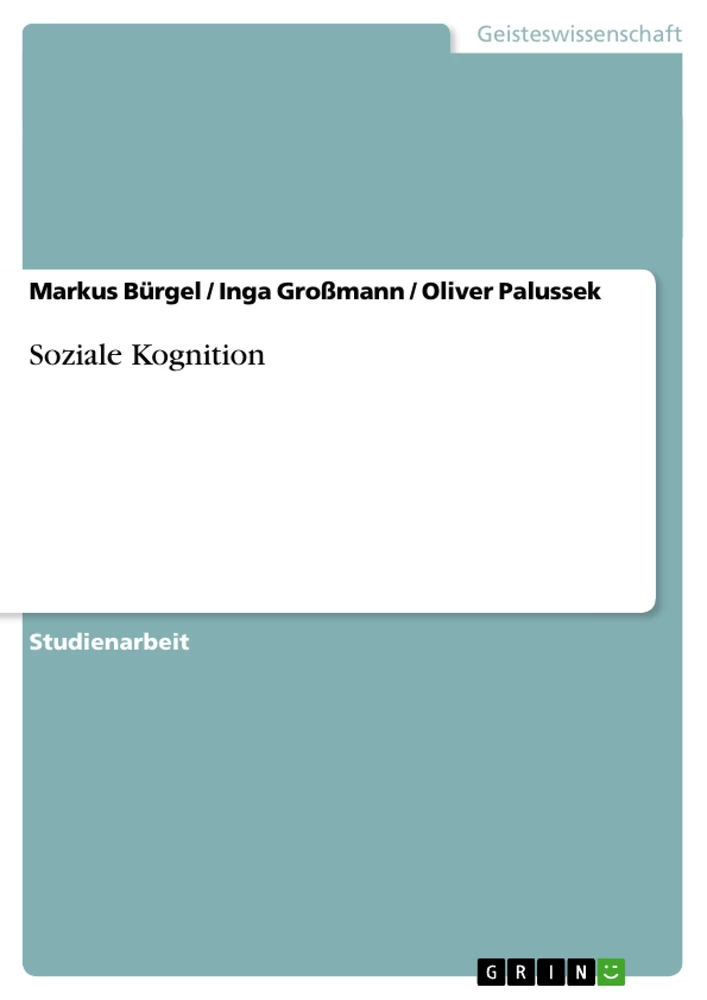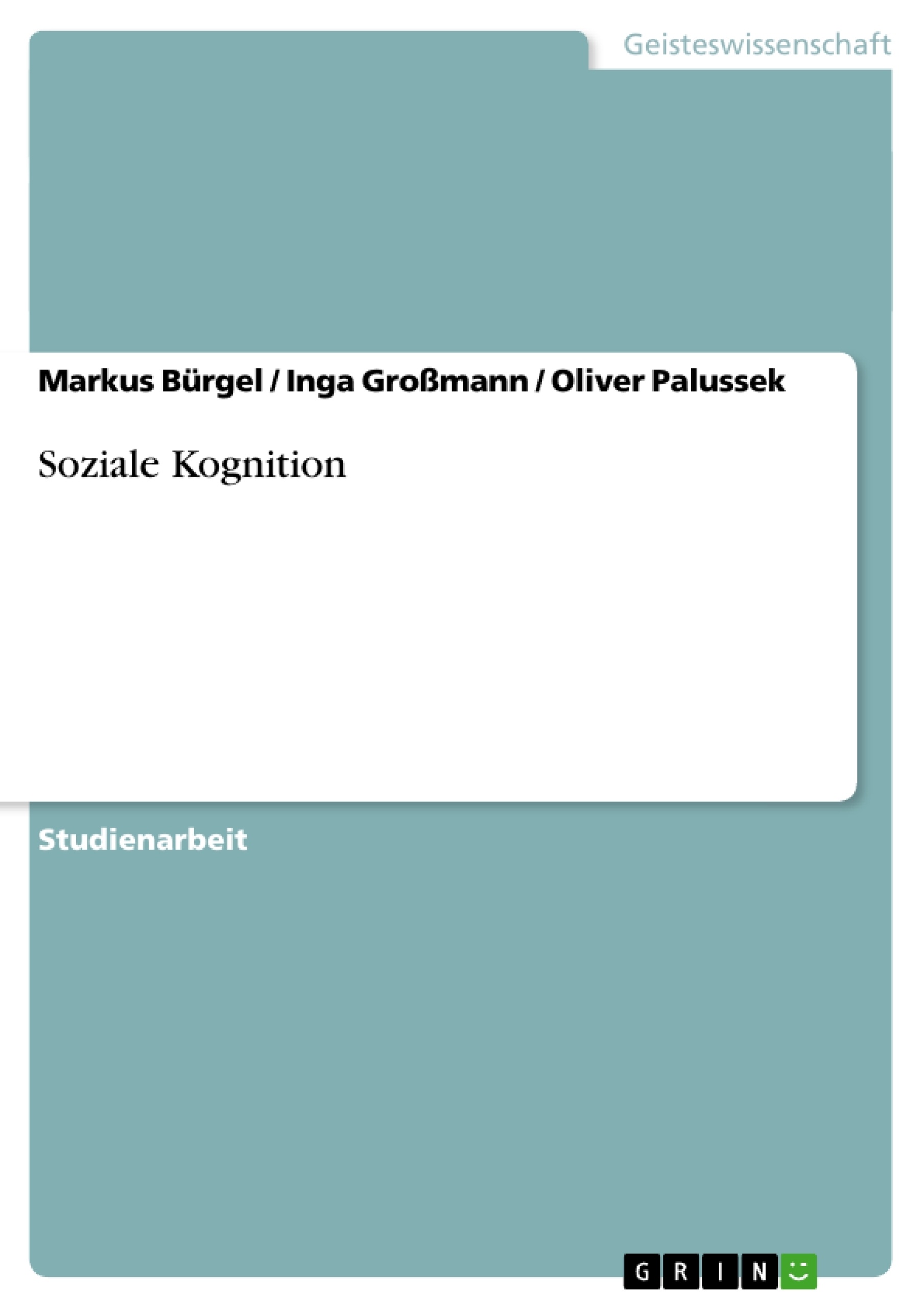Henri Tajfel sagt: „Der größte Anpassungsvorteil des Menschen liegt in der Fähigkeit, sein Verhalten danach auszurichten, wie er eine Situation wahrnimmt und versteht“.
Damit ist man dem Kern der sozialen Kognition bereits auf den Fersen. Es geht darum, dass die eigene Reaktion von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und nicht stur nach einem vorgegebenen Muster abläuft.
Der Mensch ist geprägt von Vorstellungen, Wahrnehmungen und Stereotypen. Er reagiert individuell und verschieden. Soziales Verhalten wird demnach nicht direkt von Reizen bestimmt, sondern überwiegend durch die innere Auseinandersetzung mit dem Gehörten, Gesehenen und Erlebten.
Von daher ist es wichtig, zu begreifen, wie „Individuen ihre subjektive Realität konstruieren“ , denn nur dann kann verstanden werden, was soziales Verhalten eigentlich ist. Dies ist auch die Kernfrage der sozialen Kognition, bei der es darum geht, soziales Wissen und kognitive Prozesse zu untersuchen .
Ziel der sozialen Kognition ist es also, die verschiedenen Prozesse, die zu einer Meinungsbildung führen, kenntlich zu machen. Es soll herausgefunden werden, „wie Informationen enkodiert, gespeichert und aus dem Gedächtnis abgerufen werden.“
Durch die Vielzahl von Prozessen, die in der sozialen Kognition eine Rolle spielen, hat sich dieses Gebiet der Sozialpsychologie zu einem der beliebtesten Forschungsgebiete entwickelt. Im Besonderen spielen hier Einstellungsänderung, Attributionsforschung und Stereotype eine herausragende Rolle.
Wichtig ist auch, dass sich die Forscher keineswegs nur für Fakten interessieren. So sind Affekte und Emotionen ebenso wichtig wie die rationalen Abläufe.
Auch die kognitive Psychologie ist bei der sozialen Kognition von Bedeutung. Dies zeigt sich besonders daran, dass „viele Begriffe und Annahmen aus der kognitiven Psychologie entliehen“ sind.
Die Frage, ob Urteile über Menschen stark vom Vorwissen des Urteilbildenden abhängen und nicht nur von den momentanen Stimuli (= Reizen), soll im folgenden beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist sozial an der sozialen Kognition?
- 3 Grundlagen der Kognition
- 3.1 Informationsverarbeitung
- 3.2 Struktur des Wissens
- 3.3 Schlussfolgerungen, Entscheidungen und Urteile - Beeinflussung
- 3.4 Urteilsheuristiken
- 4 Kognitive Vorgänge im Alltag
- 4.1 Testen sozialer Hypothesen
- 4.2 Stereotype
- 4.3 Illusorische Korrelation
- 4.4 Der Bestätigungseffekt
- 4.5 Der Anspielungseffekt
- 5 Die Bedeutung von Umwelteinflüssen in kognitiven Prozessen
- 5.1 Verteilung von Stimulusinformationen
- 5.2 Sprache und Kommunikation
- 5.2.1 Implizite Verbkausalität
- 5.2.2 Adjektive
- 5.2.3 Systematische Ordnung
- 5.2.4 Linguistische Kategorien
- 5.2.5 Linguistische Intergruppenverzerrung
- 5.3 Die kognitiv-affektive Regulation
- 5.3.1 Stimmungskongruenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die soziale Kognition, den Prozess der Informationsverarbeitung und Meinungsbildung im sozialen Kontext. Es beleuchtet die Interaktion zwischen kognitiven Prozessen, Vorwissen, und Umwelteinflüssen auf Entscheidungen und Urteile.
- Die Rolle von Vorwissen und momentanen Reizen bei der Entscheidungsfindung
- Der Einfluss kognitiver Prozesse auf soziales Verhalten
- Die Bedeutung von Umwelteinflüssen, insbesondere Sprache und Kommunikation
- Unterschiede zwischen Top-down und Bottom-up Informationsverarbeitung
- Die Berücksichtigung von Affekten und Emotionen in der kognitiven Verarbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Kognition ein und betont die Abhängigkeit menschlicher Reaktionen von Wahrnehmungen, Vorstellungen und Stereotypen. Sie hebt die Bedeutung des Verständnisses der subjektiven Realitätskonstruktion für das Verständnis sozialen Verhaltens hervor und benennt das Ziel der sozialen Kognition als die Erforschung der Prozesse der Meinungsbildung, Informationsspeicherung und des Abrufs aus dem Gedächtnis. Es wird die Bedeutung von Einstellungsänderung, Attributionsforschung und Stereotypen sowie die Rolle von Affekten und Emotionen neben rationalen Abläufen betont. Schließlich wird die Frage nach dem Einfluss des Vorwissens des Urteilenden auf Urteile über Menschen im Vergleich zu momentanen Stimuli aufgeworfen.
2 Was ist sozial an der sozialen Kognition?: Dieses Kapitel beleuchtet den sozialen Charakter der Informationsverarbeitung, der durch die Abhängigkeit von Vorwissen und momentanen Reizen bestimmt wird. Es betont, dass „sozial“ nicht gleichbedeutend mit „wohlwollend“ ist. Der evolutionstheoretische Ansatz wird herangezogen, um zu erklären, wie stark das menschliche Denken vom sozialen Kontext abhängt. Die unterschiedlichen Reizeigenschaften der physikalischen und sozialen Umwelt werden verglichen, wobei die fehlende direkte Messbarkeit sozialer Reize wie Gefühle und Emotionen hervorgehoben wird. Ein Beispiel für die unterschiedliche Wahrnehmung gleicher Hinweisreize wird mit Maskulinität und Rationalität gegeben.
3 Grundlagen der Kognition: Dieses Kapitel beschreibt die menschliche Informationsverarbeitung als mehrstufigen Prozess, beginnend mit der Wahrnehmung eines Reizes, über die Enkodierung und Interpretation mit bekanntem Wissen bis hin zu Urteilen und Entscheidungen. Es wird ein Schema der kognitiven Stufen der Informationsverarbeitung vorgestellt, welches die Prozesse von der Wahrnehmung über die Enkodierung und Kategorisierung bis zu Schlussfolgerungen, Entscheidungen und Verhaltensreaktionen darstellt.
Schlüsselwörter
Soziale Kognition, Informationsverarbeitung, Meinungsbildung, Vorwissen, Stereotype, Umwelteinflüsse, Sprache, Kommunikation, kognitive Prozesse, Entscheidungen, Urteile, Affekte, Emotionen, Top-down-Verarbeitung, Bottom-up-Verarbeitung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Soziale Kognition"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema "Soziale Kognition". Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Informationsverarbeitung und Meinungsbildung im sozialen Kontext, der Interaktion zwischen kognitiven Prozessen, Vorwissen und Umwelteinflüssen auf Entscheidungen und Urteile.
Welche Kapitel werden behandelt?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: 1. Einleitung; 2. Was ist sozial an der sozialen Kognition?; 3. Grundlagen der Kognition (inkl. Informationsverarbeitung, Wissensstruktur, Urteilsheuristiken); 4. Kognitive Vorgänge im Alltag (inkl. Testen sozialer Hypothesen, Stereotype, Illusorische Korrelation, Bestätigungseffekt, Anspielungseffekt); 5. Die Bedeutung von Umwelteinflüssen in kognitiven Prozessen (inkl. Stimulusinformationen, Sprache und Kommunikation, kognitiv-affektive Regulation).
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht die soziale Kognition, den Prozess der Informationsverarbeitung und Meinungsbildung im sozialen Kontext. Es beleuchtet die Interaktion zwischen kognitiven Prozessen, Vorwissen und Umwelteinflüssen auf Entscheidungen und Urteile. Es werden die Rolle des Vorwissens, der Einfluss kognitiver Prozesse auf soziales Verhalten, die Bedeutung von Umwelteinflüssen (insbesondere Sprache und Kommunikation) und die Berücksichtigung von Affekten und Emotionen in der kognitiven Verarbeitung behandelt.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Rolle von Vorwissen und momentanen Reizen bei der Entscheidungsfindung, der Einfluss kognitiver Prozesse auf soziales Verhalten, die Bedeutung von Umwelteinflüssen (besonders Sprache und Kommunikation), Unterschiede zwischen Top-down und Bottom-up Informationsverarbeitung und die Berücksichtigung von Affekten und Emotionen in der kognitiven Verarbeitung. Weitere wichtige Konzepte sind Stereotype, Urteilsheuristiken und die Illusorische Korrelation.
Was versteht man unter "sozialer Kognition" im Kontext dieses Dokuments?
Soziale Kognition beschreibt im Kontext des Dokuments den Prozess der Informationsverarbeitung und Meinungsbildung im sozialen Kontext. Es wird betont, dass "sozial" nicht gleichbedeutend mit "wohlwollend" ist und dass das menschliche Denken stark vom sozialen Kontext abhängig ist, beeinflusst durch Vorwissen, momentane Reize und Umwelteinflüsse wie Sprache und Kommunikation.
Wie wird die Informationsverarbeitung beschrieben?
Die Informationsverarbeitung wird als mehrstufiger Prozess dargestellt, der von der Wahrnehmung eines Reizes über die Enkodierung und Interpretation mit bekanntem Wissen bis hin zu Urteilen und Entscheidungen reicht. Es wird ein Schema vorgestellt, das die Prozesse von der Wahrnehmung über die Enkodierung und Kategorisierung bis zu Schlussfolgerungen, Entscheidungen und Verhaltensreaktionen abbildet. Die Unterscheidung zwischen Top-down und Bottom-up Verarbeitung wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielen Umwelteinflüsse?
Umwelteinflüsse, insbesondere Sprache und Kommunikation, spielen eine entscheidende Rolle in der kognitiven Verarbeitung. Das Dokument beleuchtet die Wirkung von sprachlichen Aspekten wie impliziter Verbkausalität, Adjektiven, systematischer Ordnung, linguistischen Kategorien und linguistischen Intergruppenverzerrungen auf die kognitive Verarbeitung.
Welche Rolle spielen Affekte und Emotionen?
Affekte und Emotionen werden als wichtige Faktoren in der kognitiven Verarbeitung betrachtet. Das Dokument untersucht den Einfluss von Stimmungskongruenz auf die Informationsverarbeitung und die Einbeziehung von emotionalen Aspekten in die Entscheidungsfindung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Soziale Kognition, Informationsverarbeitung, Meinungsbildung, Vorwissen, Stereotype, Umwelteinflüsse, Sprache, Kommunikation, kognitive Prozesse, Entscheidungen, Urteile, Affekte, Emotionen, Top-down-Verarbeitung, Bottom-up-Verarbeitung.
- Quote paper
- Markus Bürgel (Author), Inga Großmann (Author), Oliver Palussek (Author), 2004, Soziale Kognition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30518